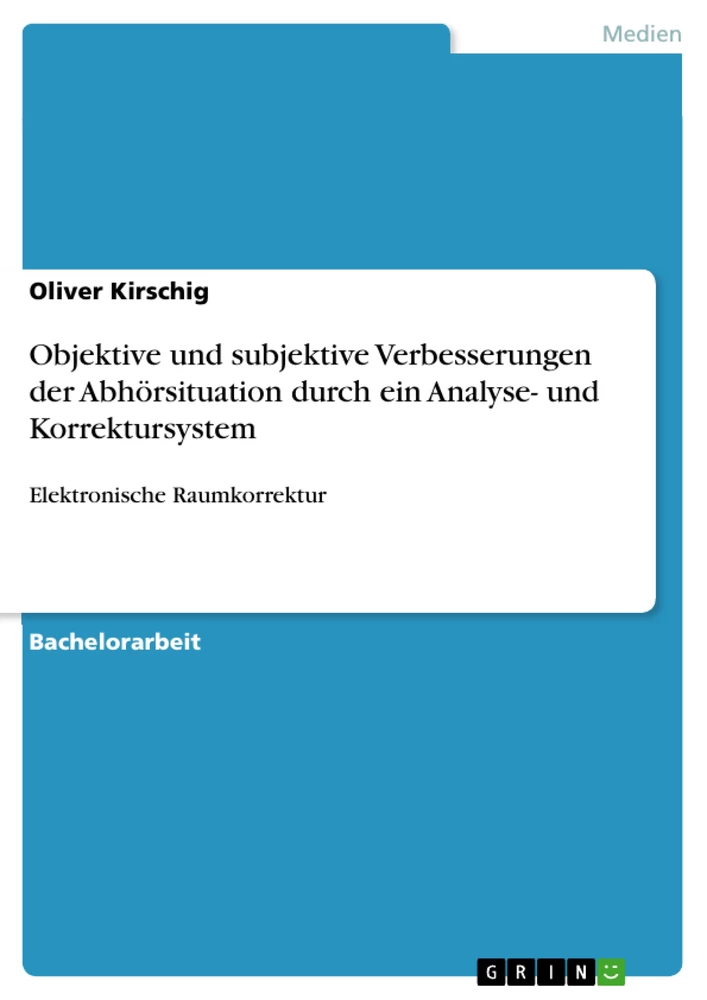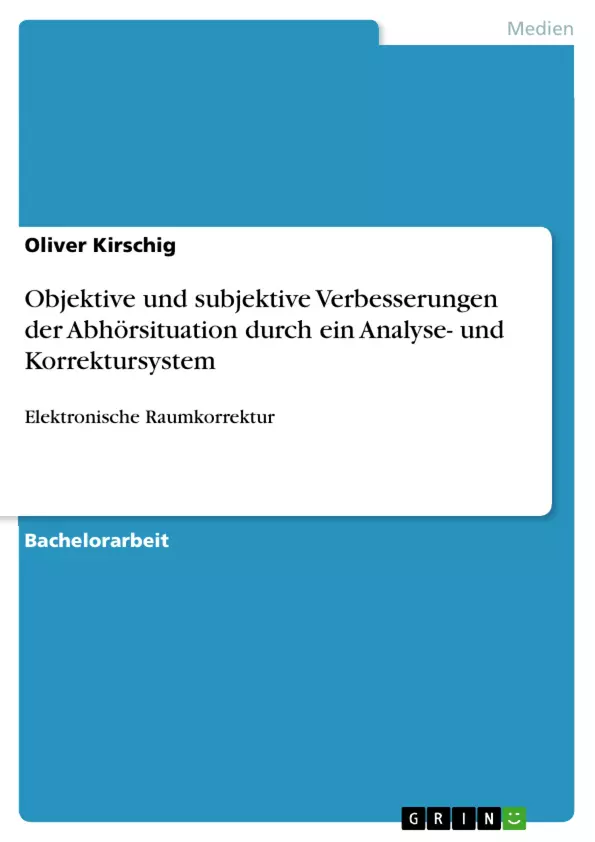In vorliegender Arbeit werden die Ursachen und Gründe untersucht, welche für eine elektronische Raumkorrektur sprechen und inwiefern die Abhörsituation objektiv sowie subjektiv verbessert werden kann. Anhand der objektiven Messungen und des subjektiven Hörversuchs sollen allgemeine Aussagen über die Relevanz und Akzeptanz der elektronischen Raumkorrektur getroffen werden.
Ein digitales Raumkorrektursystem wird hinsichtlich seiner Funktionalität zur subjektiven wie objektiven Optimierung des Schallfeldes an einem definierten Abhörpunkt auf Studioniveau untersucht. Insbesondere wird dabei eine tonale Ausgewogenheit sowie eine zeitrichtige Studioakustik angestrebt.
Des Weiteren werden Ursachen und Gründe untersucht, welche für eine digitale Raumkorrektur sprechen. Die Messungen finden dabei in unterschiedlichen Regien statt und werden durch Hörversuche und eine Kunstkopfaufnahme zur subjektiven Nachvollziehbarkeit dokumentiert.
Die Messergebnisse werden mit den Resultaten des Hörversuchs verglichen, um Aussagen über die Möglichkeiten sowie die Relevanz und Akzeptanz einer automatischen Raumkorrektur zu gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – „Die Wahrheit“
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 2. Grundbegriffe der Raumakustik
- 2.1 Entstehung und Fortbewegung des Schalls
- 2.1.1 Schalldruck und Pegel
- 2.1.2 Schallschnelle
- 2.1.3 Ebene und Kugelwelle
- 2.2 Schallausbreitung im Raum
- 2.2.1 Beugung
- 2.2.2 Absorption
- 2.2.3 Reflektion
- 2.3 Das Schallfeld
- 2.3.1 Direktschall
- 2.3.2 Diffusschall
- 2.3.3 Zeitlicher Verlauf des Schallfeldes
- 2.1 Entstehung und Fortbewegung des Schalls
- 3. Psychoakustik
- 3.1 Wahrnehmbarkeitsschwellen und Auswirkungen
- 3.1.1 Pegelunterschiede
- 3.1.2 Frequenzunterschiede
- 3.1.3 Phasenunterschiede
- 3.1 Wahrnehmbarkeitsschwellen und Auswirkungen
- 4. Regieraum-Akustik
- 4.1 Objektive Qualitätskriterien der Lautsprecherwiedergabe für Abhörräume
- 4.1.1 Anforderungen an das Bezugs-Schallfeld
- 4.1.2 Anforderungen an Regielautsprecher
- 4.1.3 Lautsprecheraufstellung
- 4.1 Objektive Qualitätskriterien der Lautsprecherwiedergabe für Abhörräume
- 5. Elektronische Raumentzerrung
- 5.1 Signalverarbeitung
- 5.1.1 IIR-Filter
- 5.1.2 FIR-Filter
- 5.2 Trinnov Audio
- 5.2.1 Trinnov MC Optimizer
- 5.3 Möglichkeiten der Raum- und Lautsprecherentzerrung
- 5.3.1 Time-Alignement und Frequenzweichensteuerung
- 5.3.2 Korrektur des frequenzabhängigen Raum-/Lautsprecherverhaltens
- 5.3.3 Korrektur des zeitabhängigen Raum-/Lautsprecherverhaltens
- 5.3.4 Korrektur der Lautsprecherposition
- 5.1 Signalverarbeitung
- 6. Praxis
- 6.1 Messungsaufbau
- 6.2 Testräume
- 6.2.1 HdM Stuttgart, A Regie
- 6.2.2 HdM Stuttgart, B Regie
- 6.2.3 HdM Stuttgart, Hardcut
- 6.2.4 Homestudio
- 6.3 Hörversuch der entzerrten Abhörsituation
- 6.3.1 Teststrategie
- 6.3.2 Qualitätsparameter
- 6.3.3 Testtitel
- 6.3.4 Kunstkopfaufnahmen
- 7. Ergebnisse
- 7.1 Korrektureinstellungen
- 7.2 Analyse- und Korrekturergebnisse
- 7.2.1 HdM Stuttgart, A Regie, Messung- und Korrekturergebnisse
- 7.2.2 HdM Stuttgart, B Regie, Messung- und Korrekturergebnisse
- 7.2.3 HdM Stuttgart, Hardcut, Messung- und Korrekturergebnisse
- 7.2.4 Homestudio, Messung- und Korrekturergebnisse
- 7.3 Ergebnisse der Umfrage
- 7.3.1 Akustisches Gleichgewicht
- 7.3.2 Durchsichtigkeit
- 7.3.3 Stereofoner Eindruck
- 7.3.4 Störgeräusche
- 7.3.5 Raumeindruck
- 7.3.6 Akustischer Gesamteindruck
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Evaluierung eines digitalen Raumkorrektursystems hinsichtlich seiner Funktionalität zur subjektiven und objektiven Optimierung des Schallfeldes an einem definierten Abhörpunkt auf Studioniveau. Das Ziel ist es, sowohl die Klangqualität zu verbessern als auch tonale Ausgewogenheit und zeitliche Präzision in Bezug auf die Studioakustik während des Aufnahmeprozesses zu erreichen. Die Arbeit untersucht außerdem die Ursachen und Gründe für den Einsatz einer digitalen Raumkorrektur.
- Analyse der Funktionalität eines digitalen Raumkorrektursystems
- Optimierung des Schallfeldes an einem definierten Abhörpunkt
- Verbesserung der Klangqualität auf Studioniveau
- Erreichung von tonalem Gleichgewicht und zeitlicher Präzision
- Untersuchung der Ursachen und Gründe für die Verwendung von Raumkorrektur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Aufbau der Arbeit beschreibt. Kapitel 2 behandelt die Grundbegriffe der Raumakustik, einschließlich der Entstehung und Fortbewegung von Schall, Schalldruck und Pegel, Schallschnelle, ebene und Kugelwelle sowie der Schallausbreitung im Raum. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Psychoakustik, insbesondere den Wahrnehmbarkeitsschwellen und Auswirkungen von Pegel-, Frequenz- und Phasenunterschieden.
Kapitel 4 fokussiert auf die Regieraum-Akustik und behandelt die objektiven Qualitätskriterien der Lautsprecherwiedergabe für Abhörräume, einschließlich der Anforderungen an das Bezugs-Schallfeld, die Anforderungen an Regielautsprecher und die Lautsprecheraufstellung.
Kapitel 5 erörtert die elektronische Raumentzerrung, einschließlich der Signalverarbeitung, IIR- und FIR-Filtern, Trinnov Audio und den Möglichkeiten der Raum- und Lautsprecherentzerrung. Kapitel 6 beschreibt die Praxis des Messungsaufbaus und der Testräume, einschließlich der Durchführung von Hörversuchen der entzerrten Abhörsituation.
Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Arbeit, einschließlich der Korrektureinstellungen, Analyse- und Korrekturergebnisse sowie der Ergebnisse der Umfrage. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Zusammenfassung der Ergebnisse und den Ausblick auf zukünftige Forschungsbereiche umfasst.
Schlüsselwörter
Digitale Raumkorrektur, Schallfeld, Abhörpunkt, Studioniveau, Klangqualität, tonale Ausgewogenheit, zeitliche Präzision, Psychoakustik, Regieraum-Akustik, Lautsprecherwiedergabe, Signalverarbeitung, IIR-Filter, FIR-Filter, Trinnov Audio, Messungsaufbau, Hörversuch, Ergebnisse der Umfrage.
Häufig gestellte Fragen
Was bewirkt ein digitales Raumkorrektursystem?
Es optimiert das Schallfeld an einem Abhörpunkt objektiv und subjektiv, um tonale Ausgewogenheit und eine zeitrichtige Akustik auf Studioniveau zu erreichen.
Was ist der Unterschied zwischen FIR- und IIR-Filtern?
Diese Filtertypen werden in der Signalverarbeitung zur Raumentzerrung genutzt, wobei FIR-Filter oft für komplexere Korrekturen des Zeitverhaltens eingesetzt werden.
Welche Rolle spielt die Psychoakustik in der Arbeit?
Sie hilft dabei, Wahrnehmbarkeitsschwellen für Pegel-, Frequenz- und Phasenunterschiede zu verstehen, um die Korrekturergebnisse subjektiv bewerten zu können.
Was ist der Trinnov MC Optimizer?
Es handelt sich um ein spezifisches System zur elektronischen Raumentzerrung, das in verschiedenen Studioregien (z. B. HdM Stuttgart) getestet wurde.
Welche Parameter wurden im Hörversuch abgefragt?
Abgefragt wurden unter anderem das akustische Gleichgewicht, die Durchsichtigkeit, der stereofone Eindruck und der allgemeine Raumeindruck.
Kann elektronische Korrektur bauliche Akustikmaßnahmen ersetzen?
Die Arbeit untersucht die Relevanz der elektronischen Korrektur als Ergänzung, um letzte Unzulänglichkeiten der Regieraum-Akustik auszugleichen.
- Arbeit zitieren
- Oliver Kirschig (Autor:in), 2016, Objektive und subjektive Verbesserungen der Abhörsituation durch ein Analyse- und Korrektursystem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322350