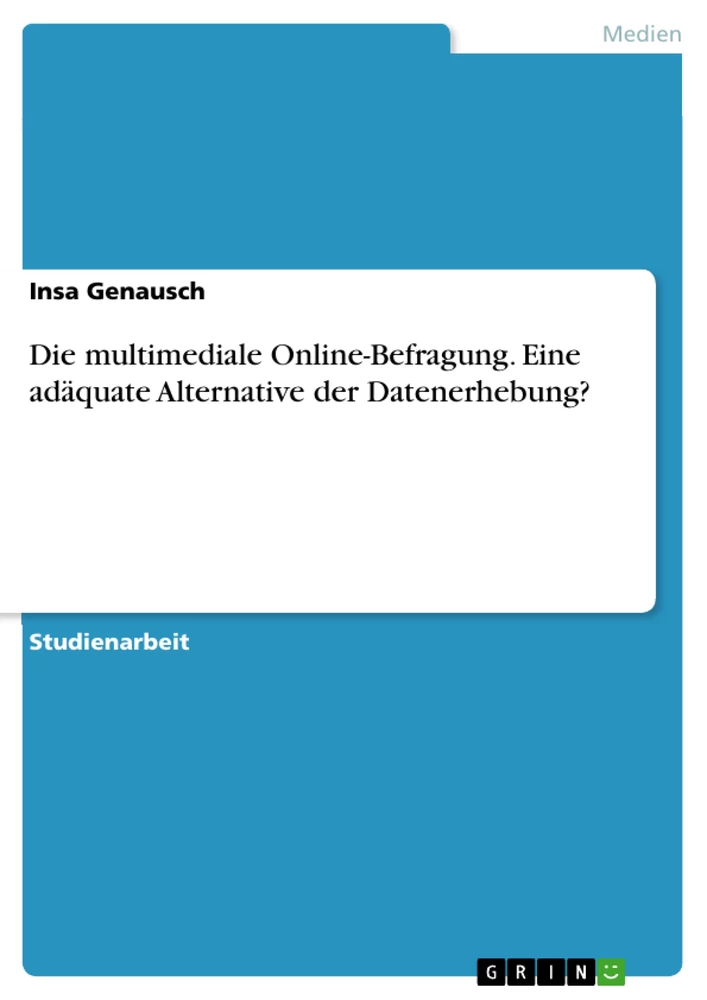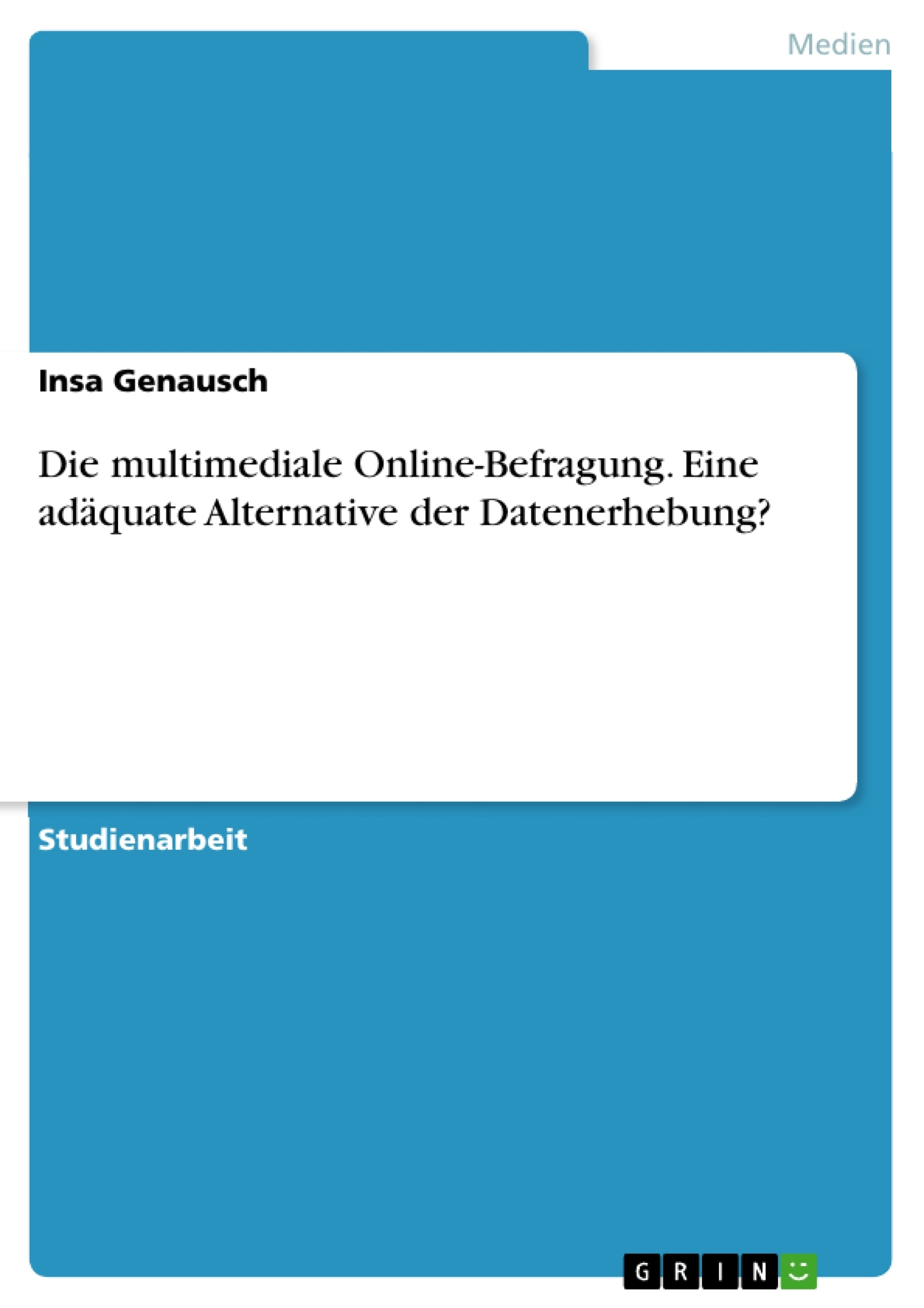Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich demnach mit den feld-experimentellen Studien von Fuchs & Funke (2009) sowie ergänzend mit einem, im Seminar „Erhebungsmethoden“ entstandenen Experiment 2013.
In beiden Untersuchungsdesigns wird sich mit den Methodeneffekten und Antwortverzerrungen in multimedialen Webbefragungen beschäftigt. Konkretes Ziel war es, herauszufinden, inwieweit die Einbindung von Video- und Audiogestützten Fragen unter Kontrolle herkömmlicher text-basierter Befragungen die kognitive Aufmerksamkeit des Teilnehmenden erhöht wird und somit Auswirkungen auf die Güte der Antwortabgabe hat. Darüber hinaus wurde mittels einzelner heikler Befragungs-Items überprüft, ob die digitale Anwesenheit des Interviewers im Video eine Antwortverzerrung beim Befragten hervorruft, hinsichtlich der Effekte von sozialer Präsenz, sozialer Erwünschtheit und dem damit einhergehenden Underreporting sensitiver Informationen.
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Forschungsdesigns als auch deren Erkenntnisse sollen diskutiert und letztendlich geklärt werden, ob die multimediale Web-Befragung eine adäquate Alternative zur klassischen textbasierten Online-Befragung verspricht. Außerdem tragen sie damit einen Beitrag zur Forschungslücke bei.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Online-Befragung
- Kognitive Stadien bei der Aufgabenbeantwortung
- Soziale Erwünschtheit
- Soziale Präsenz und subjektive Anonymität
- Soziale Entkontextualisierung
- Optimizing-Satisficing-Modell
- Experiment von Fuchs und Funke
- Experiment I + II
- Ergebnisse I + II
- Experiment im Seminar
- Ergebnisse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Effekte von multimedialen Elementen in Online-Befragungen auf die Qualität der erhobenen Daten. Im Mittelpunkt stehen die Studien von Fuchs & Funke (2009) sowie ein im Seminar „Erhebungsmethoden“ entstandenes Experiment. Die Arbeit analysiert, ob die Einbindung von Video- und Audioelementen die kognitive Aufmerksamkeit der Teilnehmer erhöht und somit die Güte der Antworten beeinflusst. Zudem wird untersucht, ob die digitale Anwesenheit des Interviewers im Video zu Antwortverzerrungen führt, insbesondere in Bezug auf soziale Präsenz, soziale Erwünschtheit und Underreporting sensibler Informationen.
- Methodeneffekte und Antwortverzerrungen in multimedialen Webbefragungen
- Einfluss von Video- und Audioelementen auf die kognitive Aufmerksamkeit
- Auswirkungen der digitalen Anwesenheit des Interviewers auf die Antwortverzerrung
- Soziale Präsenz, soziale Erwünschtheit und Underreporting sensibler Informationen
- Vergleich und Analyse von verschiedenen Forschungsdesigns
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der multimedialen Online-Befragung ein und beleuchtet deren Bedeutung als Datenerhebungsmethode in der empirischen Sozialforschung. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Adäquanz der multimedialen Web-Befragung als Alternative zur klassischen textbasierten Online-Befragung.
Das Kapitel „Theoretische Grundlagen“ erläutert zentrale Konzepte und Theorien, die für die Analyse der Experimente relevant sind, wie die Online-Befragung als Methode, kognitive Prozesse der Aufgabenbeantwortung, soziale Erwünschtheit, soziale Präsenz, soziale Entkontextualisierung und das Optimizing-Satisficing-Modell.
Im Kapitel „Experiment von Fuchs und Funke“ werden die Ergebnisse der Studien von Fuchs & Funke (2009) vorgestellt, die sich mit den Methodeneffekten und Antwortverzerrungen in multimedialen Webbefragungen auseinandersetzen. Die Arbeit beleuchtet die Ergebnisse der Experimente I und II und analysiert den Einfluss von multimedialen Elementen auf die kognitive Aufmerksamkeit und die Güte der Antworten.
Das Kapitel „Experiment im Seminar“ beschreibt ein im Seminar „Erhebungsmethoden“ entstandenes Experiment, das die Ergebnisse der Studien von Fuchs & Funke (2009) repliziert und erweitert. Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse des Seminars und analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Vergleich zu den Studien von Fuchs & Funke (2009).
Schlüsselwörter
Multimediale Online-Befragung, Web-Survey, Methodeneffekte, Antwortverzerrung, kognitive Aufmerksamkeit, soziale Präsenz, soziale Erwünschtheit, Underreporting, Forschungsdesign, Experiment, empirische Sozialforschung, Datengüte.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile einer multimedialen Online-Befragung?
Die Einbindung von Video- und Audioelementen kann die kognitive Aufmerksamkeit der Teilnehmer steigern und somit potenziell die Qualität der Antworten verbessern.
Was versteht man unter „sozialer Erwünschtheit“ bei Web-Surveys?
Es beschreibt das Phänomen, dass Befragte Antworten geben, von denen sie glauben, dass sie gesellschaftlich akzeptiert sind, anstatt ihre tatsächliche Meinung zu äußern.
Beeinflusst die digitale Präsenz eines Interviewers die Ergebnisse?
Ja, die Studien untersuchen, ob die Anwesenheit eines Interviewers im Video zu Antwortverzerrungen und dem „Underreporting“ sensibler Informationen führt.
Was erklärt das Optimizing-Satisficing-Modell?
Es beschreibt, ob Befragte den kognitiven Aufwand maximieren, um präzise Antworten zu geben (Optimizing), oder nur den minimal notwendigen Aufwand betreiben (Satisficing).
Sind Video-Befragungen eine echte Alternative zum Text-Fragebogen?
Die Arbeit diskutiert dies kritisch und wägt zwischen höherer Aufmerksamkeit und möglichen Verzerrungseffekten durch die soziale Präsenz ab.
- Citar trabajo
- Insa Genausch (Autor), 2015, Die multimediale Online-Befragung. Eine adäquate Alternative der Datenerhebung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322412