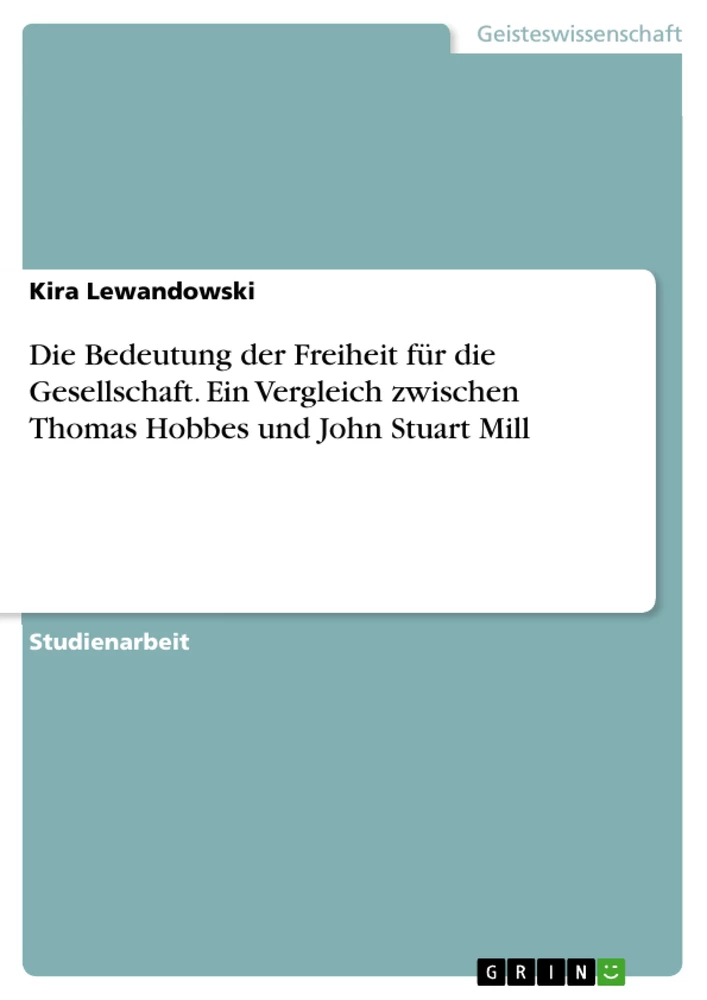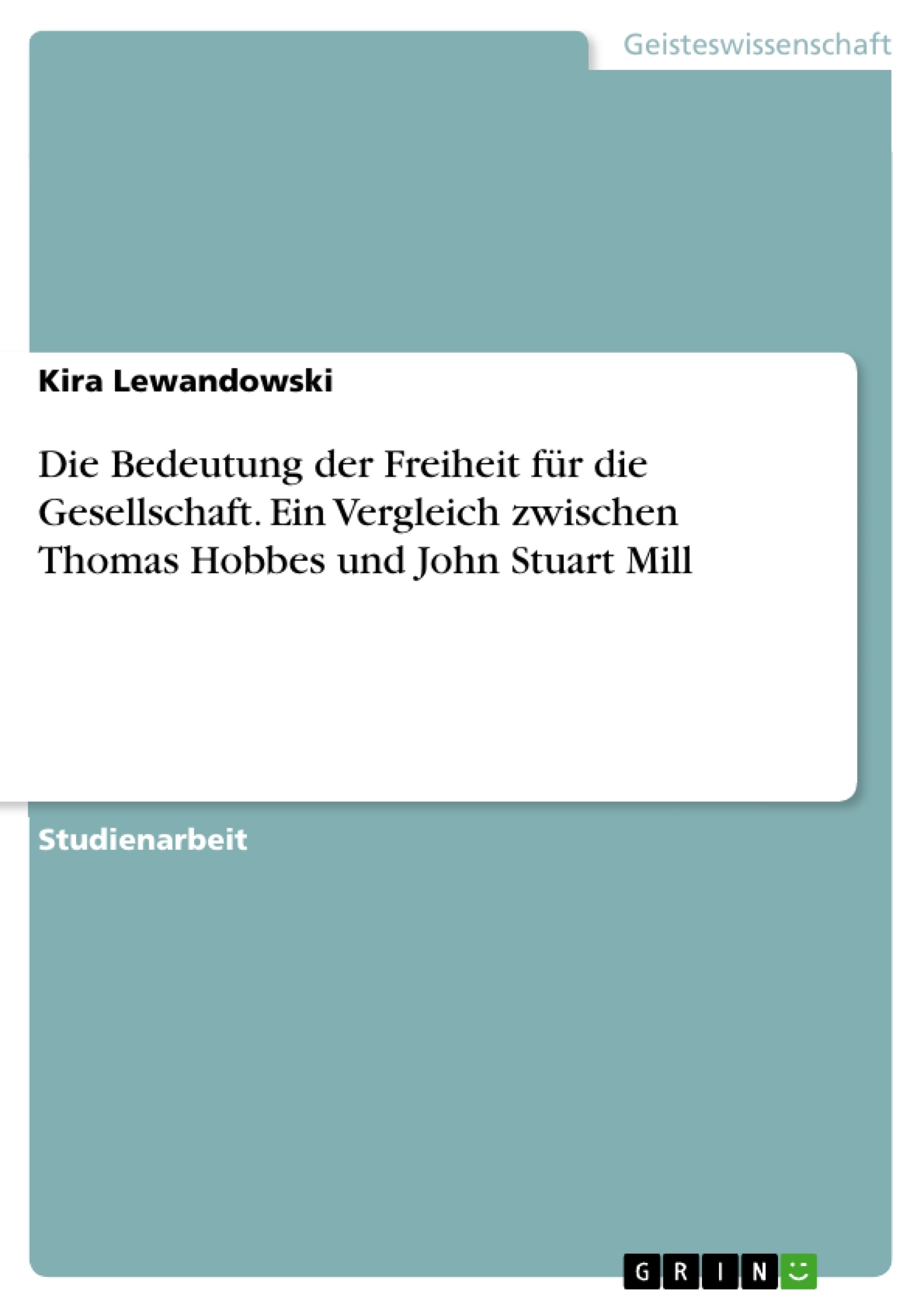Von Aristoteles, über Rousseau und Kant, bis hin zu Karl Marx – im Laufe der Geschichte haben sich die Vorstellungen und Ansichten in Bezug auf den Menschen, die Freiheit und die Prinzipien einer idealen Gesellschaft, nach denen die Menschen miteinander leben sollen, gewandelt. Während man in der Antike eher davon ausging, dass das Leben vorherbestimmt sei und jedem eine bestimmte Aufgabe zukommt, liegt die Gestaltung des Lebens im neuzeitlichen Denken eher im Ermessen eines jeden Menschen selbst.
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Überlegungen von Thomas Hobbes und John Stuart Mill. Insbesondere geht es um die Freiheit innerhalb der Gesellschaft, wie diese dort auftritt und welche Bedeutung ihr zukommt. Dazu ist es zunächst erforderlich, sowohl Menschenbilder als auch Freiheitsbegriffe der beiden Philosophen darzulegen. Grundlage dafür bilden die Werke „Leviathan“ von Thomas Hobbes und „Über die Freiheit“ von John Stuart Mill.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Menschenbild und Freiheitsbegriff
- Thomas Hobbes
- John Stuart Mill
- Freiheit in der Gesellschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich mit den Gedanken von Thomas Hobbes und John Stuart Mill auseinander, insbesondere mit der Bedeutung von Freiheit innerhalb der Gesellschaft. Sie analysiert, wie die beiden Philosophen das Menschenbild und den Freiheitsbegriff verstehen und welche Rolle die Freiheit im gesellschaftlichen Kontext spielt.
- Die Bedeutung des Naturzustands für das Verständnis von Freiheit bei Thomas Hobbes
- Der Einfluss von Vernunft und Selbstinteresse auf das menschliche Handeln nach Hobbes
- Mills Konzept der individuellen Freiheit und ihre Grenzen
- Die Rolle des Staates und der Gesellschaft in der Gestaltung von Freiheit
- Der Vergleich der Freiheitskonzepte von Hobbes und Mill
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Hausarbeit vor und führt in die Gedankenwelt von Thomas Hobbes und John Stuart Mill ein.
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Menschenbild und dem Freiheitsbegriff der beiden Philosophen. Es analysiert Hobbes' Naturzustand und die daraus resultierende Bedeutung von Freiheit für die Selbsterhaltung sowie Mills Konzept der individuellen Freiheit und die Grenzen, die durch das Gemeinwohl gesetzt werden.
Das zweite Kapitel untersucht die Bedeutung der Freiheit in der Gesellschaft. Es betrachtet die Rolle des Staates und die Grenzen der individuellen Freiheit im Hinblick auf das Gemeinwohl.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe, die in dieser Hausarbeit behandelt werden, sind Freiheit, Gesellschaft, Naturzustand, Menschenbild, Vernunft, Selbstinteresse, Gemeinwohl, Individuum, Staat, Leviathan, Über die Freiheit, Thomas Hobbes, John Stuart Mill.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich der Freiheitsbegriff bei Hobbes und Mill?
Hobbes betrachtet Freiheit primär im Kontext der Selbsterhaltung im Naturzustand, während Mill die individuelle Freiheit als zentrales Gut innerhalb einer zivilisierten Gesellschaft betont.
Was versteht Thomas Hobbes unter dem "Naturzustand"?
Es ist ein hypothetischer Zustand ohne staatliche Ordnung, in dem "jeder gegen jeden" kämpft, was die Freiheit zur reinen Notwendigkeit der Selbsterhaltung reduziert.
Wo liegen laut John Stuart Mill die Grenzen der individuellen Freiheit?
Mill argumentiert, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo sie die Freiheit oder das Wohl anderer beeinträchtigt (Schadensprinzip).
Welche Rolle spielt der Staat (Leviathan) bei Hobbes?
Der Staat ist notwendig, um Sicherheit zu garantieren; dafür geben die Individuen einen Teil ihrer ursprünglichen Freiheit an den Souverän ab.
Warum ist der Vergleich dieser beiden Philosophen heute noch relevant?
Der Konflikt zwischen staatlicher Sicherheit (Hobbes) und individueller Selbstbestimmung (Mill) ist ein Grundpfeiler moderner politischer Debatten.
- Arbeit zitieren
- Kira Lewandowski (Autor:in), 2015, Die Bedeutung der Freiheit für die Gesellschaft. Ein Vergleich zwischen Thomas Hobbes und John Stuart Mill, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322477