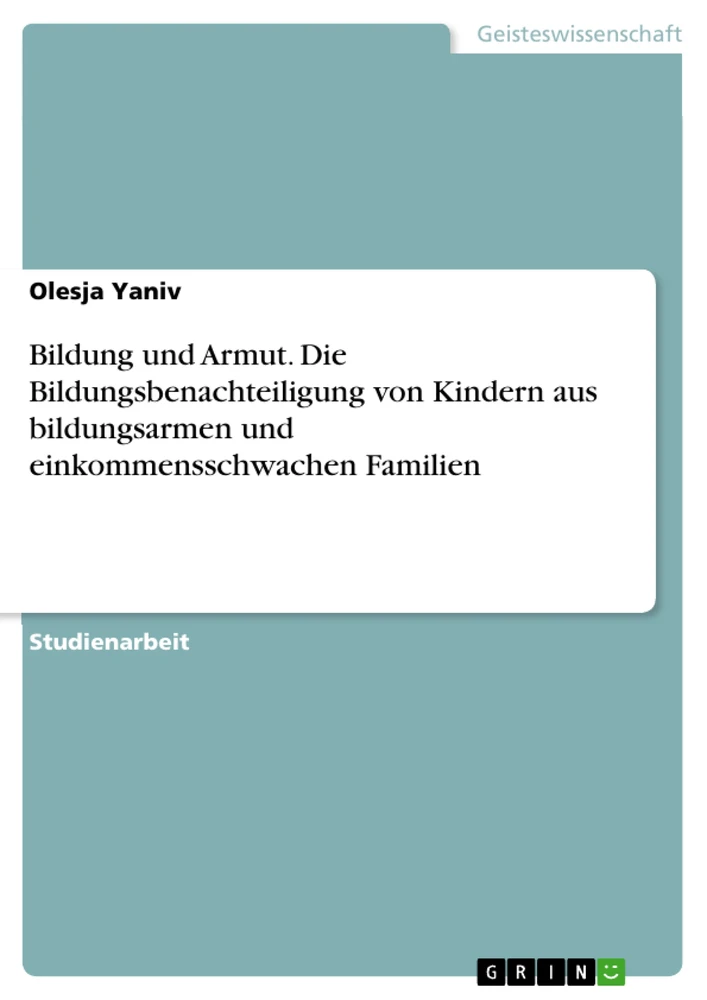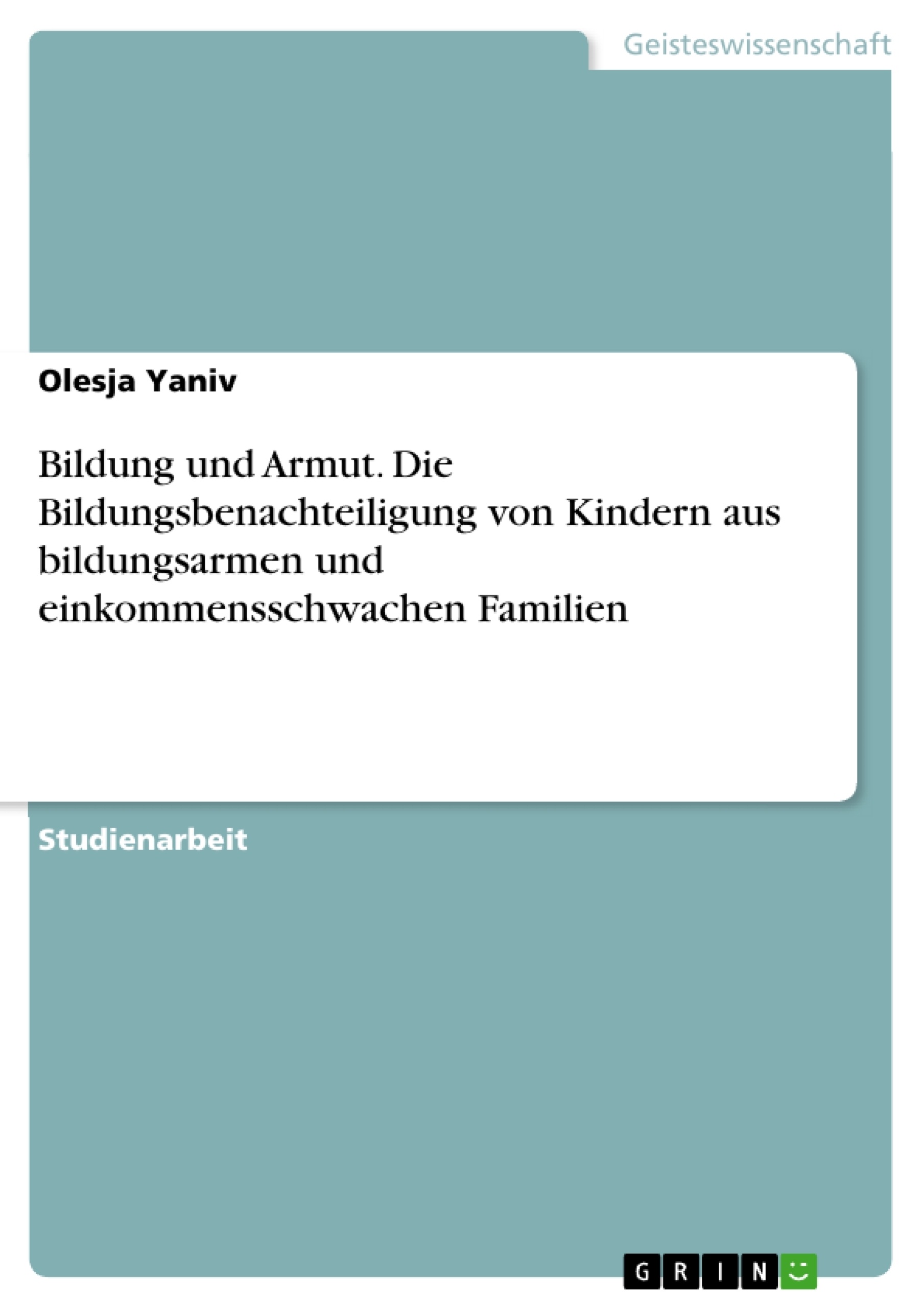In dieser Hausarbeit werden praxisorientierte Studien und theoretische Auseinandersetzung genutzt, um die Bestrafung von Kinderarmut und resultierende Folgen in Form von Bildungsbenachteiligung zu untersuchen. Es wird geprüft, inwieweit schlechte finanzielle Lage und fehlende Abschlüsse der Eltern die Bildungschancen ihrer Kinder beeinflussen können, welche weiteren Faktoren in gleichem Maße zur Bildungsbenachteiligung führen können und die Kinder somit mit der Bestrafung ihrer Armut zu kämpfen haben.
„Armut“ und „Bildung“ und das Verhältnis beider stehen seit geraumer Zeit im Mittelpunkt zahlreicher Diskurse. Im Hinblick auf Ursachen sowie die Bekämpfung der Armut spielt die Bildung eine wesentliche Rolle, sowohl bei der Betrachtung sozialer Ungleichheiten und daraus resultierenden Bildungsunterschiede als auch bei der Zurückführung von Kinderarmut auf Bildungsmängel. Dabei ist Bildung ein Menschenrecht und ist im deutschen Grundgesetz verankert.
Bildung ist die Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung und befähigt Menschen, ihre politische, soziale, kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation zu verbessern. Kinder aus sozial benachteiligten Familien gehören meist zu den Bildungsverlierern. Die Armut basiert jedoch selten auf fehlenden Schulabschlüssen, sondern wird dadurch nur verstärkt und ist nicht der Verursacher von Not.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen relevanter Begriffe
- 2.1 Definition der Armut und Kinderarmut
- 2.2 Definition der Bildung und Bildungsarmut
- 3. Bildungsbenachteiligung in Deutschland
- 4. Armut und Bildung: Untersuchungen nach PISA und IGLU
- 5. Folgen von Kinderarmut
- 6. Notwendige Veränderungen
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Bestrafung von Armut in Form von Bildungsbenachteiligung bei Kindern aus bildungsarmen und einkommensschwachen Familien und deren Folgen. Die Arbeit analysiert den Einfluss von Armut auf die Bildungschancen von Kindern und beleuchtet die Mechanismen, die zu dieser Benachteiligung beitragen. Die Zielsetzung ist es, ein umfassendes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Armut und Bildung zu entwickeln und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Definition und verschiedene Arten von Armut (Einkommensarmut, Zertifikatsarmut, Kompetenzarmut)
- Zusammenhang zwischen Armut und Bildungsbenachteiligung in Deutschland
- Auswirkungen von Kinderarmut auf den Bildungs- und Lebensweg
- Analyse von Studien wie PISA und IGLU
- Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungssituation benachteiligter Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bestrafung von Armut durch Bildungsbenachteiligung ein und beleuchtet die Relevanz des Themas anhand eines Zitats von Nelson Mandela. Sie verweist auf die Bedeutung von Bildung als Menschenrecht und betont den Zusammenhang zwischen Armut und Bildung. Die Arbeit kündigt die Untersuchung praxisorientierter Studien und theoretischer Auseinandersetzungen an, um den Einfluss von Armut auf die Bildungschancen von Kindern zu analysieren. Sie skizziert den Forschungsansatz, der die finanziellen Gegebenheiten der Eltern und deren Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder im Mittelpunkt stellt. Weiterhin wird die Rolle weiterer Faktoren bei der Bildungsbenachteiligung thematisiert.
2. Definitionen relevanter Begriffe: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen von Armut und Bildung. Es kritisiert vereinfachte Definitionen von Armut, die sich lediglich auf das Einkommen konzentrieren, und differenziert zwischen absoluter, relativer und sozio-kultureller Armut. Im Kontext von Kinderarmut werden Einkommensarmut, Zertifikatsarmut und Kompetenzarmut als drei verschiedene Kategorien unterschieden, wobei deren Auswirkungen auf den Bildungs- und Berufserfolg der Kinder hervorgehoben werden. Das Kapitel unterstreicht die Komplexität der Armut und ihrer Auswirkungen, insbesondere im Hinblick auf die Bildungschancen betroffener Kinder, wobei der Einfluss auf die Sozialisation und die Motivation zum Lernen im Vordergrund steht.
Häufig gestellte Fragen zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Armut und Bildungsbenachteiligung
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Bestrafung von Armut in Form von Bildungsbenachteiligung bei Kindern aus bildungsarmen und einkommensschwachen Familien und deren Folgen. Sie analysiert den Einfluss von Armut auf die Bildungschancen von Kindern und beleuchtet die Mechanismen, die zu dieser Benachteiligung beitragen. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Armut und Bildung zu entwickeln und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Arten von Armut (Einkommensarmut, Zertifikatsarmut, Kompetenzarmut), den Zusammenhang zwischen Armut und Bildungsbenachteiligung in Deutschland, die Auswirkungen von Kinderarmut auf den Bildungs- und Lebensweg, Analysen von Studien wie PISA und IGLU sowie mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungssituation benachteiligter Kinder.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Definitionen relevanter Begriffe (inkl. Definition von Armut und Kinderarmut sowie Bildung und Bildungsarmut), Bildungsbenachteiligung in Deutschland, Armut und Bildung: Untersuchungen nach PISA und IGLU, Folgen von Kinderarmut, Notwendige Veränderungen und Fazit. Jedes Kapitel wird in der vorliegenden Übersicht zusammengefasst.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik der Bestrafung von Armut durch Bildungsbenachteiligung ein, betont die Relevanz von Bildung als Menschenrecht und den Zusammenhang zwischen Armut und Bildung. Sie kündigt die Untersuchung praxisorientierter Studien und theoretischer Auseinandersetzungen an, um den Einfluss von Armut auf die Bildungschancen von Kindern zu analysieren. Der Fokus liegt auf den finanziellen Gegebenheiten der Eltern und deren Einfluss, sowie weiteren Faktoren bei der Bildungsbenachteiligung.
Wie werden Armut und Bildung definiert?
Das Kapitel "Definitionen relevanter Begriffe" liefert präzise Definitionen von Armut und Bildung. Es kritisiert vereinfachte Definitionen von Armut, die sich nur auf Einkommen konzentrieren, und differenziert zwischen absoluter, relativer und sozio-kultureller Armut. Im Kontext von Kinderarmut werden Einkommensarmut, Zertifikatsarmut und Kompetenzarmut unterschieden, mit Fokus auf deren Auswirkungen auf den Bildungs- und Berufserfolg. Die Komplexität der Armut und ihrer Auswirkungen auf die Bildungschancen wird hervorgehoben.
Welche Studien werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert Studien wie PISA und IGLU, um den Zusammenhang zwischen Armut und Bildungsbenachteiligung zu untersuchen und die Auswirkungen auf den Bildungsweg von Kindern aufzuzeigen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Der Inhalt des Kapitels "Fazit" ist in der gegebenen Vorschau nicht enthalten. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt jedoch Hinweise auf die zu erwartenden Schlussfolgerungen bezüglich der komplexen Zusammenhänge zwischen Armut und Bildung und möglicher Lösungsansätze.)
- Arbeit zitieren
- Olesja Yaniv (Autor:in), 2016, Bildung und Armut. Die Bildungsbenachteiligung von Kindern aus bildungsarmen und einkommensschwachen Familien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322513