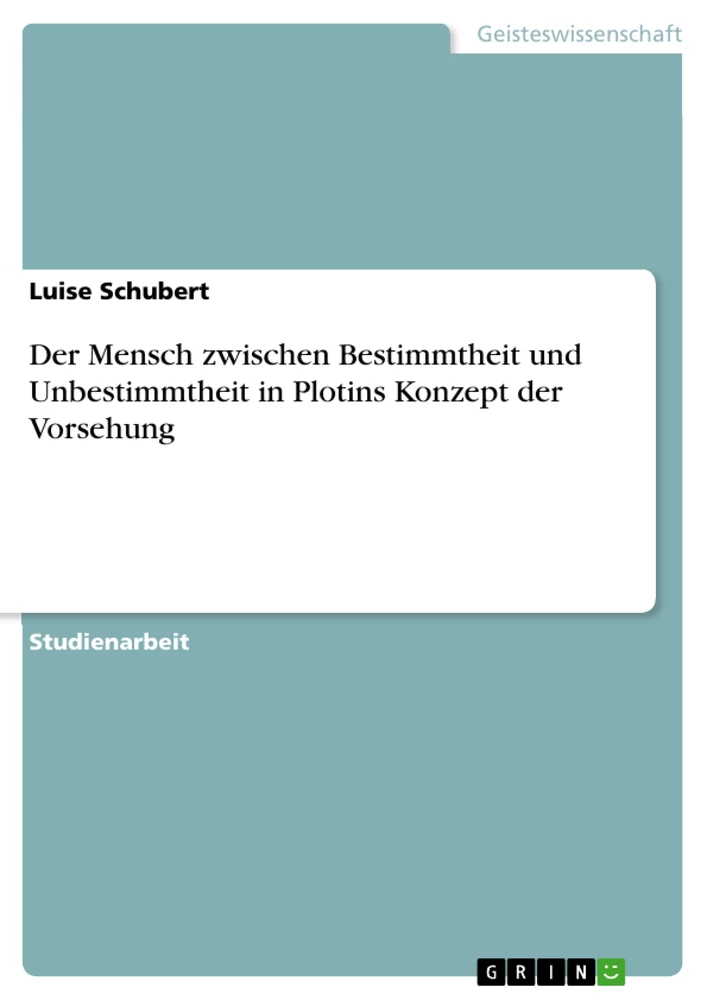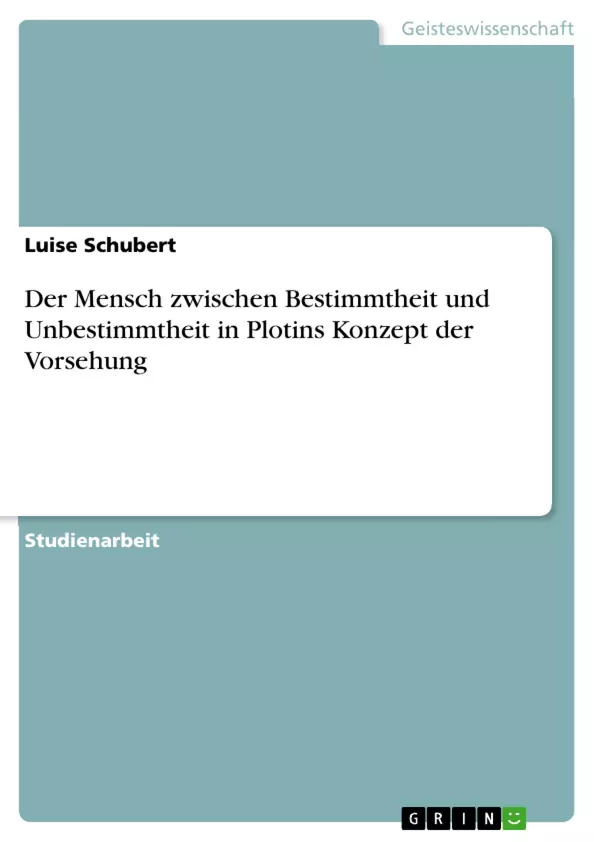Das Werk des neuplatonischen Philosophen Plotin hat bis heute nicht an Relevanz verloren. Ganz in der Tradition der altertümlichen Metaphysik des Geistes, ist der Leitgedanke, den Plotin in seinen Enneaden zu ergründen versucht, einmal die Frage nach der Grundursache, nach der ἀρχή, dem „beherrschenden Woher“ des Seins und zum anderen die Erörterung des menschlichen Denkens.
Die Abhandlung „περὶ προνοίας“ oder zu Deutsch: „Von der Vorsehung“ ist die zweite und dritte Schrift der dritten Enneade und erläutert, wie der Titel schon verspricht, die Problematik der Vorsehung. Ausgehend von einem Zweifel Plotins an der Vorsehung des Alls, der sich in der Existenz von Zufällen und Ungefährem zu manifestieren scheint, versucht er, da er von einer allumfassenden Weltordnung überzeugt ist, diese innerhalb einer solchen Ordnung bzw. in der Vorsehung zu begründen. Durch die Positionierung des Menschen innerhalb des Ordnungsgefüges versucht Plotin, das Böse in der Welt einzuordnen und zu verstehen.
Doch wie weit reichen die Fesseln dieser Ordnung? Bei der Konstruktion eines so umfassenden Weltzusammenhanges scheint der Mensch in der Bestimmung gefangen zu sein, wobei sein eigener Wille das Nachsehen hat. Auf Grundlage dieser These, richtet sich der Fokus dieser Arbeit auf den freien Spielraum des Menschen innerhalb der plotinischen Vorsehung. Demzufolge soll zuerst die Struktur der kosmologischen Ordnung und die Macht der Vorsehung im Allgemeinen erläutert werden. Da auch bei Plotin die Existenz des Bösen die Prämisse für die Auseinandersetzung mit dem Menschen ist, soll auch bei mir eine kurze Ausführung über das Missverhältnis von Verdienst und Geschick des Menschen zur eigentlichen Fragestellung überleiten. Da der Begriff der Freiheit oder Unbestimmtheit einhergeht mit der Frage nach der Begrenztheit bzw. Bestimmtheit des Menschen, soll anschließend die Begrenzung durch die Inkarnation der Seele im Leib beleuchtet werden. Im Anschluss werde ich die Frage nach der Bestimmung des Menschen zum Bösen durch die Vorsehung erläutern und im darauf folgenden Kapitel den Begriff des ‚freien Prinzips‘ erörtern. Um Plotins Konzept der „unentrinnbaren Vorsehung“ in einen historisch-philosophischen Kontext zu setzen, werde ich danach die Freiheit des menschlichen Willens im Vorsehungskonstrukt von Boethius vorstellen und mit Plotins Thesen vergleichen. Im abschließenden Fazit sollen die Ergebnisse der Fragestellung zusammengefasst werden.
- Arbeit zitieren
- Luise Schubert (Autor:in), 2015, Der Mensch zwischen Bestimmtheit und Unbestimmtheit in Plotins Konzept der Vorsehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322552