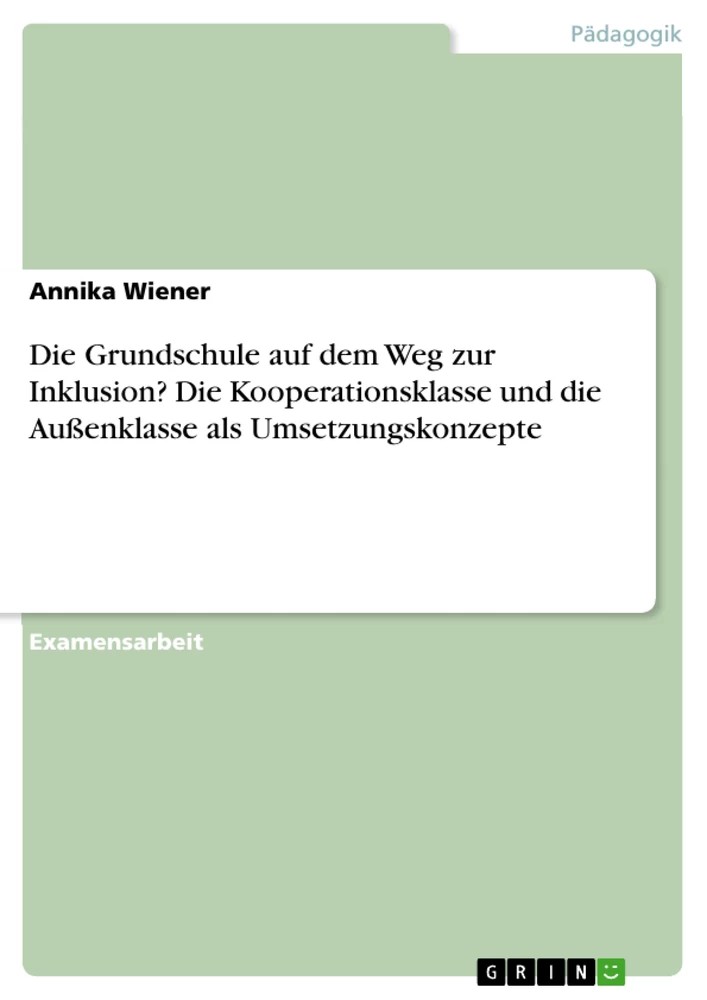Meistens handelt es sich um Einzelschüler, die in einer Regelschulklasse inklusiv unterrichtet werden. Speziell in Bayern gibt es aber neben der Möglichkeit einer Einzelinklusion auch weitere Projekte, die in Richtung der schulischen Inklusion gehen. Ein bekanntes Konzept bildet die Außenklasse, in der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf als feste Klasse an einer Regelschule unterrichtet werden. Sie werden also außerhalb der Förderschule an einer Regelschule beschult. Dabei kooperieren sie auf unterschiedliche Weisen mit einer Regelschulklasse dieser Schule. Des Weiteren existiert bereits weiter verbreitet die Möglichkeit, eine Kooperationsklasse zu bilden. In Bayern bedeutet dies, dass Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam eine Regelschulklasse mit Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf besuchen. Genaueres zu diesen beiden Beschulungsformen, die letztendlich einen großen Schritt in Richtung einer vollständigen Inklusion darstellen, wird in der folgenden Arbeit erläutert.
Zu Beginn werden die zentralen Begriffe Integration und Inklusion, die häufig parallel benutzt werden, erklärt. Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit der bisherigen historischen Entwicklung in Bezug auf die Beschulung von Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dabei werden geltende rechtliche Grundlagen geklärt, wobei der rechtliche Rahmen des Bundeslandes Bayern im Speziellen fokussiert wird. Auch im weiteren Verlauf steht dieses Bundesland im Zentrum der Arbeit.
Daraufhin wird das Konzept der Kooperationsklasse näher in den Blick genommen. Neben Begriffsbestimmungen, der Einordnung der an einer Kooperationsklasse Beteiligten und der Klärung wichtiger Grundlagen bei diesem Konzept soll in der vorliegenden Arbeit auch das komplexe Aufgabenfeld der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste in Bezug auf diese Klassenform näher erläutert werden.
Im Anschluss wird der didaktisch-methodische Rahmen betrachtet, der bei der Umsetzung integrativer beziehungsweise inklusiver Unterrichtskonzepte zu beachten ist. Dabei werden vor allem verschiedene Unterrichtsformen, die in einer Klassenform wie der Kooperationsklasse bedeutend sind, näher erklärt. Außerdem wird in diesem Zusammenhang auch auf das Thema der Leistungsbewertung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf dieser Klassenformen eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Überblick
- 2. Begriffsklärungen
- 2.1 Integration
- 2.2 Inklusion
- 3. Die Entwicklung - von der Exklusion zur Inklusion
- 3.1 Historische Entwicklung
- 3.2 Rechtliche Grundlagen und deren Entwicklung
- 3.2.1 Allgemeine rechtliche Situation und deren Entwicklung
- 3.2.2 Grundlagen im Bundesland Bayern
- 4. Allgemeine Beschulungsformen
- 5. Die Kooperationsklasse als bayerisches Konzept
- 5.1 Bedeutung von Kooperation und Kooperationsklasse
- 5.2 Akteure der Kooperation
- 5.3 Kriterien, nach denen Schüler für die Kooperationsklasse ausgewählt werden
- 5.3.1 Allgemein
- 5.3.2 Kriterien der Schülerauswahl in Hinblick auf den Förderschwerpunkt
- 5.4 Die Aufgaben des Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes in der Kooperationsklasse
- 6. Die Außenklasse - zwei Beispiele in Rhön-Grabfeld
- 6.1 Definition von geistiger Behinderung
- 6.2 Allgemeines zur Außenklasse
- 6.3 Rahmen der Zusammenarbeit an beiden Grundschulen
- 6.4 Entwicklung der Zusammenarbeit
- 7. Didaktisch-methodischer Rahmen integrativer Modelle
- 7.1 Vorbemerkungen
- 7.2 Lern- und Kooperationsformen nach Wocken
- 7.3 Abhängigkeit vom gewählten Curriculum
- 7.4 Wichtige Aspekte für die Praxis und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten
- 7.5 Leistungserhebung und Leistungsbewertung
- 7.6 Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung
- 7.7 Eigene Erlebnisse im Unterrichtsalltag der Außenklassen
- 7.7.1 Unterricht an der Grundschule Wollbach
- 7.7.2 Unterricht an der Besengau-Grundschule Bastheim
- 8. Eigene empirische Erhebungen zur Außenklasse
- 8.1 Erhebungsmethoden
- 8.1.1 Erfassung der Lehrer- und Schulleiterperspektive
- 8.1.2 Erfassung der Elternperspektive
- 8.1.3 Erfassung der Schülerperspektive
- 8.2 Auswertung
- 8.2.1 Perspektive der Schulleiter und weiterer Beteiligter der Institution Schule
- 8.2.2 Elternperspektive
- 8.2.3 Schülerperspektive
- 8.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 8.4 Zeitungsartikel
- 8.1 Erhebungsmethoden
- 9. Fazit und Konfliktsituation durch das Spannungsfeld Separation und Integration im Schulsystem
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die Grundschule bereits auf dem Weg ist, Inklusion zu verwirklichen. Sie untersucht dabei die Kooperationsklasse und die Außenklasse als Modelle, die dieses Ziel erreichen wollen. Die Arbeit beleuchtet didaktisch-methodische Überlegungen zu diesen Konzepten, persönliche Erfahrungen und kritische Anmerkungen. Eigene empirische Ergebnisse aus Befragungen runden die Arbeit ab.
- Die Entwicklung der Inklusion in der Grundschule
- Kooperationsklasse als bayerisches Konzept
- Die Außenklasse als Modell für inklusiven Unterricht
- Didaktisch-methodische Ansätze für integrative Modelle
- Empirische Ergebnisse aus Befragungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort erläutert die Motivation der Autorin für die Wahl des Themas und die Entstehung der Arbeit. Kapitel 1 gibt einen Überblick über die aktuelle Situation der inklusiven Beschulung in Bayern. In Kapitel 2 werden die zentralen Begriffe Integration und Inklusion definiert. Kapitel 3 beleuchtet die historische Entwicklung der Beschulung von Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und die rechtlichen Grundlagen, mit besonderem Fokus auf das Bundesland Bayern. Kapitel 4 stellt verschiedene Beschulungsformen vor. Kapitel 5 widmet sich der Kooperationsklasse als bayerisches Konzept, einschließlich der Bedeutung von Kooperation, beteiligten Akteuren, Auswahlkriterien für Schüler und Aufgaben des Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes. Kapitel 6 präsentiert zwei Beispiele für Außenklassen in Rhön-Grabfeld, inklusive Definition von geistiger Behinderung, allgemeiner Beschreibung der Außenklasse und der Zusammenarbeit an den beiden Grundschulen. Kapitel 7 behandelt den didaktisch-methodischen Rahmen integrativer Modelle, einschließlich Vorbemerkungen, Lern- und Kooperationsformen, Abhängigkeit vom Curriculum, wichtigen Aspekten für die Praxis und konkreten Umsetzungsmöglichkeiten, Leistungserhebung und Leistungsbewertung, Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung und eigenen Erlebnissen im Unterrichtsalltag der Außenklassen. Kapitel 8 beschreibt eigene empirische Erhebungen zur Außenklasse, einschließlich der Erhebungsmethoden, der Auswertung der Lehrer-, Schulleiter-, Eltern- und Schülerperspektive und einer Zusammenfassung der Ergebnisse. Kapitel 9 fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die Konfliktsituation durch das Spannungsfeld Separation und Integration im Schulsystem.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Inklusion, Integration, Kooperationsklasse, Außenklasse, sonderpädagogischer Förderbedarf, geistige Behinderung, didaktisch-methodische Ansätze, empirische Forschung, Schulsystem und Separation.
Häufig gestellte Fragen zu Inklusion in der Grundschule
Was ist der Unterschied zwischen einer Kooperationsklasse und einer Außenklasse?
In einer Kooperationsklasse besuchen Schüler mit Förderbedarf eine Regelschulklasse. Eine Außenklasse ist eine feste Gruppe einer Förderschule, die an einer Regelschule unterrichtet wird.
Welche Rolle spielen die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste (MSD)?
Die MSD unterstützen die Lehrkräfte in Kooperationsklassen bei der Förderung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
Wie erfolgt die Leistungsbewertung in inklusiven Modellen?
Die Bewertung orientiert sich oft am individuellen Förderbedarf und dem gewählten Curriculum, was von der Regelschulbewertung abweichen kann.
Gibt es gesetzliche Grundlagen für Inklusion in Bayern?
Ja, die Arbeit beleuchtet die spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen und historischen Entwicklungen der Beschulung in Bayern.
Was sind die größten Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung?
Herausforderungen liegen im Spannungsfeld zwischen Separation und Integration sowie in der didaktisch-methodischen Ausgestaltung des gemeinsamen Unterrichts.
- Quote paper
- Annika Wiener (Author), 2015, Die Grundschule auf dem Weg zur Inklusion? Die Kooperationsklasse und die Außenklasse als Umsetzungskonzepte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322569