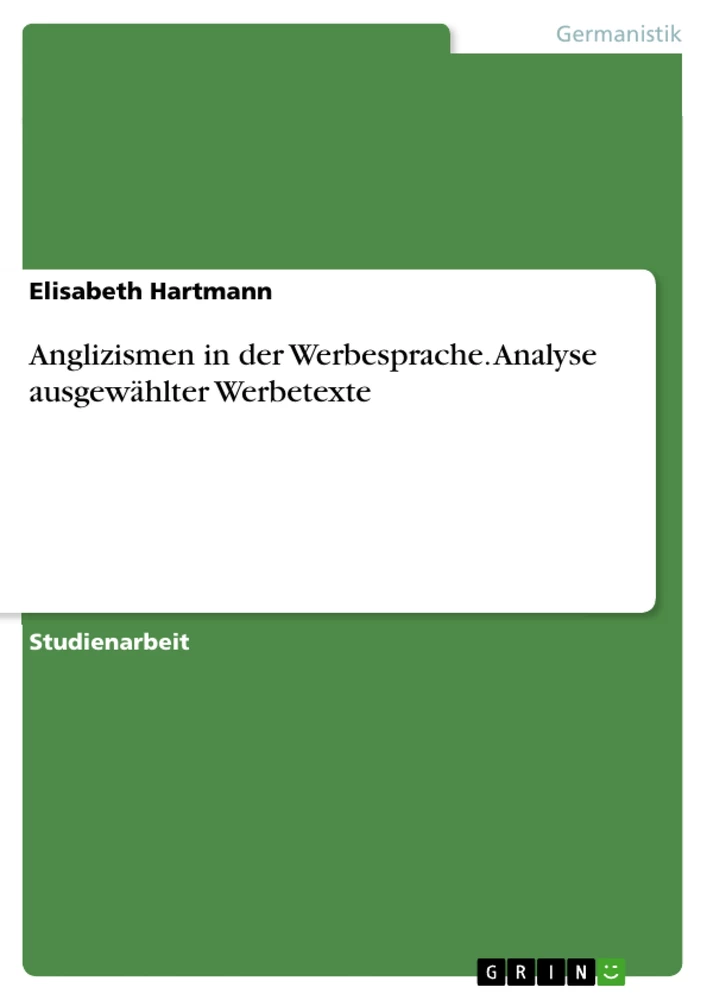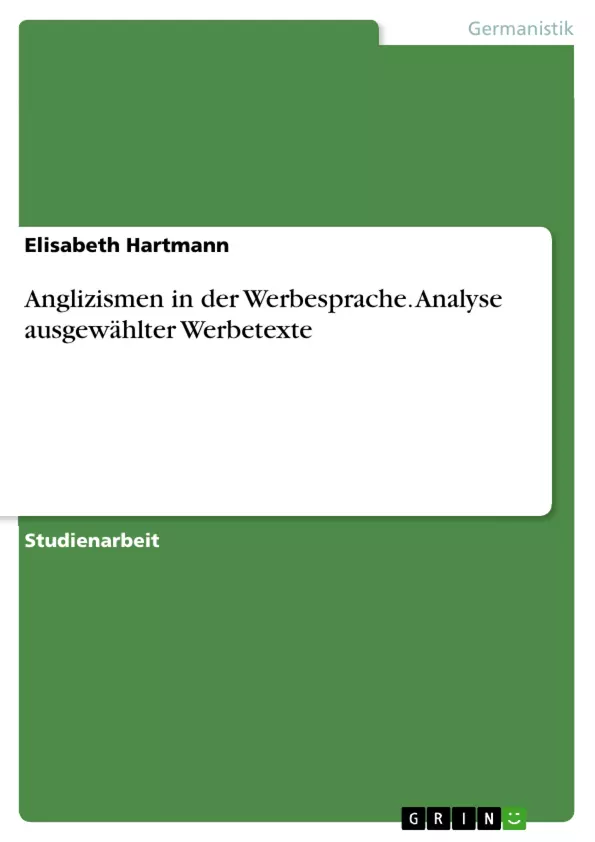Es soll in der vorliegenden Arbeit den Fragen nachgegangen werden, in welchen Kontexten besonders viele Anglizismen verwendet werden. Es wird untersucht, welche Wirkungen die einzelnen verwendeten englischen Wörter auf Stil und Kolorit der Texte haben und welches die Hauptgründe für den Gebrauch von anglo-amerikanischen Wörtern sind.
Sind die Deutschen von der Häufung von Anglizismen im Allgemeinen und in der Werbung im Speziellen genervt? Werden englische Werbesprüche möglicherweise von einem großen Teil der Bevölkerung nicht oder falsch verstanden? Wird im ungünstigsten Fall z.B. durch übertriebene Alltagspräsenz der jeweiligen Werbung oder durch fehlplazierte Slogans gar das Gegenteil der erhofften Werbung erzielt?
Im ersten Teil der Arbeit werden die wichtigsten Begriffe erklärt, die im Zusammenhang mit Werbetexten und Anglizismen eine Rolle spielen. Im zweiten, empirischen Teil werden dann verschiedene Werbetexte ausgewertet. Anschließend wird betrachtet, aus welchen Gründen englische Ausdrücke in den Einzelfällen verwendet werden und welche Wirkungen sie haben.
Im Laufe dieser Abhandlung soll gezeigt werden, inwiefern eine bestimmte Werbebotschaft mit Hilfe unterschiedlicher Sprachregister stilistisch realisiert und vor allem dem Rezipienten und bestenfalls künftigen Konsumenten vermittelt werden kann. Auf eine einführende Definition des Begriffs ,Werbung‘ folgt eine detaillierte Betrachtung des eigentlichen Analysegegenstandes – der Werbesprache.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Anglizismus
- Was ist ein Anglizismus?
- Entlehnungsformen
- Wirkung von Anglizismen und Gründe für ihren Einsatz
- Werbetexte
- Definition, Werbung
- Sprachliche Mittel in der Werbung
- Gestaltung und Funktion von Werbetexten
- Analyse ausgewählter Werbetexte
- Die Welt der Mode
- Kosmetik und Körperpflegeprodukte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Anglizismen in Werbetexten und untersucht deren Einsatz, Wirkung und Bedeutung in der heutigen deutschen Sprache. Ziel ist es, die Verwendung englischer Wörter im Kontext der Werbung zu analysieren und die Gründe für deren Popularität zu erforschen.
- Die Verbreitung und Entwicklung von Anglizismen in der deutschen Sprache
- Die Funktion und Wirkung von Anglizismen in Werbetexten
- Die sprachlichen Besonderheiten und Strategien der Werbesprache
- Die Rolle von Anglizismen in der Gestaltung von Markenidentitäten
- Die gesellschaftliche Relevanz von Anglizismen im Kontext der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Anglizismen in Werbetexten ein und beleuchtet die historische Entwicklung und die aktuelle Relevanz der Thematik. Im Kapitel "Begriffsklärung" werden die zentralen Begriffe "Anglizismus" und "Werbetext" definiert und die verschiedenen Formen der Entlehnung englischer Wörter in die deutsche Sprache erläutert.
Das Kapitel "Analyse ausgewählter Werbetexte" untersucht anhand verschiedener Beispiele, wie Anglizismen in unterschiedlichen Werbekontexten eingesetzt werden und welche Wirkung sie auf den Rezipienten haben. Abschließend wird im Fazit ein Resümee der Untersuchung gezogen und die Bedeutung der Ergebnisse für die zukünftige Forschung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Anglizismen, Werbetext, Werbesprache, Sprachwandel, Entlehnung, Sprachkontakt, Globalisierung, Markenidentität und Konsumgesellschaft. Die Untersuchung fokussiert auf die sprachlichen Besonderheiten der Werbesprache und analysiert die Verwendung von englischen Wörtern in Werbetexten.
Häufig gestellte Fragen
Warum werden Anglizismen in der deutschen Werbung so häufig genutzt?
Anglizismen werden eingesetzt, um Modernität, Internationalität und einen bestimmten Lebensstil (Kolorit) zu vermitteln.
In welchen Branchen ist der Gebrauch von Anglizismen besonders hoch?
Die Arbeit analysiert eine besonders starke Häufung in den Bereichen Mode, Kosmetik und Körperpflegeprodukte.
Verstehen Konsumenten englische Werbeslogans immer?
Die Untersuchung geht der Frage nach, ob englische Sprüche oft falsch verstanden werden und dadurch die Werbebotschaft ihr Ziel verfehlt.
Was sind die sprachlichen Merkmale der Werbesprache?
Die Werbesprache nutzt spezifische Sprachregister, rhetorische Mittel und Entlehnungen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und Markenidentitäten zu schaffen.
Gibt es eine negative Einstellung gegenüber Anglizismen in der Werbung?
Ja, die Arbeit untersucht, ob Teile der Bevölkerung durch die übertriebene Alltagspräsenz englischer Begriffe genervt sind.
- Arbeit zitieren
- Elisabeth Hartmann (Autor:in), 2013, Anglizismen in der Werbesprache. Analyse ausgewählter Werbetexte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322574