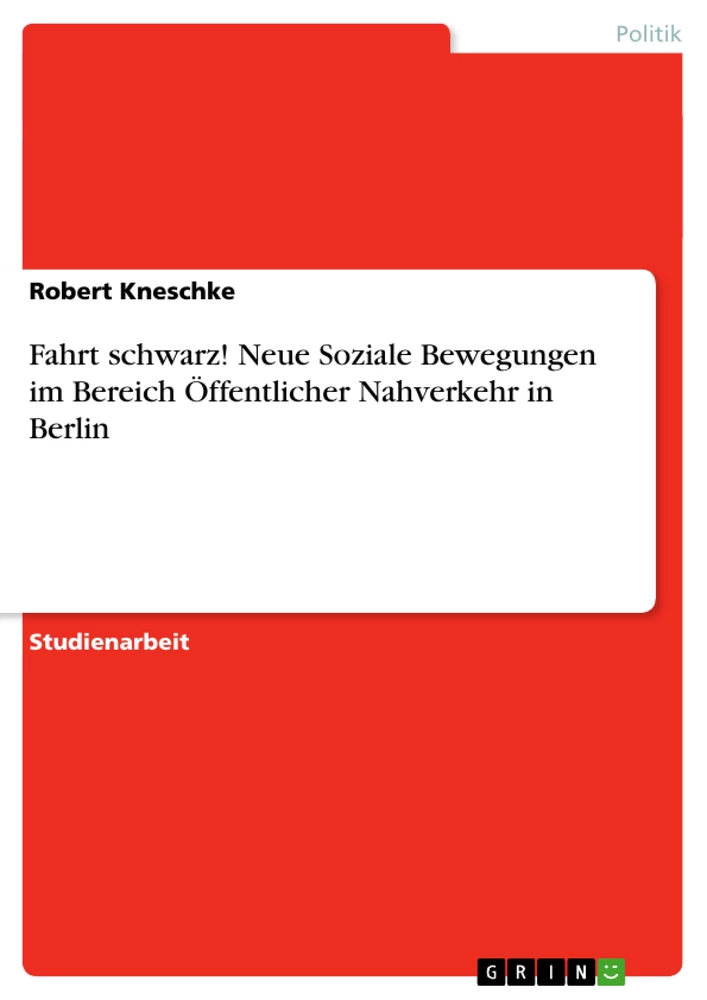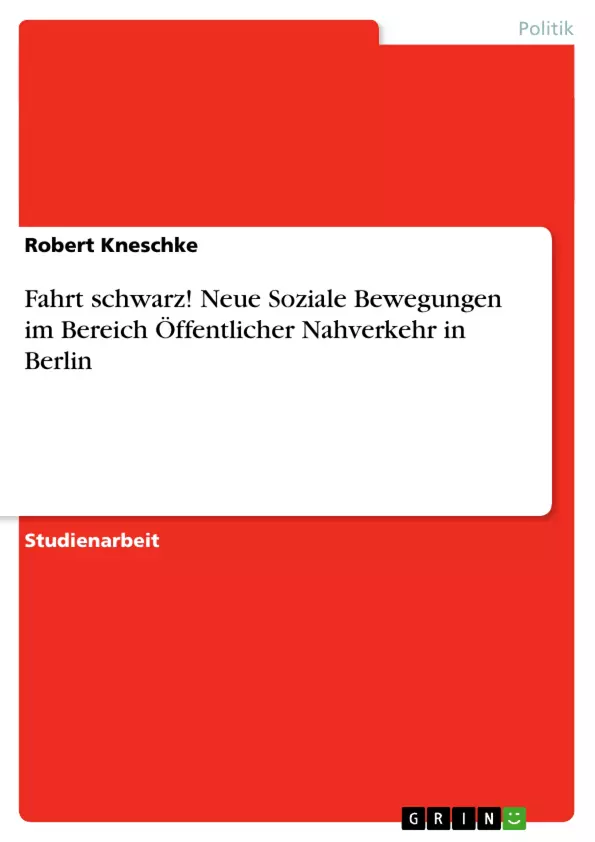Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG1) haben sich stark angestrengt, ihr Image in den letzten Monaten aufzupolieren: Das Sozialhilfeticket wurde abgeschafft, das Senioren- und Arbeitslosenticket ebenso. Der Einzelfahrschein gilt nur noch in eine statt beide Fahrtricht ungen, es häufen sich Beschwerden über rabiate, unfreundliche Ticketkontrolleure und das Semesterticket soll am besten ganz abgeschafft werden. Parallel dazu beherrschen die hohen Gehälter des BVG-Vorstands die Schlagzeilen der Stadt.
Doch der öffentliche Nahverkehr ist keine beliebige Ware, bei der die Kunden den Kauf verweigern können, wenn ihnen die Leistung nicht gefällt. Viele Berlinerinnen und Berliner sind auf die Transportmittel angewiesen. Ein Boykott als Protestmittel gegen zu hohe Fahrpreise, Abschaffung der Sozialtarife und Streckenstilllegungen fällt deshalb aus. Welche anderen Protestformen gewählt werden, wer diese Proteste organisiert und wie erfolgreich sie sind, sind die Fragen, die in dieser Arbeit beantwortet werden sollen.
Dazu wird diese Untersuchung dreigeteilt. Im ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen geschaffen. Es werden Begriffe definiert und Forschungsansätze vorgestellt, die für die Analyse "Neuer Sozialer Bewegungen" hilfreich sein können. Im nächsten Teil wird der geschichtliche Vorlauf bisheriger Proteste zum Thema beleuchtet. Das ist zum einen notwendig für die Beurteilung der Erfolgschancen der heutigen Protestbewegung, zum anderen kann dieser Bereich aber auch für sich stehen – als detaillierter Abriss bisheriger Aktionen. Im dritten Teil folgt eine Darstellung der aktuellen Bewegungen. Basierend auf den Erkenntnissen der ersten beiden Teile soll versucht werden, die Erfolgschancen der Proteste realistisch einzuschätzen.
1 Die Abkürzung BVG entstand dadurch, dass sich am 1. Januar 1929 die Gesellschaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin, die Allgemeine Berliner Omnibus-Actien-Gesellschaft (ABOAG) und die Berliner Straßenbahn-Betriebs-GmbH zur Berliner Verkehrs-AG (BVG) zusammenschlossen. Unter dem Namen "Berliner Verkehrsbetriebe" wurde der Zusammenschluss genau zehn Jahre später Eigenbetrieb des Landes Berlin. Auch wenn die BVG und die S-Bahn Berlin zwei unabhängige Unternehmen sind, werden sie in dieser Arbeit der besseren Lesbarkeit halber unter dem Kürzel BVG zusammengefasst. Das ist insofern legitim, weil beide Unternehmen ihre Tarife zusammen erheben und auch die Fahrkarten gegenseitig anerkennen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ansätze zur Bewegungsforschung
- 2.1 Definition NSB
- 2.2 Warum Berlin, warum ÖPNV
- 2.3 NSB-Theorien
- 3. Geschichte der Neuen Sozialen Bewegungen im Berliner Nahverkehr
- 3.1 Proteste zur Fahrpreiserhöhung am 1. März 1972
- 3.2 Proteste zur Fahrpreiserhöhung am 1. März 1976
- 3.3 Proteste zur Fahrpreiserhöhung am 1. August 1977
- 3.4 Proteste zu den Fahrpreiserhöhungen von 1979 bis 1989
- 3.5 Proteste zu den Fahrpreiserhöhungen von 1990 bis 1997
- 3.6 Proteste zu den Fahrpreiserhöhungen von 1998 bis 2003
- 4. Analyse der Proteste zu den Fahrpreiserhöhungen 2004
- 4.1 Ablauf der Proteste zu den Fahrpreiserhöhungen 2004
- 4.2 Analyse der Proteste zu den Fahrpreiserhöhungen 2004
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entstehung, Entwicklung und Erfolgschancen von neuen sozialen Bewegungen im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin, insbesondere im Kontext von Fahrpreiserhöhungen. Die Untersuchung befasst sich mit den aktuellen Protesten gegen die Fahrpreispolitik der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und stellt diese in den historischen Kontext bisheriger Proteste.
- Definition und Charakterisierung Neuer Sozialer Bewegungen
- Analyse des öffentlichen Nahverkehrs als Feld sozialer Bewegungen
- Historische Entwicklung von Protesten im Berliner Nahverkehr
- Theorien zur Entstehung und Dynamik von Sozialen Bewegungen
- Bewertung der Erfolgschancen aktueller Protestbewegungen im Berliner Nahverkehr
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Forschungsfrage und den Rahmen der Arbeit vor, während das zweite Kapitel verschiedene Ansätze zur Bewegungsforschung beleuchtet. Es werden Definitionen von Neuen Sozialen Bewegungen, Bürgerinitiativen und Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) erörtert, sowie verschiedene Theorien zur Erklärung von Entstehung, Entwicklung und Erfolg oder Misserfolg von sozialen Bewegungen vorgestellt.
Das dritte Kapitel zeichnet die Geschichte von Protesten im Berliner Nahverkehr nach und beleuchtet die wichtigsten Ereignisse und Bewegungen im Zeitraum von 1972 bis 2003. Es wird detailliert auf die verschiedenen Formen des Protests und die zentralen Anliegen der Aktivisten eingegangen.
Schlüsselwörter
Neue Soziale Bewegungen, öffentlicher Nahverkehr, Berlin, Fahrpreiserhöhungen, Protest, Bürgerinitiativen, Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), BVG, Sozialtarife, Erfolgschancen, Theorien zur Bewegungsforschung, Collective Identity, Framing, Resource Mobilization, Political Opportunity Structure.
Häufig gestellte Fragen
Warum kam es in Berlin zu verstärkten Protesten gegen die BVG?
Anlass waren die Abschaffung von Sozialtarifen (z. B. für Senioren und Arbeitslose), Fahrpreiserhöhungen und Beschwerden über unfreundliche Kontrollen bei gleichzeitig hohen Vorstandsgehältern.
Was sind „Neue Soziale Bewegungen“ (NSB) im Kontext des Nahverkehrs?
Es handelt sich um organisierte Protestformen von Bürgern, die sich gegen soziale Ungerechtigkeit im ÖPNV wehren, wobei Theorien wie Ressourcenmobilisierung und politische Gelegenheitsstrukturen zur Analyse genutzt werden.
Warum ist ein Boykott der BVG als Protestmittel schwierig?
Der öffentliche Nahverkehr ist keine beliebige Ware; viele Menschen sind existenziell darauf angewiesen und können den Kauf eines Tickets nicht einfach verweigern.
Welche historischen Protestwellen gab es im Berliner Nahverkehr?
Die Arbeit dokumentiert detailliert Proteste gegen Fahrpreiserhöhungen in den Jahren 1972, 1976, 1977 sowie kontinuierliche Aktionen bis 2004.
Welche Erfolgschancen haben die aktuellen Protestbewegungen?
Die Arbeit versucht eine realistische Einschätzung basierend auf historischen Vorläufern und der Fähigkeit der Bewegungen, eine kollektive Identität zu schaffen.
- Quote paper
- Dipl. pol. Robert Kneschke (Author), 2004, Fahrt schwarz! Neue Soziale Bewegungen im Bereich Öffentlicher Nahverkehr in Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32258