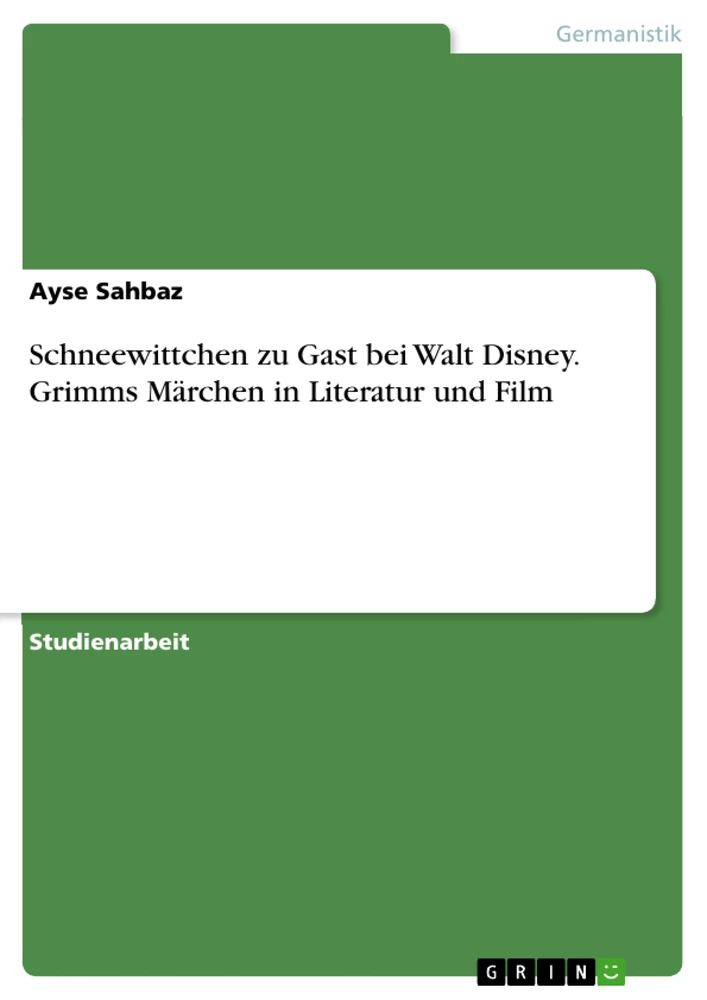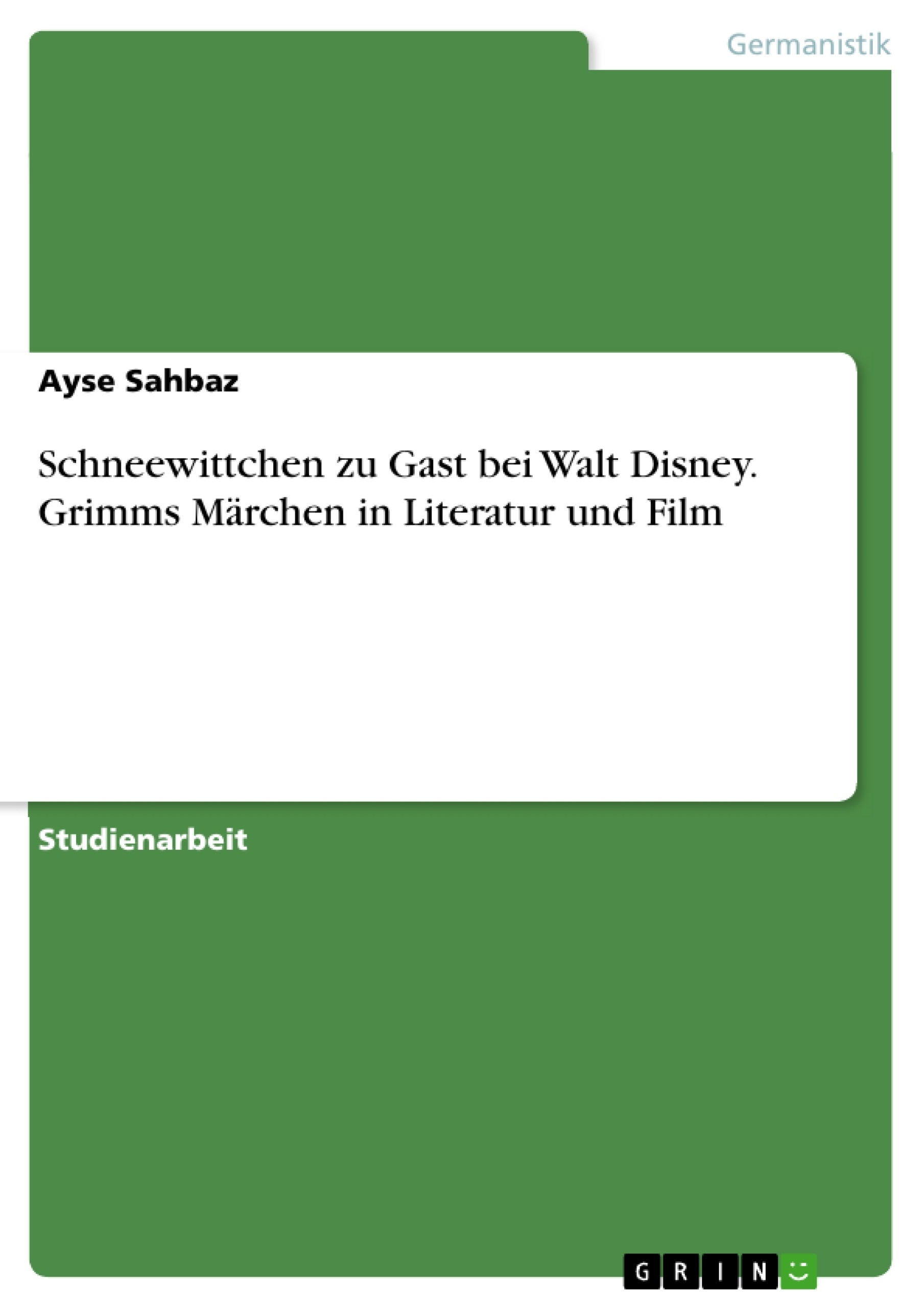Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst der Begriff des Märchens näher erläutert. Es wird darauf eingegangen, woher es stammt und was ihre Stilmerkmale nach Lüthi sind. Der zweite Teil der Arbeit legt seinen Fokus auf ein spezifisches Märchen, nämlich "Schneewittchen und die sieben Zwerge". Diese Erzählung wird anhand von zwei Medien illustriert, dem Originaltext von den Brüdern Grimm und der ersten Verfilmung von Walt Disney. Es entsteht ein exemplarischer Vergleich mit Hinblick auf den Inhalt, die Charaktere und die Einhaltung der typischen Stilmerkmale nach Lüthi. Hierbei geht es im Wesentlichen um die Frage, ob es möglich ist, den Originaltext in ein anderes Medium zu überführen, ohne, dass die für ein Märchen typischen Kriterien verloren gehen. Es wird also untersucht, ob es World Disney gelungen ist, das Märchen so zu transportieren, dass es immer noch als Märchen kategorisiert werden kann.
Märchen – jeder kennt sie, doch die Meinungen der Menschen bezüglich dieser sind stark umstritten. Viele sind davon überzeugt, dass Märchen ein zentrales Kulturgut unserer Gesellschaft darstellen und unbedingt auch heutzutage noch gelesen werden müssen. Sie vertreten die Meinung, dass Märchen aufgrund ihrer Thematik eine gewisse Lebensweisheit widerspiegeln. Dass in den Märchen oftmals das Gute am Ende als Sieger herauskristallisiert wird, gebe einem Menschen in diesem Leben Hoffnung und Mut. Zudem sind viele Menschen fasziniert davon, dass man beim Lesen eines Märchens – in einer Zeit wo einem jegliche Phantasie geraubt wird und man nur der trockenen Realität ausgesetzt ist – in eine zauberhafte, große Phantasiewelt eintauchen kann.
Andere jedoch setzten sich ganz anders mit dem Thema Märchen auseinander. Sie sind vielmehr der Meinung, dass Märchen nicht mehr zeitgerecht, sondern antiquiert sind und aufgrund der irrealen Handlungen, Charaktere, Orte etc. keinesfalls die Realität widerspiegeln können.
Zwar sieht man, dass es unter der Bevölkerung schwierig ist, sich einig zu werden, doch trotzdem gelten Märchen als einer der ältesten literarischen Formen und scheinen unersetzbar zu sein. Zur großen Liste aller Märchen werden immer mehr hinzugefügt – das Aussterben ist also noch lange nicht in Sicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitendes Wort
- Begriffsdefinition Märchen
- Herkunft des Volksmärchens
- Stilmerkmale des Volksmärchens nach Max Lüthi
- Eindimensionalität
- Flächenhaftigkeit
- Abstrakter Stil
- Isolation und Allverbundenheit
- Sublimation und Welthaltigkeit
- Einführung in die konkrete Fragestellung
- Grimms „Schneewittchen und die Sieben Zwerge“
- Walt Disneys erste Verfilmung von Schneewittchen
- Exemplarischer Vergleich
- Inhalt
- Charaktere
- Einhaltung der Stilmerkmale nach Lüthi
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Adaption des Grimmschen Märchens "Schneewittchen" durch Walt Disney. Ziel ist es, einen exemplarischen Vergleich zwischen dem Originaltext und der Disney-Verfilmung durchzuführen und zu analysieren, inwieweit die typischen Stilmerkmale des Volksmärchens nach Max Lüthi in der Adaption erhalten geblieben sind. Die Arbeit fragt danach, ob die Übertragung in ein anderes Medium gelingt, ohne die märchentypischen Kriterien zu verlieren.
- Definition und Herkunft des Volksmärchens
- Stilmerkmale des Märchens nach Max Lüthi
- Inhaltliche und charakterliche Unterschiede zwischen Grimms "Schneewittchen" und der Disney-Version
- Analyse der Einhaltung der Lüthischen Stilmerkmale in der Disney-Adaption
- Die Frage nach der Übertragbarkeit des Märchens in verschiedene Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitendes Wort: Die Einleitung diskutiert die gegensätzlichen Perspektiven auf Märchen in der heutigen Gesellschaft. Während einige ihre Bedeutung als Kulturgut und Quelle der Lebensweisheit betonen, sehen andere sie als antiquiert und unrealistisch an. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit der Definition von Märchen, der Analyse von Grimms "Schneewittchen" und dessen Disney-Adaption sowie einem Vergleich beider Versionen befasst.
Begriffsdefinition Märchen: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Wortes "Märchen", seine sprachliche Herkunft und seine stilistischen Merkmale nach Max Lüthi. Es unterscheidet zwischen Volks- und Kunstmärchen und erläutert die typischen Elemente von Volksmärchen, wie phantastische Wesen, übernatürliche Kräfte, die Dreiteiligkeit der Handlung (Mangel, Abenteuer, Sieg), den Verzicht auf genaue Orts- und Zeitangaben und die einfache Sprache. Die Kapitel behandelt auch den Aspekt der Moral in Märchen und widerlegt das weitverbreitete Vorurteil, dass Märchen primär für Kinder gedacht seien.
Herkunft des Volksmärchens: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Brüder Grimm als bedeutende Sammler und Herausgeber von Märchen. Es beschreibt die Herausforderungen bei der Etablierung der Märchen als eigenständige literarische Gattung und hebt die Bedeutung der Grimmschen Arbeit bei der Abgrenzung von Märchen zu anderen Gattungen wie Sagen hervor. Es wird deutlich gemacht, dass die klare Definition der Gattungsmerkmale im Laufe der Zeit erst herausgearbeitet wurde.
Schlüsselwörter
Märchen, Volksmärchen, Grimms Märchen, Schneewittchen, Walt Disney, Max Lüthi, Stilmerkmale, Adaption, Vergleich, Medienübertragung, Kulturgut.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Vergleich von Grimms "Schneewittchen" und Disneys Verfilmung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Adaption des Grimmschen Märchens "Schneewittchen" durch Walt Disney. Im Mittelpunkt steht ein exemplarischer Vergleich zwischen dem Originaltext und der Disney-Verfilmung, um zu analysieren, inwieweit die typischen Stilmerkmale des Volksmärchens nach Max Lüthi in der Adaption erhalten geblieben sind. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Übertragung in ein anderes Medium gelingt, ohne die märchentypischen Kriterien zu verlieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Definition und Herkunft des Volksmärchens, Stilmerkmale des Märchens nach Max Lüthi, inhaltliche und charakterliche Unterschiede zwischen Grimms "Schneewittchen" und der Disney-Version, Analyse der Einhaltung der Lüthischen Stilmerkmale in der Disney-Adaption und die Frage nach der Übertragbarkeit des Märchens in verschiedene Medien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsdefinition "Märchen" (inkl. Herkunft und Stilmerkmalen nach Max Lüthi), eine Einführung in die konkrete Fragestellung (Grimms "Schneewittchen" und Disneys Verfilmung), einen exemplarischen Vergleich beider Versionen (Inhalt, Charaktere, Einhaltung der Stilmerkmale nach Lüthi) und ein Fazit. Die Einleitung diskutiert gegensätzliche Perspektiven auf Märchen in der heutigen Gesellschaft.
Welche Stilmerkmale nach Max Lüthi werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Stilmerkmale des Volksmärchens nach Max Lüthi, darunter Eindimensionalität, Flächenhaftigkeit, abstrakter Stil, Isolation und Allverbundenheit sowie Sublimation und Welthaltigkeit. Es wird untersucht, wie diese Merkmale in der Disney-Adaption umgesetzt oder verändert wurden.
Welche Aspekte des Vergleichs zwischen Grimms "Schneewittchen" und der Disney-Version werden untersucht?
Der Vergleich umfasst die Inhaltsanalyse, den Vergleich der Charaktere und die Analyse, inwieweit die Stilmerkmale nach Max Lüthi in der Disney-Verfilmung erhalten geblieben sind. Es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen beiden Versionen herausgearbeitet.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit im gegebenen Text zusammengefasst. Es würde die Ergebnisse des Vergleichs zusammenfassen und eine Schlussfolgerung zur Übertragbarkeit von Märchen in verschiedene Medien ziehen.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Märchen, Volksmärchen, Grimms Märchen, Schneewittchen, Walt Disney, Max Lüthi, Stilmerkmale, Adaption, Vergleich, Medienübertragung, Kulturgut.
Welche Bedeutung haben die Brüder Grimm im Kontext dieser Arbeit?
Die Brüder Grimm werden als bedeutende Sammler und Herausgeber von Märchen behandelt. Die Arbeit beleuchtet ihre Rolle bei der Etablierung der Märchen als eigenständige literarische Gattung und die Herausforderungen bei der Abgrenzung von Märchen zu anderen Gattungen wie Sagen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für Märchenforschung, Medienadaptionen und die Analyse literarischer Stilmerkmale interessiert.
- Citar trabajo
- Ayse Sahbaz (Autor), 2015, Schneewittchen zu Gast bei Walt Disney. Grimms Märchen in Literatur und Film, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322788