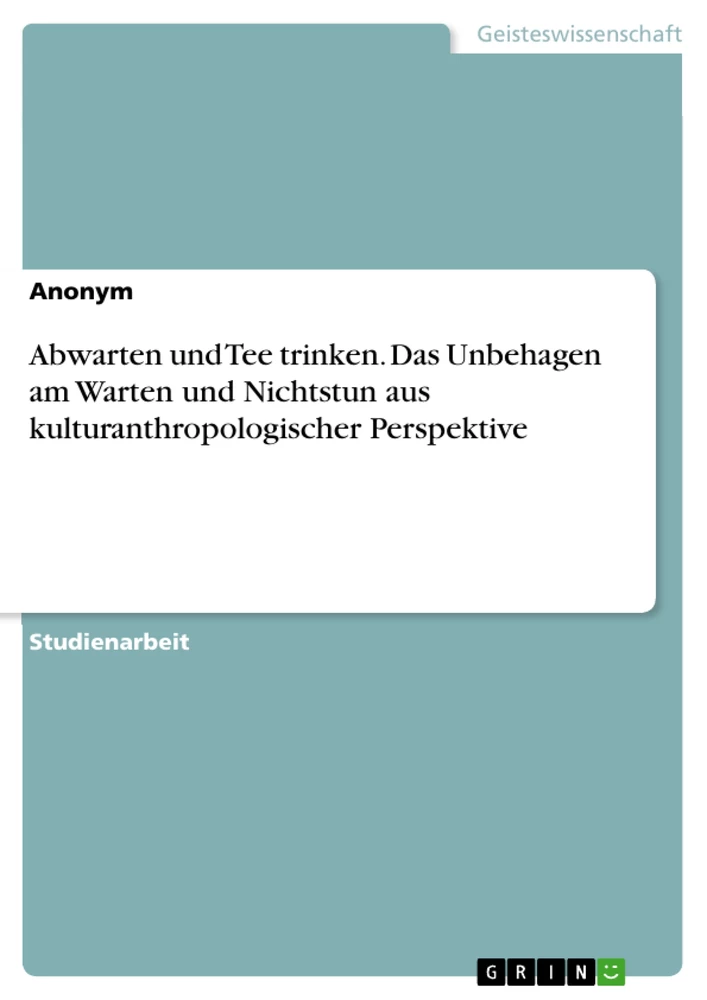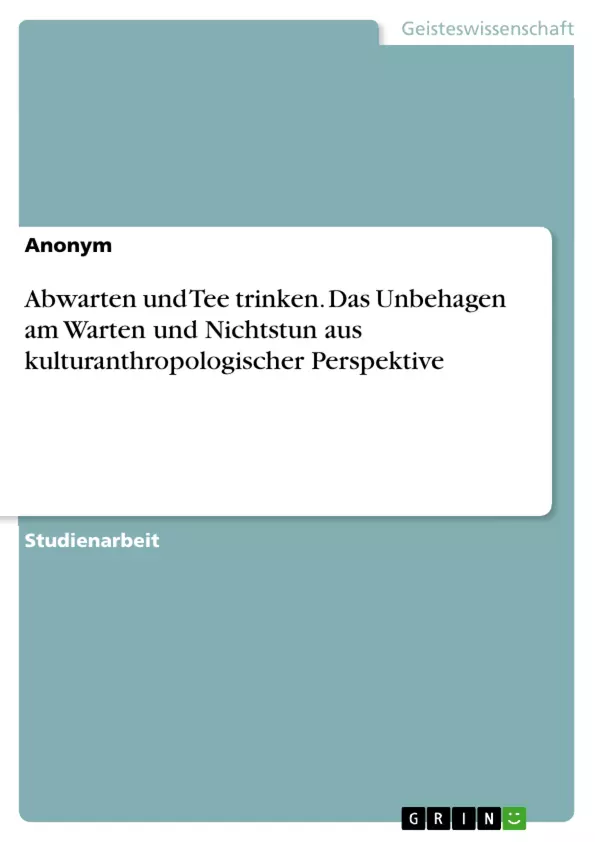Wir tun es jeden Tag. Sei es in der Warteschlange im Supermarkt, im Stau an der roten Ampel oder auch in der Arbeit, wenn wir die baldige Kaffeepause oder den Feierabend herbeisehnen. Jeder von uns sieht sich in seinem Leben – ob freiwillig oder nicht ganz so freiwillig – wiederholt damit konfrontiert, warten zu müssen. So warten wir als Kind ungeduldig auf das Christkind, als Teenager auf die Volljährigkeit und später, während der Schwangerschaft, auf die Geburt unseres Kindes. Ein Häftling indes zählt die Tage bis zu seiner Entlassung, während ein Flüchtling die Antwort auf seinen Asylantrag abwarten muss und wieder andere verzweifelt auf der Intensivstation zu warten haben, ehe sie endlich über den Zustand ihres Angehörigen informiert werden.
Wie diese Beispiele zeigen, umfasst das Warten ein sehr breites Spektrum an Verhaltensweisen und Gefühlsreaktionen. Wartezeit kann kurz sein, sich aber auch endlos an-fühlen oder gar ein ganzes Leben andauern, während sich ihre Gestalt, Ausrichtung und Bedeutung stets verändern. Das Warten muss jeder von uns erlernen, wobei sich die Art und Weise des Wartens, ebenso wie die Gründe dafür, je nachdem, wo auf der Erde man aufwächst, erheblich unterscheiden können.
In der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, anhand der Betrachtung profaner Situationen des Wartens, also auf den ersten Blick trivialer »Nichtereignisse«, unter die Oberfläche dieser scheinbar bedeutungslosen und inaktiven Betätigung zu blicken.3 Die Betrachtungen basieren dabei auf der Annahme, dass man selbst dann, wenn man vergeblich wartet, zumindest doch irgendetwas tut.
Die Autoren Ehn und Löfgren untersuchen in ihrem Werk »Nichtstun. Eine Kulturanalyse des Ereignislosen und Flüchtigen«, auf dem die Betrachtungen des vorliegenden Aufsatzes in erster Linie basieren, recht triviale Beschäftigungen wie das Warten auf den Bus oder das Schlangestehen in Geschäften. Um der Frage nachzugehen, welche Form von »Nichtstun« wir überhaupt als Warten bezeichnen, setzen Ehn und Löfgren bei der konkreten Infrastruktur, also den Orten des Wartens, an, um daraufhin die Natur der Wartezeit zu betrachten. Auf dieser Basis soll – anhand theoretischer Betrachtungen sowie einer kleinen empirischen Untersuchung – in dieser Arbeit gefragt werden, wie Menschen Wartezeiten warum erleben, wie sie mit ihr umgehen und sie gestalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Hintergründe
- Die »Protestantische Ethik«
- Das Unbehagen am Warten
- Dimensionen des Wartens
- Orte des Wartens
- Wie wird Wartezeit gestaltet?
- Gefühle, die das Warten prägen
- Zeitverschwendung
- Langeweile
- Soziale Interaktion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Wartens im Alltag und untersucht, wie Menschen Wartezeiten erleben, gestalten und mit ihnen umgehen. Sie beleuchtet die kulturellen, sozialen und psychologischen Aspekte des Wartens und hinterfragt die Bedeutung des »Nichtstuns« in einer beschleunigten Welt.
- Kulturelle Praxis des Wartens
- Das Unbehagen am Warten in der modernen Gesellschaft
- Die Rolle der »protestantischen Ethik« im Kontext des Wartens
- Gestaltung von Wartezeiten
- Soziale Interaktion im Kontext des Wartens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Wartens ein und beschreibt die Relevanz des Themas in verschiedenen Lebensbereichen.
Das Kapitel »Theoretische Hintergründe« beleuchtet die »protestantische Ethik« und deren Einfluss auf die Wahrnehmung von Zeit und Arbeit. Es wird gezeigt, wie die protestantische Ethik zu einer negativen Bewertung von »Nichtstun« und Wartezeiten beitragen kann.
Das Kapitel »Dimensionen des Wartens« widmet sich den verschiedenen Aspekten des Wartens, wie z.B. den Orten des Wartens, der Gestaltung von Wartezeiten, den Gefühlen, die das Warten prägen, und der Rolle der sozialen Interaktion im Kontext des Wartens.
Schlüsselwörter
Warten, Nichtstun, Protestantische Ethik, Zeitverschwendung, Langeweile, Soziale Interaktion, Beschleunigung, Kultur, Lebenswelt.
Häufig gestellte Fragen
Warum empfinden viele Menschen Warten als unangenehm?
Das Unbehagen am Warten ist oft kulturell bedingt. In einer beschleunigten Gesellschaft wird Warten häufig als Zeitverschwendung oder "Nichtstun" wahrgenommen, was im Widerspruch zu modernen Leistungsidealen steht.
Welchen Einfluss hat die "protestantische Ethik" auf das Warten?
Die protestantische Ethik bewertet Arbeit und Zeitnutzung moralisch hoch. Dies führt dazu, dass Inaktivität oder erzwungene Pausen als negativ oder sündhaft empfunden werden können.
Wie gestalten Menschen ihre Wartezeit?
Wartezeit wird oft durch "Lückenfüller" gestaltet, wie z.B. die Nutzung des Smartphones, Beobachtung der Umgebung oder soziale Interaktion mit anderen Wartenden.
Gibt es positive Aspekte des Wartens?
Aus kulturanthropologischer Sicht kann Warten auch als Raum für Reflexion, Tagträume oder unerwartete Begegnungen dienen, wenn man den Druck der ständigen Produktivität ablegt.
Sind Orte des Wartens (Warteräume) bedeutungslos?
Nein, Orte wie Bushaltestellen oder Wartezimmer haben eine spezifische Infrastruktur, die das Verhalten und die Gefühle der Menschen maßgeblich beeinflusst.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Abwarten und Tee trinken. Das Unbehagen am Warten und Nichtstun aus kulturanthropologischer Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322810