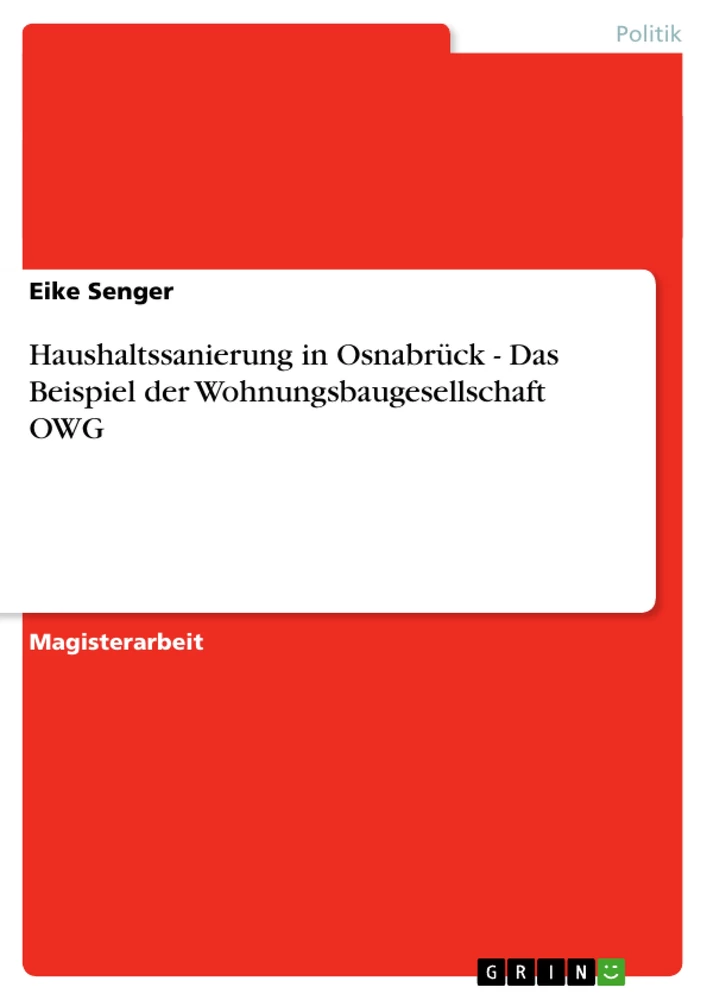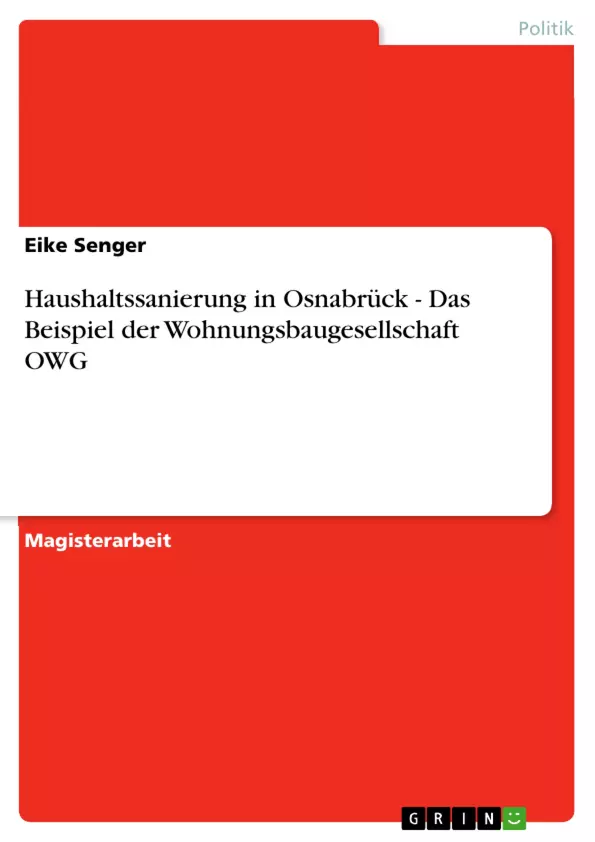Die Stadt Osnabrück versuchte im Jahr 2001 den mit über 200 Mio. € verschuldeten Haushalt durch den Verkauf der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft zu entlasten. Auf diesem Wege sollte der Schuldenstand reduziert und die laufenden Zinslasten gesenkt werden. Am 20. November 2001 beschloss die Ratsmehrheit aus CDU & FDP die Verwaltung zu beauftragen den Verkauf der städtischen Gesellschaft zu prüfen und Rahmenbedingungen auszuarbeiten. Dies stieß unmittelbar auf den Widerstand der Opposition aus SPD und den Grünen. Die Gegnerschaft erweiterte sich im Verlauf noch um eine Bürgerinitiative aus Gewerkschaftern und Globalisierungsgegnern, welche den Verkauf vehement ablehnten.
Der Hauptkritikpunkt bestand in der Vermutung der Verkauf würde massive soziale Auswirkungen auf die Mieterschaft der OWG haben. Außerdem würde die Stadt durch einen Verkauf die notwendige Flexibilität zur Unterbringung sozial Schwacher Personen verlieren.
Aus Sicht der Mehrheitsgruppe im Rat könne der Verkauf jedoch dazu beitragen den Haushalt deutlich zu entlasten und die laufenden Zinsleistungen zurückzuführen. Auch unter Würdigung aller sozialen Aspekte, sei ein Verkauf durchaus sinnvoll und zweckgemäß.
Die vorliegende Arbeit untersucht den Verkauf der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft. Dabei soll primär die Frage beantwortet werden, ob der Verkauf sozial ausgewogen war und durch den Erlös der Haushalt entlastet werden konnte
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problem- und Fragestellung
- Literatur und Quellenlage
- Aufbau und Methodik der Arbeit
- Finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen
- Einnahme- und Ausgabeposten der Kommunen
- Die wirtschaftliche Situation der Kommunen
- Ansätze zur Entlastung der kommunalen Gebietskörperschaften
- Privatisierungsmaßnahmen als finanzpolitisches Instrument
- Ordnungspolitische Voraussetzungen
- Existenz eines Privatisierungspotenzials
- Verwendungszweck der Privatisierungserlöse
- Schuldentilgung
- Investitionsfinanzierung
- Konsumausgaben
- Nachhaltigkeit
- Argumente für die staatliche Daseinsvorsorge
- Privatisierungshemmnisse
- Der Verkauf der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft
- Besonderheiten auf Wohnungsmärkten
- Die OWG und die Norddeutsche Landesentwicklungsgesellschaft
- Entstehung der OWG
- Ziele und Aufgaben der OWG
- Verkauf der OWG an die NILEG
- Gründe für die Veräußerung der OWG
- Erfüllung des Gründungszwecks
- OWG überschreitet den Bereich staatlicher „Daseinsvorsorge”
- Entlastung des städtischen Haushalts
- Kritik an der Veräußerung der OWG
- Verlust eines wichtigen wohnungsmarktpolitischen Instruments
- Anstieg des Mietpreisspiegels
- Einsparungen Instandhaltung und Modernisierung
- Auftragsrückgang im Handwerk
- Auftragsrückgang im Baustoffeinzelhandel
- Haushaltsbelastung durch steigende Wohn- und Mietkostenzuschüsse
- Kritik an den Sozialklauseln
- Mieterschutz
- Kündigungsschutz
- Begrenzung der Mieterhöhungen
- Arbeitnehmerschutz
- Kündigungsschutz
- Zusätzliche Altersvorsorge
- Geringer Verkaufspreis
- Die Veräußerung städtischen Wohnraums, ein Sanierungskonzept für kommunale Haushalte?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Privatisierung der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft (OWG) im Kontext der kommunalen Haushaltssanierung. Ziel ist es, die finanzwirtschaftlichen Hintergründe, die Argumente für und gegen die Privatisierung sowie die Folgen für den Wohnungsmarkt und die Stadt Osnabrück zu analysieren.
- Finanzielle Situation der Kommunen und Möglichkeiten der Haushaltssanierung
- Privatisierung als Instrument der Haushaltssanierung
- Folgen der Privatisierung der OWG für den Osnabrücker Wohnungsmarkt
- Bewertung der Sozialklauseln im Rahmen des Privatisierungsprozesses
- Langfristige Auswirkungen der Privatisierung auf die Stadt Osnabrück
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problem- und Fragestellung der Arbeit, die sich mit der Privatisierung der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft (OWG) im Rahmen kommunaler Haushaltssanierung befasst. Sie skizziert den Aufbau und die Methodik der Arbeit, inklusive der verwendeten Literatur und Quellen. Die Einleitung legt den Fokus auf die komplexen Zusammenhänge zwischen finanziellen Zwängen, wohnungspolitischen Zielen und den sozialen Folgen der Privatisierung.
Finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen: Dieses Kapitel analysiert die Einnahme- und Ausgabeposten der Kommunen, beleuchtet deren wirtschaftliche Lage und untersucht verschiedene Ansätze zur Entlastung der kommunalen Haushalte. Es liefert den notwendigen Kontext für die anschließende Betrachtung der Privatisierung der OWG, indem es die finanziellen Herausforderungen der Stadt Osnabrück verdeutlicht und die Privatisierung als eine mögliche Lösung in diesem Kontext einordnet.
Privatisierungsmaßnahmen als finanzpolitisches Instrument: Dieses Kapitel erörtert die ordnungspolitischen Voraussetzungen für Privatisierungen, einschließlich der Beurteilung des Privatisierungspotenzials, der Verwendung der Erlöse (Schuldentilgung, Investitionen, Konsum) und der Frage der Nachhaltigkeit. Es werden außerdem Argumente für die staatliche Daseinsvorsorge und Hemmnisse für Privatisierungen diskutiert. Der Abschnitt bietet einen theoretischen Rahmen für die anschließende Fallstudie der OWG-Privatisierung, indem er die verschiedenen Perspektiven und potenziellen Auswirkungen solcher Maßnahmen beleuchtet.
Der Verkauf der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft: Dieses Kapitel steht im Mittelpunkt der Arbeit und analysiert detailliert den Verkauf der OWG an die NILEG. Es untersucht die Besonderheiten des Osnabrücker Wohnungsmarktes, die Geschichte und die Ziele der OWG, die Gründe für die Veräußerung (Erfüllung des Gründungszwecks, Überschreitung der Daseinsvorsorge, Haushaltsentlastung) sowie die Kritik an der Privatisierung (Verlust wohnungspolitischer Instrumente, Mietpreissteigerungen, Einsparungen bei Instandhaltung, Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, Kritik an den Sozialklauseln und der Höhe des Verkaufspreises). Das Kapitel bietet eine tiefgehende Analyse des komplexen Entscheidungsprozesses und seiner Konsequenzen.
Die Veräußerung städtischen Wohnraums, ein Sanierungskonzept für kommunale Haushalte?: Dieses Kapitel bewertet den Verkauf der OWG als Sanierungskonzept und zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse. Es untersucht, inwieweit die Privatisierung als Modell für andere Kommunen dienen kann. Dabei wird die Nachhaltigkeit der gewählten Lösung und deren mögliche langfristige Auswirkungen auf die Stadtentwicklung kritisch hinterfragt.
Schlüsselwörter
Kommunale Haushaltssanierung, Privatisierung, Wohnungsbaugesellschaft, OWG, NILEG, Osnabrück, Wohnungsmarkt, Mietpreisspiegel, Sozialklauseln, Daseinsvorsorge, Finanzpolitik.
Häufig gestellte Fragen zur Privatisierung der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft (OWG)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Privatisierung der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft (OWG) im Kontext der kommunalen Haushaltssanierung. Sie untersucht die finanzwirtschaftlichen Hintergründe, Argumente für und gegen die Privatisierung sowie die Folgen für den Wohnungsmarkt und die Stadt Osnabrück.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die finanzielle Situation der Kommunen, Privatisierung als Instrument der Haushaltssanierung, die Folgen der OWG-Privatisierung für den Osnabrücker Wohnungsmarkt, die Bewertung der Sozialklauseln im Privatisierungsprozess und die langfristigen Auswirkungen auf Osnabrück. Sie analysiert detailliert den Verkauf der OWG an die NILEG, inklusive der Besonderheiten des Osnabrücker Wohnungsmarktes, der Geschichte und Ziele der OWG, der Gründe für die Veräußerung und der Kritikpunkte daran.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur finanzwirtschaftlichen Situation der Kommunen, ein Kapitel zu Privatisierungsmaßnahmen als finanzpolitisches Instrument, ein Kapitel zum Verkauf der OWG und abschließend ein Kapitel, das die Veräußerung städtischen Wohnraums als Sanierungskonzept bewertet.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse des OWG-Verkaufs?
Die Analyse des OWG-Verkaufs untersucht die Gründe für die Veräußerung (Erfüllung des Gründungszwecks, Überschreitung des Bereichs staatlicher Daseinsvorsorge, Haushaltsentlastung) und die Kritikpunkte daran (Verlust wohnungspolitischer Instrumente, mögliche Mietpreissteigerungen, Einsparungen bei Instandhaltung, Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, Kritik an den Sozialklauseln und der Höhe des Verkaufspreises).
Welche Kritikpunkte werden an der Privatisierung der OWG geäußert?
Die Kritikpunkte an der Privatisierung umfassen den Verlust eines wichtigen wohnungsmarktpolitischen Instruments, einen möglichen Anstieg des Mietpreisspiegels, Einsparungen bei Instandhaltung und Modernisierung mit Auswirkungen auf Handwerk und Baustoffeinzelhandel, eine mögliche Haushaltsbelastung durch steigende Wohn- und Mietkostenzuschüsse sowie Kritik an den Sozialklauseln (Mieterschutz, Arbeitnehmerschutz) und dem geringen Verkaufspreis.
Kann der Verkauf der OWG als Sanierungskonzept für andere Kommunen dienen?
Das abschließende Kapitel bewertet den Verkauf der OWG kritisch als Sanierungskonzept und untersucht, inwieweit er als Modell für andere Kommunen dienen kann, unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und langfristiger Auswirkungen auf die Stadtentwicklung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kommunale Haushaltssanierung, Privatisierung, Wohnungsbaugesellschaft, OWG, NILEG, Osnabrück, Wohnungsmarkt, Mietpreisspiegel, Sozialklauseln, Daseinsvorsorge, Finanzpolitik.
Wo finde ich mehr Informationen zur Methodik der Arbeit?
Die Einleitung beschreibt den Aufbau und die Methodik der Arbeit, inklusive der verwendeten Literatur und Quellen.
Welche finanziellen Aspekte werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Einnahme- und Ausgabeposten der Kommunen, beleuchtet deren wirtschaftliche Lage und untersucht verschiedene Ansätze zur Entlastung der kommunalen Haushalte. Sie betrachtet die Verwendung der Privatisierungserlöse (Schuldentilgung, Investitionen, Konsum) und die Frage der Nachhaltigkeit.
Welche Rolle spielt die Daseinsvorsorge in der Arbeit?
Die Arbeit diskutiert Argumente für die staatliche Daseinsvorsorge und Hemmnisse für Privatisierungen im Kontext der OWG-Privatisierung.
- Citar trabajo
- M.A. Eike Senger (Autor), 2004, Haushaltssanierung in Osnabrück - Das Beispiel der Wohnungsbaugesellschaft OWG, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32282