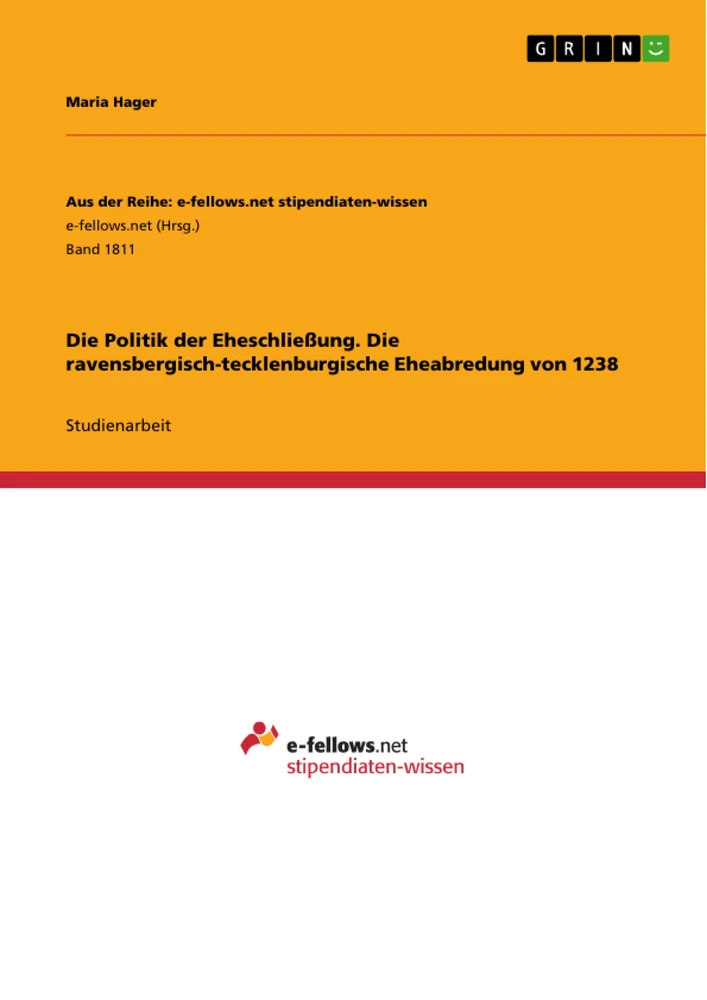In der mittelalterlichen Gesellschaft war Herrschaft vorrangig an Personen geknüpft und drückte sich im Zusammenspiel personaler Beziehungsnetze aus. In diesem Gefüge, in dem die Qualität von Personen und die Qualität ihrer Beziehungen untereinander das Funktionieren – oder auch das Versagen – von Herrschaft entschieden, war es symptomatisch, dass politische Bündnisse ihren Niederschlag auch in persönlichen Verbindungen fanden. Unter solchen Voraussetzungen konnten Verträge und Vereinbarungen kaum wirksamer verankert werden als durch Heiraten; denn Ehebindungen, die ja vom Grundsatz her unauflöslich waren, stellten ein ideales Mittel dar, um einer Übereinkunft Bestand zu verleihen. Die herausragende Rolle politischer Motive bei der Wahl fürstlicher Ehepartner ist daher nicht zu verkennen, was freilich nicht weiter verwundert, denn fürstliche Heiraten waren per se politischer Natur.
Während man sich bis etwa in das 12. Jahrhundert hinein mit mündlichen Heiratsabsprachen begnügte, führten sicherlich die politische Relevanz und die güterrechtliche Komplexität von Adelsheiraten dazu, dass in diesem Milieu zu Beginn des 13. Jahrhunderts die ersten Eheverträge auftauchten. Bei der ravensbergisch-tecklenburgischen Eheabredung aus dem Jahre 1238, die in der vorliegenden Arbeit genauer betrachtet werden soll, handelte es sich um einen der ersten überlieferten Eheverträge.
Bei der Interpretation einer Heiratsurkunde reicht es jedoch nicht aus, sich nur auf den Inhalt, welcher vor allem die güterrechtlichen Regelungen bezüglich der geplanten Ehe enthält, zu beschränken. Vielmehr muss versucht werden, die Urkunde zu ihrer Umwelt in Bezug zu setzen. Da gerade die Eltern die Auswahl der Ehepartner ihrer Kinder trafen und zu diesem Zwecke Verträge miteinander schlossen, erweisen sich Fragen, wie wer wen zu welchem Zeitpunkt, aus welchem Grund, unter welchen Umständen und mit welchen Folgen heiraten sollte, von großer Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Aufbau der Urkunde
- Ausstellungsabsichten der Heiratsurkunde
- Wiederherstellung einer allgemeinen Übereinkunft durch eine ,,Rekonziliationsheirat"
- Unterstützung Ottos II. von Ravensberg durch die Tecklenburger im Bruderzwist
- Schaffung eines Großterritoriums
- Sicherung der Herrschaft durch Nachkommen
- Güterrechtliche Regelung
- Überreichung der Heimsteuer als zentrale Frauengabe
- Widerlegung, Morgengabe und Wittumsbestellung als Gaben der Mannesseite
- Festsetzung des väterlichen Erbes
- Zusammenfassung der Versorgungsregelungen hinsichtlich ihrer politischen Motive
- Bedeutung der Heiratsurkunde in Hinblick auf den nachfolgenden Ehevollzug
- Vorkehrungen für mögliche Eventualfälle
- Stärkung der schriftlichen Fixierung durch Bürgen und durch den Treueeid beiderseitiger Ministerialen
- Festsetzung des Ehevollzuges auf das frühestmögliche Datum
- Ausblick auf die dem Ehevertrag folgenden Jahre
- Auseinandersetzung mit Ludwig von Ravensberg
- Tod des Grafen Heinrich III. von Tecklenburg
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Heiratsurkunde zwischen Heinrich, Graf von Tecklenburg, und Jutta, Gräfin von Ravensberg, aus dem Jahr 1238. Die Untersuchung zielt darauf ab, die politischen und güterrechtlichen Hintergründe der Ehevereinbarung aufzudecken und die Rolle der Urkunde im Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft zu beleuchten. Die Arbeit untersucht insbesondere, wie diese Ehe die Beziehungen zwischen den Tecklenburg und Ravensbergern beeinflusste, welche güterrechtlichen Regelungen getroffen wurden und inwiefern die Urkunde die spätere Umsetzung der Ehe beeinflusste.
- Politische Motive für die Ehevereinbarung
- Güterrechtliche Regelungen und deren Bedeutung im mittelalterlichen Kontext
- Die Rolle der Heiratsurkunde als Instrument der Machtsicherung und Konfliktlösung
- Die Umsetzung der Ehevereinbarung in der Praxis
- Die Auswirkungen der Ehe auf die politische Landschaft des 13. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt den Kontext der Heiratsurkunde in der mittelalterlichen Gesellschaft dar und betont die Bedeutung von Eheverbindungen als politisches Instrument. Die Analyse des Aufbaus der Urkunde zeigt, dass sie alle wesentlichen Elemente eines mittelalterlichen Ehevertrages enthielt. Die Ausstellungsabsichten der Heiratsurkunde werden im dritten Kapitel beleuchtet, wobei die Wiederherstellung eines Bündnisses, die Unterstützung Ottos II. von Ravensberg und die Schaffung eines Großterritoriums als wichtige Motive hervorgehoben werden. Das vierte Kapitel befasst sich mit den güterrechtlichen Regelungen, insbesondere mit der Festsetzung der Frauengabe, der Morgengabe und des väterlichen Erbes. Schließlich werden in Kapitel fünf die Auswirkungen der Heiratsurkunde auf den späteren Ehevollzug diskutiert.
Schlüsselwörter
Heiratsurkunde, mittelalterliche Gesellschaft, politische Bündnisse, güterrechtliche Regelungen, Eheverträge, Tecklenburg, Ravensberg, dynastische Politik, Herrschaftssicherung, Konfliktlösung, Verwandtschaft, Ehevollzug.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an der Ravensberg-Tecklenburgischen Eheabredung von 1238?
Es handelt sich um einen der ersten schriftlich überlieferten Eheverträge des Mittelalters, in einer Zeit, in der mündliche Absprachen noch die Regel waren.
Welche politischen Ziele verfolgte dieser Ehevertrag?
Ziele waren die Wiederherstellung eines Bündnisses („Rekonziliationsheirat“), die Unterstützung im Ravensberger Bruderzwist und die Vision eines Großterritoriums.
Welche güterrechtlichen Regelungen wurden getroffen?
Der Vertrag regelt Gaben wie die Heimsteuer (Frauengabe), die Morgengabe (Mannesseite) sowie das Wittum zur Versorgung der Witwe.
Wie wurde die Einhaltung des Vertrages im 13. Jahrhundert gesichert?
Die schriftliche Fixierung wurde durch Bürgen und Treueeide der Ministerialen beider Seiten sowie die Festsetzung eines frühen Ehevollzugs gestärkt.
Warum waren fürstliche Heiraten im Mittelalter „per se politisch“?
Da Herrschaft an Personen und Beziehungsnetze geknüpft war, dienten unauflösliche Ehebindungen als ideales Mittel, um politische Verträge dauerhaft zu verankern.
Wer waren die Hauptbeteiligten der Ehevereinbarung von 1238?
Die Vereinbarung betraf Heinrich, den Grafen von Tecklenburg, und Jutta, die Gräfin von Ravensberg.
- Arbeit zitieren
- Maria Hager (Autor:in), 2009, Die Politik der Eheschließung. Die ravensbergisch-tecklenburgische Eheabredung von 1238, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322859