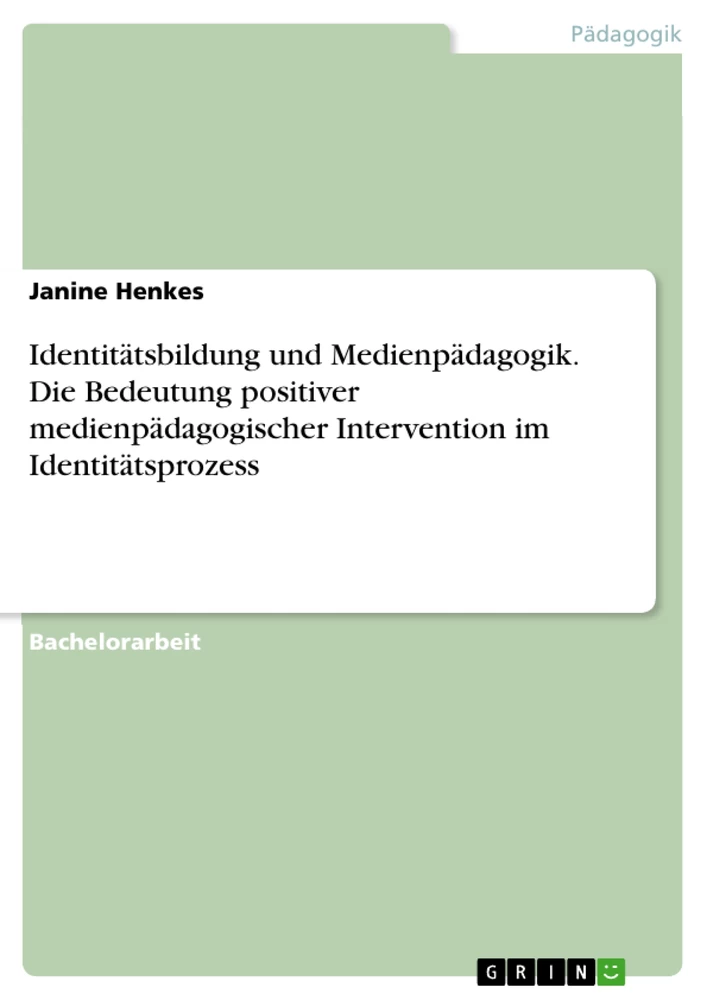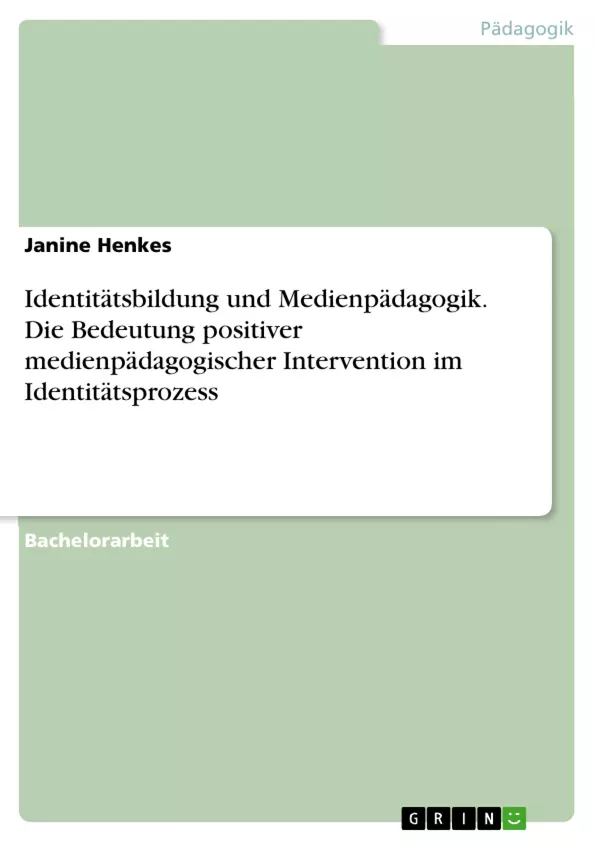Wer sind wir und was wollen wir sein? Sind wir einer oder viele? Wie entstehen Identitätsprozesse? Ist es möglich, in Identitätsprozesse positiv einzugreifen anhand medienpädagogischer Mittel?
Mein Interesse an entwicklungspychologischen Themen war schon immer sehr ausgeprägt. Gerade die frühkindliche Entwicklung hat einen enormen Einfluss auf die weitere Entwicklung, auf das gesamte Leben des Menschen, und somit einen sehr hohen Stellenwert für mich. Die Themen Persönlichkeit und Identität, deren Entwicklung und Festigung, bauen für mich persönlich sehr spannendende Fragen auf. Diese entwicklungspsychologischen Fragen gekoppelt mit den Themen Medien und Medienpädagogik stellen für mich eine große Herausforderung dar und genau deshalb möchte ich mich damit auseinandersetzen. Ich bin davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen Themata gibt und diesen möchte ich gerne in den nächsten Kapiteln erforschen.
Zu Anfang dieser Arbeit möchte ich einen Einstieg in die Themen Entwicklung und Identität geben. Nach den Definitionen sowie Begrifflichkeiten folgen zwei wichtige Theorien und Einzelaspekte der Identitätsbildung. Im weiteren Verlauf werden nun die Themen Neue Medien und Medienpädagogik definiert. Ein kleiner Einblick in die Geschichte beider Thematiken leitet anschließend in den theoretischen Teil der Medienpädagogik ein. Nun folgen auch ihre Methoden und Didaktik.
Im dritten großen Kapitel sollen nun diese zwei Hauptthemenblöcke zusammengeführt werden und zur Fragestellung hinführen. Dabei wird zunächst die mediale Situation junger Menschen in Deutschland dokumentiert. Anschließend gehe ich auf die Auswirkungen der Medienwelt auf die Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung ein und stelle schließlich die identitätsfördernden Chancen von Medienpädagogik dar.
Zum Ende möchte ich noch ein Medienprojekt vorstellen, welches aktuell an Berliner Grundschulen durchgeführt wird und anhand eines Interviews die Themen Medien und Schule noch näher beleuchten. Abschließend folgt mein persönliches Fazit über diese Forschungsarbeit mit Ausblick auf den weiteren Verlauf dieser Thesis.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Entwicklung und Identität
- 2.1 Definitionen und Begriffe
- 2.2 Theorie
- 2.3 Einzelaspekte der Identitätsbildung
- 2.3.1 Familie
- 2.3.2 Schule
- 3 Neue Medien und Medienpädagogik
- 3.1 Definitionen und Begriffe
- 3.2 Historie - Von damals bis heute
- 3.3 Theorie
- 3.4 Methodik und Didaktik
- 3.4.1 Lineare Medienpädagogik
- 3.4.2 Interaktive Medienpädagogik
- 4 Identität und Medienpädagogik
- 4.1 Mediale Situation junger Menschen
- 4.2 Identitätsbildung in der Medienwelt
- 4.3 Identitätsfördernde Chancen von Medienpädagogik
- 5 Neue Medien und Schule
- 5.1 Schulprojekt Spandau
- 5.1.1 Idee und Konzept
- 5.2 Experteninterview
- 5.2.1 Methode und Expertenauswahl
- 5.2.2 Auswertung des Interviews
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Identitätsbildungsprozessen und medienpädagogischen Maßnahmen. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, ob und wie Medienpädagogik positiv in die Identitätsentwicklung eingreifen kann. Die Arbeit basiert auf entwicklungspsychologischen Theorien und beleuchtet die Rolle neuer Medien in diesem Kontext.
- Identitätsentwicklung im Kindes- und Jugendalter
- Einfluss neuer Medien auf die Identitätsbildung
- Theorien und Methoden der Medienpädagogik
- Analyse eines konkreten Schulprojekts
- Potenzial medienpädagogischer Maßnahmen zur Identitätsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert das Forschungsinteresse der Autorin an der Verbindung zwischen entwicklungspsychologischen Aspekten, insbesondere der Identitätsbildung, und der Medienpädagogik. Die zentrale Forschungsfrage wird formuliert: "Ist es möglich, in Identitätsprozesse positiv einzugreifen anhand medienpädagogischer Mittel?". Es wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben, der die einzelnen Kapitel und deren Inhalte kurz vorstellt.
2 Entwicklung und Identität: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Entwicklung und beleuchtet verschiedene entwicklungspsychologische Theorien. Es werden unterschiedliche Perspektiven auf Entwicklungsprozesse dargestellt, von traditionellen, eher einseitig gerichteten Modellen hin zu neueren Ansätzen, die die lebenslange Entwicklung, interindividuelle Unterschiede und den Einfluss von Umweltfaktoren berücksichtigen. Die Bedeutung von Familie und Schule für die Identitätsbildung wird ebenfalls behandelt.
3 Neue Medien und Medienpädagogik: Dieses Kapitel widmet sich der Definition und historischen Entwicklung neuer Medien und der Medienpädagogik. Es werden verschiedene Theorien und Methoden der Medienpädagogik, wie lineare und interaktive Ansätze, erläutert und deren Bedeutung im Kontext der Identitätsbildung skizziert. Die Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Medienpädagogik von linearen hin zu interaktiven Ansätzen.
4 Identität und Medienpädagogik: In diesem zentralen Kapitel werden die vorherigen Kapitel zusammengeführt. Die mediale Situation junger Menschen wird beschrieben, und der Einfluss der Medienwelt auf die Identitätsentwicklung wird analysiert. Es wird untersucht, wie Medienpädagogik Identitätsfördernde Chancen bieten kann und wie diese Chancen genutzt werden können.
5 Neue Medien und Schule: Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Schulprojekt in Berliner Grundschulen und beleuchtet anhand eines Experteninterviews die Anwendung von Medien in der Schule und den Einfluss auf die Schüler. Die Methodik der Expertenauswahl und die Auswertung des Interviews werden detailliert beschrieben. Das Kapitel beleuchtet die Praxis der Medienpädagogik anhand eines Fallbeispiels und eines Experteninterviews.
Schlüsselwörter
Identitätsbildung, Medienpädagogik, Neue Medien, Entwicklungspsychologie, Jugendliche, Schule, Mediennutzung, Identitätsförderung, Experteninterview, Schulprojekt.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Identitätsbildung und Medienpädagogik
Was ist der Inhalt dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Identitätsbildungsprozessen bei Kindern und Jugendlichen und medienpädagogischen Maßnahmen. Sie befasst sich mit der Frage, ob und wie Medienpädagogik positiv auf die Identitätsentwicklung einwirken kann. Die Arbeit stützt sich auf entwicklungspsychologische Theorien und analysiert die Rolle neuer Medien in diesem Kontext. Ein konkretes Schulprojekt und ein Experteninterview liefern praktische Einblicke.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Identitätsentwicklung im Kindes- und Jugendalter, Einfluss neuer Medien auf die Identitätsbildung, Theorien und Methoden der Medienpädagogik, Analyse eines konkreten Schulprojekts (Schulprojekt Spandau) und das Potenzial medienpädagogischer Maßnahmen zur Identitätsförderung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Entwicklung und Identität (inkl. Definitionen, Theorien und Einzelaspekte wie Familie und Schule), Neue Medien und Medienpädagogik (inkl. Definitionen, Historie, Theorien, Methodik und Didaktik – lineare und interaktive Ansätze), Identität und Medienpädagogik (inkl. Mediale Situation junger Menschen, Identitätsbildung in der Medienwelt und identitätsfördernde Chancen von Medienpädagogik), Neue Medien und Schule (inkl. Beschreibung des Schulprojekts Spandau und Auswertung eines Experteninterviews) und Fazit.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit erläutert. Es folgen Kapitel zur Entwicklungspsychologie, zu neuen Medien und Medienpädagogik, sowie ein Kapitel, das den Zusammenhang zwischen Identität und Medienpädagogik untersucht. Ein Kapitel widmet sich einem konkreten Schulprojekt mit Experteninterview. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter erleichtern den Zugriff auf die Inhalte.
Welche Methoden wurden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus Literaturrecherche, Theorieanalyse und empirischen Methoden. Ein konkretes Schulprojekt und ein Experteninterview dienen der empirischen Untersuchung der Thematik. Die Methodik der Expertenauswahl und die Auswertung des Interviews werden detailliert beschrieben.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit beantwortet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: "Ist es möglich, in Identitätsprozesse positiv einzugreifen anhand medienpädagogischer Mittel?"
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Identitätsbildung, Medienpädagogik, Neue Medien, Entwicklungspsychologie, Jugendliche, Schule, Mediennutzung, Identitätsförderung, Experteninterview, Schulprojekt.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist primär für den akademischen Gebrauch bestimmt und richtet sich an Leser, die sich für die Themen Identitätsentwicklung, Medienpädagogik und den Einfluss neuer Medien auf Jugendliche interessieren. Sie ist insbesondere für Studierende der Pädagogik und verwandter Disziplinen relevant.
- Arbeit zitieren
- Janine Henkes (Autor:in), 2015, Identitätsbildung und Medienpädagogik. Die Bedeutung positiver medienpädagogischer Intervention im Identitätsprozess, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322892