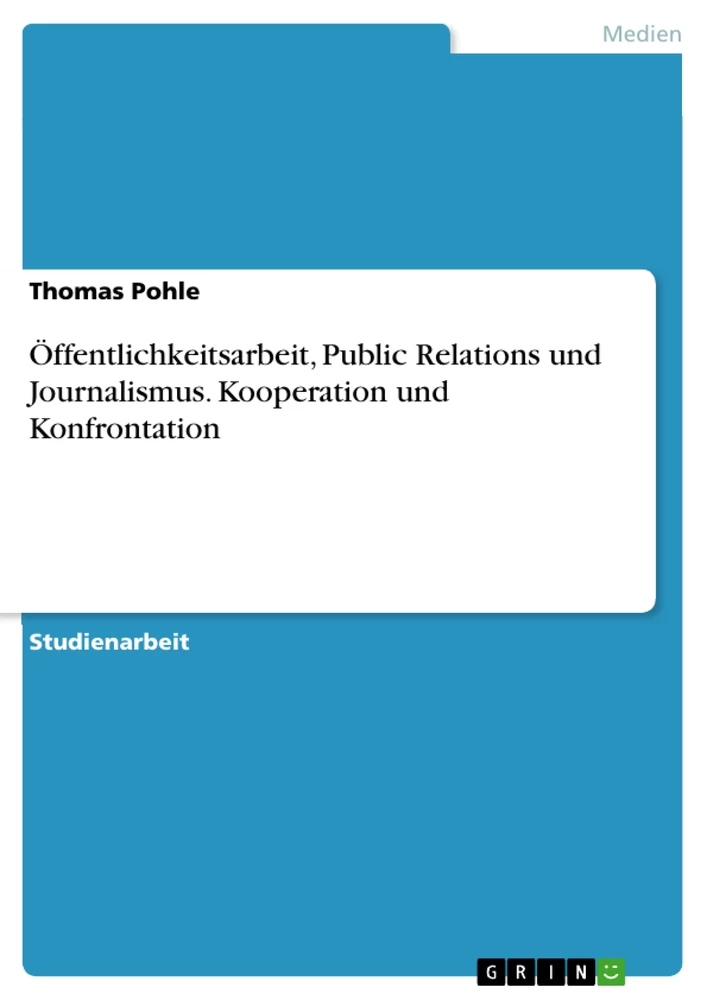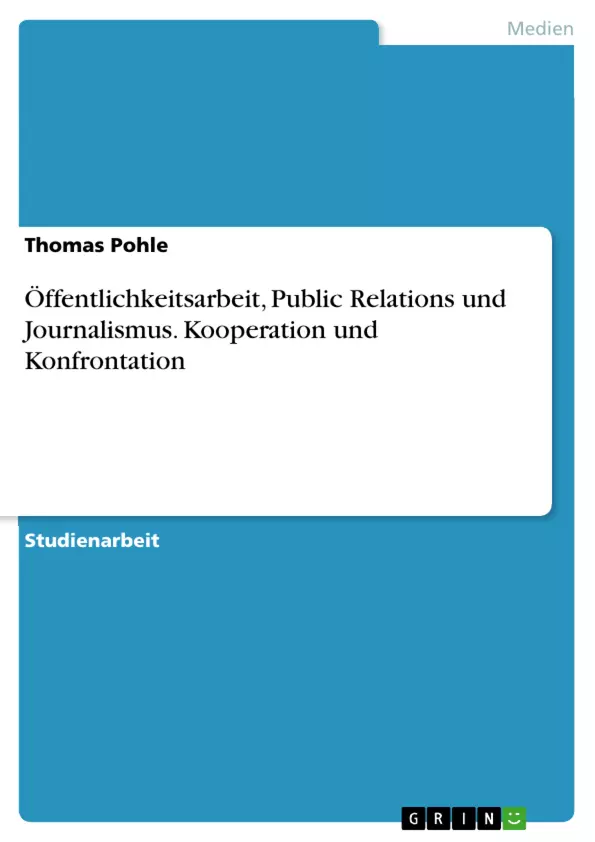Wozu brauchen wir noch Journalisten? – Diese Frage stellt sich auch Armin Wolf, Moderator und stellvertretender Chefredakteur der TV-Information des Österreichischen Rundfunks (ORF), in seinem gleichnamigen Buch. Hierbei bezieht er sich auf die Tatsache, dass heutzutage immer mehr Menschen auf privater Ebene Informationen ins Netz stellen.
Beschäftigt man sich mit der Thematik des Einflusses von Public Relations – nachfolgend auch als PR abgekürzt oder Öffentlichkeitsarbeit – auf den Journalismus, so stellt sich einem nach einiger Zeit eventuell auch die Frage, ob man nicht vielleicht sogar auf den Journalismus, in der Form wie er heutzutage überwiegend betrieben wird, lieber verzichten möchte. Viele Studien belegen mittlerweile, dass Journalisten oftmals gekauft werden und selbst kaum noch Eigenrecherche betreiben. Inwiefern und vor allem von wem, wird in folgender Arbeit dargelegt. Es werden verschiedene Studien und Meinungen zu diesem Thema umrissen und gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Public Relations
- 2. Journalismus
- II. Journalismus und PR im Verhältnis
- III. Forschung
- 1. Studie Reporters and Officials (Sigal; 1973)
- 2. Studie Der Einfluss der Gatekeeper auf die Themenstruktur der Öffentlichkeit (Nissen/Menningen; 1977)
- 3. Relations Between Journalists and Public Relations Practitioners (Jean Charron; 1974)
- 4. Studie Öffentlichkeitsarbeit oder Journalismus? Zum Einfluß im Mediensystem (Baerns; 1979)
- a. Leitgedanke, Forschungsansatz, Forschungsdesign
- b. Ergebnisse
- 5. Studie PR-basierte Zeitungsberichte (Haller; 2005)
- IV. Einfluss PR auf Journalismus (brancheninterner Umgang)
- V. PR und Journalismus - ein spannungsvolles Verhältnis (Carsten Lange; 2000)
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Public Relations (PR) auf den Journalismus. Sie untersucht die Beziehung zwischen diesen beiden Bereichen und analysiert die Entwicklung dieser Beziehung im Laufe der Zeit. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Studien, die sich mit dem Thema befassen, und stellt die unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen gegenüber.
- Die Rolle von PR in der heutigen Gesellschaft
- Der Einfluss von PR-Botschaften auf die Medienberichterstattung
- Die Entwicklung des Journalismus im Kontext von PR
- Die ethischen und professionellen Herausforderungen im Verhältnis von PR und Journalismus
- Die Bedeutung unabhängiger und kritischer Berichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des Einflusses von PR auf den Journalismus vor und führt in die beiden Grundbegriffe ein. Kapitel I behandelt die Definition und Entwicklung von PR, während Kapitel II die Geschichte und Entwicklung des Journalismus beleuchtet. Kapitel III befasst sich mit dem Verhältnis von PR und Journalismus und analysiert verschiedene Studien, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Kapitel IV untersucht den Einfluss von PR auf den Journalismus aus der Perspektive der Medienbranche. Kapitel V betrachtet das spannungsvolle Verhältnis zwischen PR und Journalismus. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Public Relations, Journalismus, Medienberichterstattung, Einfluss, Öffentlichkeitsarbeit, Medienkodex, Forschung, politische Kommunikation, Agenda-Setting, Gatekeeper, PR-Botschaften, unabhängige Berichterstattung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Public Relations (PR) den Journalismus?
PR beeinflusst den Journalismus durch die Bereitstellung von Informationen und Themen (Agenda-Setting), was dazu führen kann, dass Journalisten weniger Eigenrecherche betreiben.
Was ist die zentrale Kritik am modernen Journalismus im Verhältnis zur PR?
Kritiker bemängeln, dass Journalisten oft PR-Botschaften ungeprüft übernehmen und somit ihre Funktion als neutrale „Gatekeeper“ und Kontrolleure verlieren.
Welche Studien untersuchen das Verhältnis von PR und Medien?
Wichtige Studien sind unter anderem von Sigal (1973), Baerns (1979) und Haller (2005), die den Anteil von PR-basierten Berichten in Zeitungen analysieren.
Was bedeutet der Begriff „Gatekeeper“ in diesem Kontext?
Gatekeeper sind Journalisten oder Redakteure, die entscheiden, welche Informationen veröffentlicht werden und welche nicht – ein Prozess, der durch PR massiv beeinflusst werden kann.
Gibt es eine Kooperation zwischen PR-Praktikern und Journalisten?
Ja, es herrscht ein spannungsvolles Verhältnis aus Kooperation (Informationsfluss) und Konfrontation (Interessenskonflikte), das für beide Seiten oft unverzichtbar ist.
- Quote paper
- Thomas Pohle (Author), 2015, Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations und Journalismus. Kooperation und Konfrontation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322992