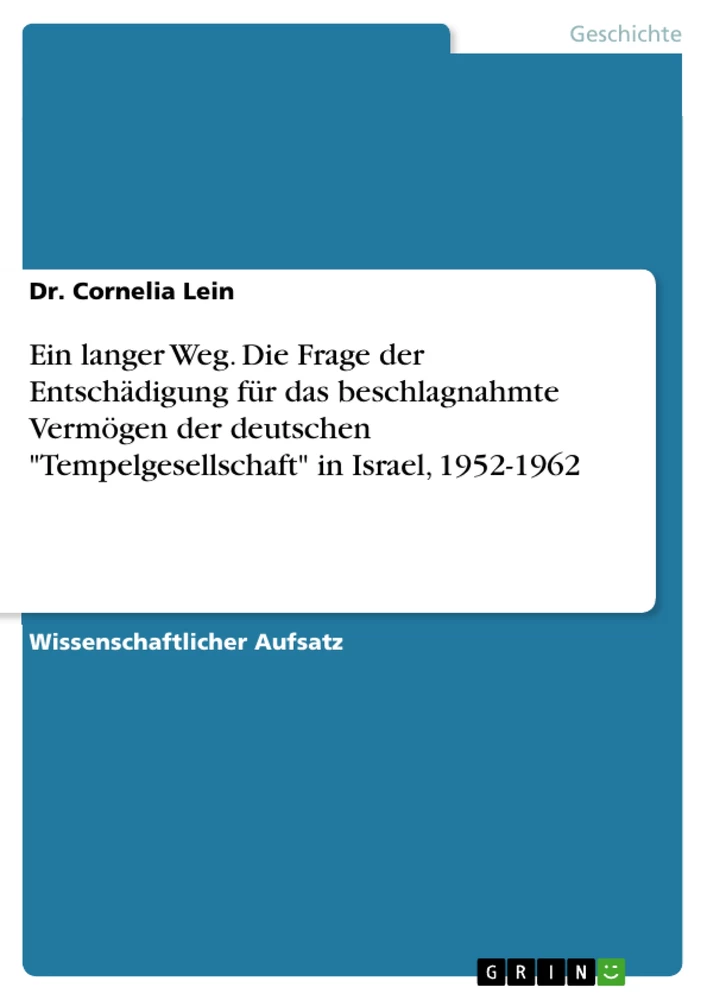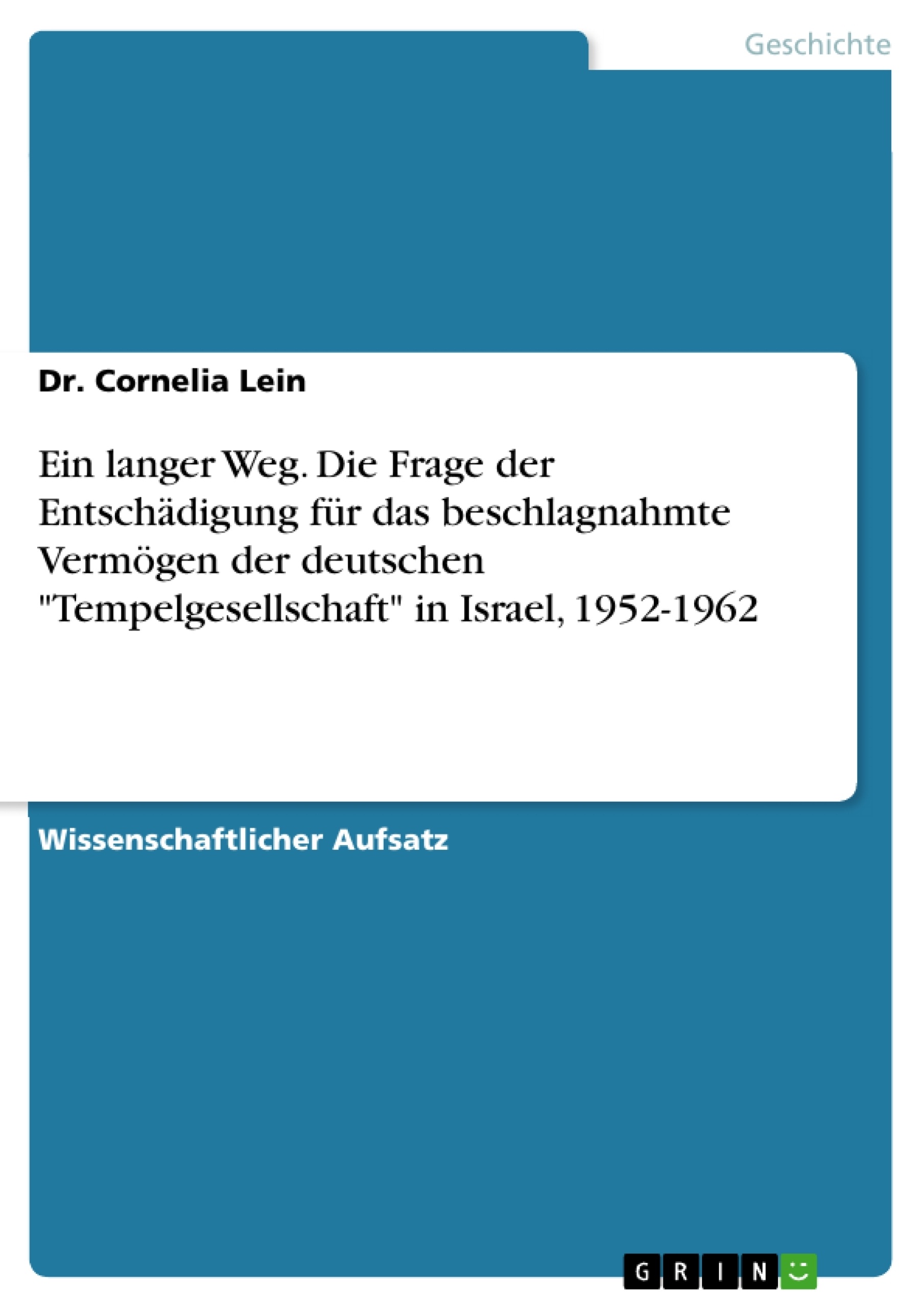Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, ausgehend von dem Wirken der Tempelgesellschaft in Palästina bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, die Frage der Entschädigung für das durch israelisches Gesetz beschlagnahmte Vermögen der Tempelgesellschaft und den Weg hin zu dem das Problem abschließend regelnden Abkommen zwischen der deutschen
und israelischen Regierung über deutsches weltliches Vermögen in Israel vom 1. Juni 1962 nachzuzeichnen. Der Status einer der evangelischen oder katholischen Kirche gleichbedeutenden Religionsgemeinschaft wurde der Tempelgesellschaft nicht zugesprochen, der einer religiösen Gemeinschaft im Unterschied zu dem Terminus Sekte, nach anfänglichem Gebrauch dieser Bezeichnung auch im Auswärtigen Amt, hingegen sehr wohl.
Von der These ausgehend, dass realpolitische Überlegungen in der Entschädigungsfrage genauso wie psychologische
Folgen der Shoah bzw. des Holocaust ursächlich für die zehn Jahre andauernden Verhandlungen um das Vermögen der Tempelgesellschaft gewesen sind, sollen folgende Fragen
genauer beleuchtet werden: Warum verrechneten die Bundesrepublik und Israel das dort beschlagnahmte deutsche
Vermögen letztlich mit den gemäß Luxemburger Abkommen durch die Bundesrepublik an Israel zu erbringenden Leistungen?
Weswegen lehnte man im Rahmen eines deutsch-israelischen Vergleichs die vorangehende Tätigkeit eines Mediators auf israelischer Seite schließlich doch ab?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Tempelgesellschaft in Palästina
- Verhandlungsgrundlage und Verhandlungsgegenstand
- Das Vermögen der Tempelgesellschaft als Faustpfand? Rechtliche und politische Probleme
- Die Verhandlungen bis 1962
- Das Abkommen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz zeichnet den Weg der Entschädigung für das durch israelisches Gesetz beschlagnahmte Vermögen der Tempelgesellschaft nach, ausgehend von deren Wirken in Palästina bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Er beleuchtet den Prozess, der zum Abkommen zwischen der deutschen und israelischen Regierung über deutsches weltliches Vermögen in Israel vom 1. Juni 1962 führte.
- Der Status der Tempelgesellschaft als religiöse Gemeinschaft und die Bedeutung dieser Einstufung in den Verhandlungen
- Die Rolle politischer Überlegungen und der psychologischen Folgen des Holocaust im Entschädigungsprozess
- Die Verrechnung des beschlagnahmten Vermögens mit den Leistungen der Bundesrepublik an Israel gemäß dem Luxemburger Abkommen
- Die Gründe für die Ablehnung eines Mediators auf israelischer Seite im Rahmen des deutsch-israelischen Vergleichs
- Die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Tempelgesellschaft und dem nationalsozialistischen Regime
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Beschlagnahmung deutschen Vermögens in Israel nach dem Zweiten Weltkrieg dar und skizziert die besonderen Herausforderungen der Entschädigungsfrage für die Tempelgesellschaft. Das zweite Kapitel widmet sich der Geschichte der Tempelgesellschaft in Palästina, beleuchtet ihre Entstehung, ihre Siedlungsbestrebungen und ihre Beziehungen zum deutschen Kaiserreich. Das dritte Kapitel analysiert die Verhandlungsgrundlage und den Gegenstand der Verhandlungen um die Entschädigung des Tempelvermögens, wobei die rechtlichen und politischen Probleme im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Tempelgesellschaft, Palästina, Israel, Entschädigung, Vermögen, Verhandlung, Luxemburger Abkommen, Holocaust, nationalsozialistisches Regime, politische Überlegungen, religiöse Gemeinschaft.
- Quote paper
- Dr. Cornelia Lein (Author), 2016, Ein langer Weg. Die Frage der Entschädigung für das beschlagnahmte Vermögen der deutschen "Tempelgesellschaft" in Israel, 1952-1962, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323024