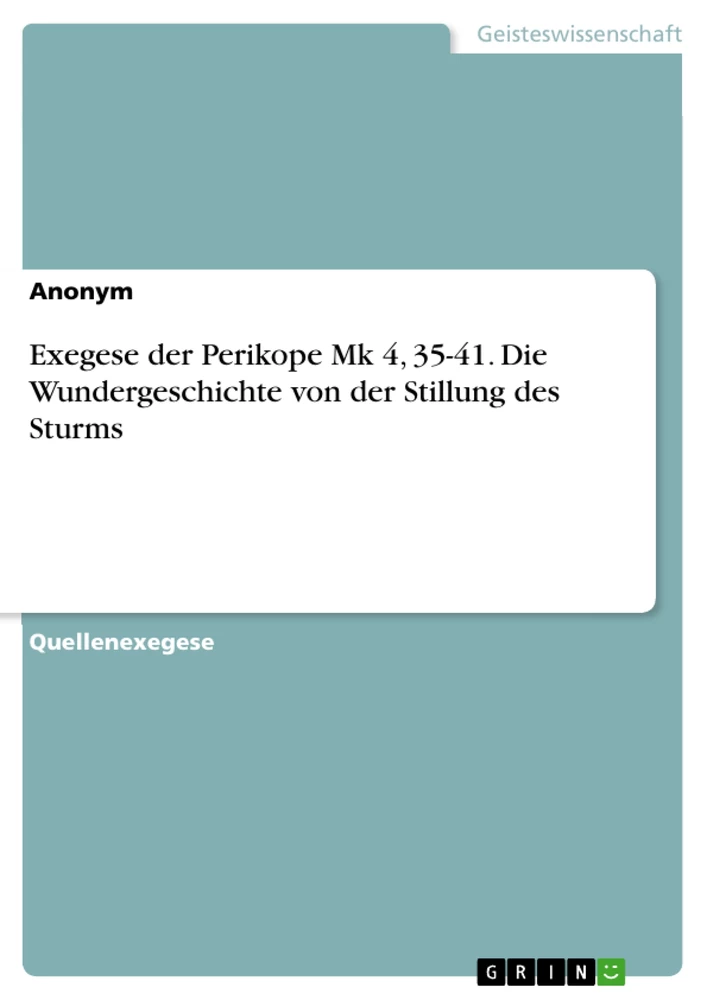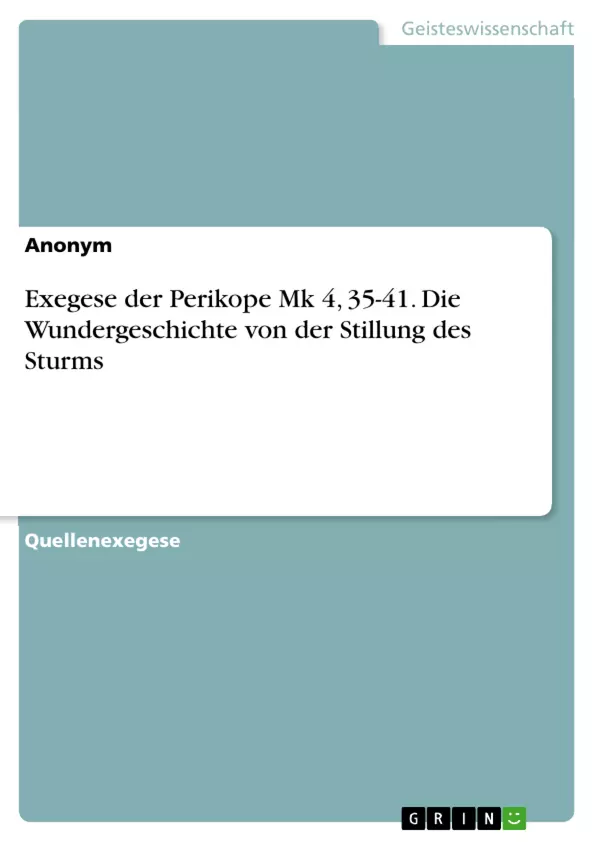Diese exegetische Hausarbeit wird sich mit der Perikope Mk 4, 35- 41 beschäftigen: die Wundergeschichte der Stillung des Sturms.
Zentrale Themen sind der Glaube und das Vertrauen in Jesus, sowie die auf ihn übertragene Vollmacht Gottes. Sie orientiert sich dabei an das typische Muster der historisch- kritischen Exegese. Hierfür wird die vorliegende Perikope inhaltlich, wie auch sprachlich genau untersucht um herauszuarbeiten, welche Intention der Verfasser Markus bei der Abfassung seines Evangeliums verfolgt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Übersetzungsvergleich
- Abgrenzung und Kontextanalyse
- Strukturanalyse
- Literarkritik
- Begriffsgeschichte
- Formgeschichte
- Redaktionsgeschichte und Interpretation
- Synoptischer Vergleich
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese exegetische Hausarbeit befasst sich mit der Perikope Mk 4, 35-41, der Wundergeschichte der Stillung des Sturms. Die Arbeit untersucht den Glauben und das Vertrauen in Jesus sowie die auf ihn übertragene Vollmacht Gottes. Sie folgt dabei dem Muster der historisch-kritischen Exegese und analysiert die Perikope inhaltlich und sprachlich, um die Intention des Verfassers Markus bei der Abfassung seines Evangeliums zu erforschen.
- Die Bedeutung von Glauben und Vertrauen in Jesus Christus
- Die Vollmacht Jesu als Herr über die Natur
- Die Rolle der Jünger im Kontext der Wundergeschichte
- Die literarische Gestaltung der Perikope im Markusevangelium
- Die Interpretation der Perikope im Hinblick auf den Kontext des Markusevangeliums
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit widmet sich einer Hinführung zum Thema und stellt die zentrale Fragestellung sowie den methodischen Ansatz vor. Das zweite Kapitel befasst sich mit einem Übersetzungsvergleich verschiedener Bibelausgaben, um die beste Grundlage für die exegetische Arbeit zu finden. Das dritte Kapitel analysiert die Perikope im engeren und weiteren Kontext, untersucht die Struktur des Textes und befasst sich mit literarkritischen Aspekten. Das vierte Kapitel analysiert die Redaktionsgeschichte der Perikope und bietet eine Interpretation des Textes.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Exegese, Perikope, Stillung des Sturms, Markus, Evangelium, Glaube, Vertrauen, Vollmacht, Wunder, Natur, Jünger, Literarkritik, Kontext, Redaktionsgeschichte, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Perikope Mk 4, 35-41?
Es handelt sich um die Wundergeschichte von der Stillung des Sturms durch Jesus auf dem See Gennesaret.
Was bedeutet historisch-kritische Exegese?
Es ist eine wissenschaftliche Methode zur Bibelauslegung, die Texte in ihrem ursprünglichen historischen und literarischen Kontext untersucht.
Welche Botschaft vermittelt die Stillung des Sturms?
Zentrale Themen sind der Glaube und das bedingungslose Vertrauen in Jesus sowie die Darstellung seiner göttlichen Vollmacht über die Naturgewalten.
Wie werden die Jünger in dieser Geschichte dargestellt?
Die Jünger werden als kleinmütig und verängstigt gezeichnet, was einen Kontrast zur souveränen Ruhe Jesu bildet.
Was ist eine Literarkritik bei biblischen Texten?
Sie untersucht, ob ein Text aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt wurde oder ob es sprachliche Brüche gibt, die auf eine Redaktion hinweisen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Exegese der Perikope Mk 4, 35-41. Die Wundergeschichte von der Stillung des Sturms, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323090