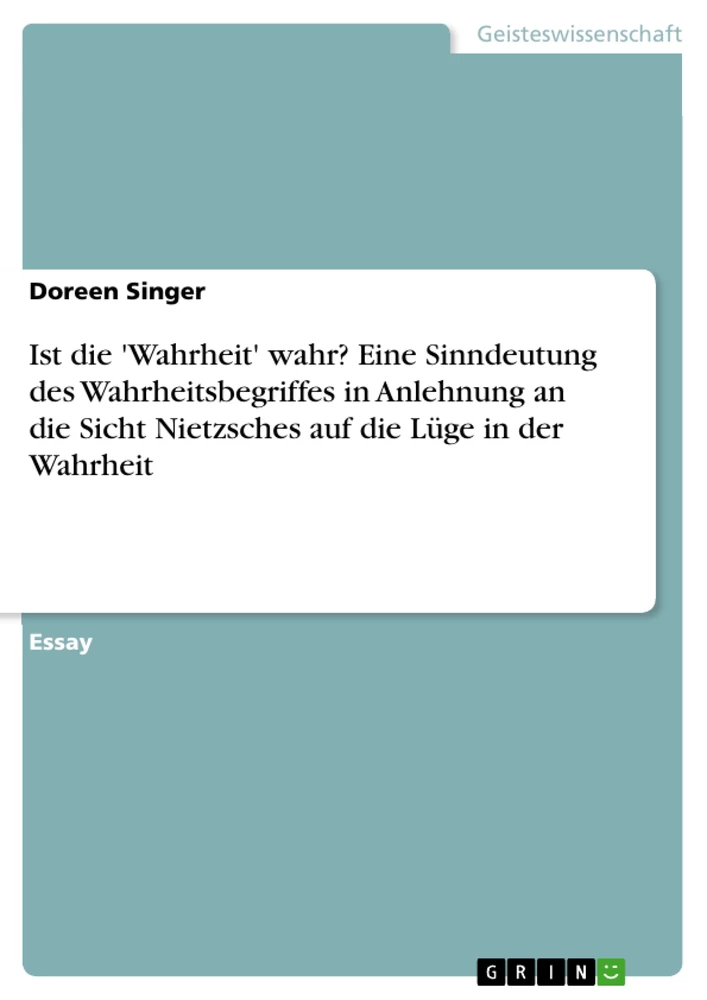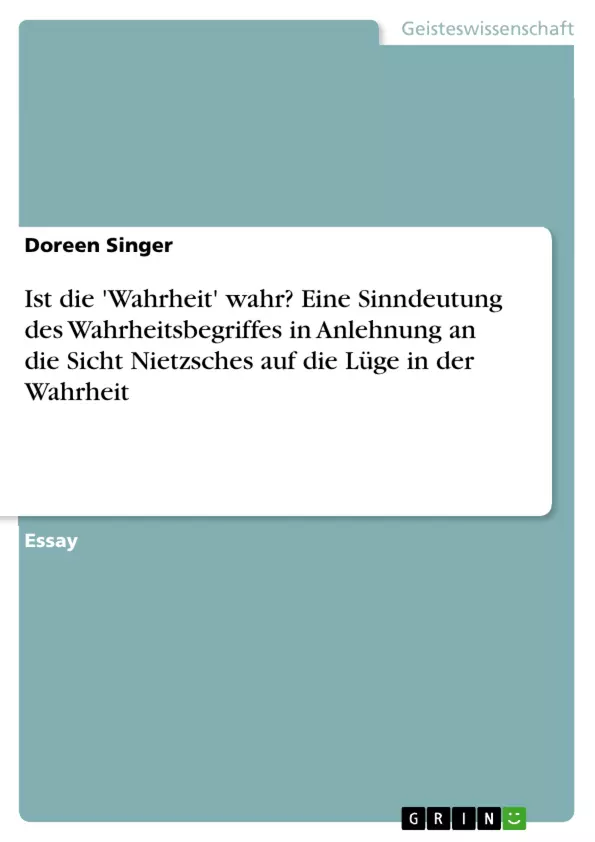Nur wenige Themen der Philosophie erstrecken sich über zweieinhalbtausend Jahre, ohne sich auch nur annähernd in der Grundposition ihrer Vertreter anzunähern. Dies macht die Wahrheitsfindung zu einem zentralen Problem der Philosophie.
Diverse Differenzen in den Wahrheitswerten der einzelnen Epochen betonen die Unterschiedlichkeit der möglichen Beantwortung der Frage nach der ‚Wahrheit‘. Die innere Fragwürdigkeit des Wahrheitsgehaltes der ‚Wahrheit‘ ist Thema dieser Untersuchung. Wenn die Aussage Nietzsches „Wahrheit ist Illusion“ gelten soll und alles, was bis dahin als Tatsache galt, nur subjektive Deutung war, kann folglich Wahrheit nicht als adäquate Abbildung der Wirklichkeit angenommen werden, weil schon die subjektive Deutung eine Täuschung der Wirklichkeit sein kann.
Diese Erörterung kommt zu dem Schluss, dass die ‚Wahrheit‘ nicht den Anspruch auf vollkommene und adäquate Abbildung der Wirklichkeit erheben kann, da es nicht möglich ist, den Wahrheitsbegriff über alle Dimensionen hinaus einheitlich einzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstrakt
- Die Entstehung des Wahrheitsbegriffes
- Wahrheit im außermoralischem Sinn
- Nietzsches Wahrheitsbegriff, an sich'
- Kritik am Wahrheitsbegriff
- Ist die,Wahrheit' wahr?
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik des Wahrheitsbegriffes im Laufe der Geschichte der Philosophie. Ziel ist es, die innere Fragwürdigkeit des Wahrheitsgehaltes von „Wahrheit“ zu beleuchten und die Frage zu stellen, ob „Wahrheit“ die Wirklichkeit vollkommen und adäquat abbilden kann. Die Arbeit analysiert verschiedene philosophische Ansätze zur Wahrheit, insbesondere Nietzsches Sichtweise.
- Entwicklung des Wahrheitsbegriffes von der Antike bis zur Moderne
- Nietzsches Kritik am traditionellen Wahrheitsbegriff
- Die Rolle der Sprache in der Konstruktion von Wahrheit
- Die Frage nach der Adäquatheit der Wahrheit
- Die Problematik der Vieldeutigkeit des Wahrheitsbegriffes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Entstehung des Wahrheitsbegriffes: Bereits bei Aristoteles wurde die Frage nach der Bedeutung des Wahrheitsbegriffes diskutiert. Die Arbeit beschreibt die Entwicklung des Verständnisses von Wahrheit als Übereinstimmung von Gedanken und Aussagen mit der Realität, repräsentiert durch die Äquivalenztheorie (Veritas est adequatio intellectus et rei). Aristoteles' Definition von Wahrheit als Übereinstimmung von Aussage und Sein wird erläutert. Die Arbeit hebt die anhaltende Debatte um den Wahrheitsbegriff und die widersprüchlichen Interpretationen hervor, die bis heute bestehen. Die Entwicklung vom klassischen Wahrheitsbegriff hin zu modernen Interpretationen, welche die Vieldeutigkeit und den konstruktiven Aspekt des Wahrheitsbegriffes betonen, wird angedeutet.
Wahrheit im außermoralischen Sinn: Dieses Kapitel befasst sich mit Nietzsches Wahrheitsbegriff, der als Illusion betrachtet wird, da Sprache die Wirklichkeit nicht adäquat abbilden kann. Nietzsches Schrift "Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne" wird als Grundlage herangezogen. Der Kontext Nietzsches Lebens und Werkes wird skizziert, um seine radikalen Ansichten über Wahrheit zu erklären. Die Arbeit analysiert Nietzsches Kritik an der Sprache als Werkzeug der Wahrheitsfindung und deren limitierte Fähigkeit zur objektiven Abbildung der Realität. Der Einfluss des Nihilismus und die Abkehr von einer absolut wahren Darstellung der Welt werden beleuchtet. Die Kritikpunkte an Nietzsches Auffassung werden angerissen, um die nachfolgende Diskussion zu fundieren.
Ist die,Wahrheit' wahr?: Dieses Kapitel stellt die zentrale Frage der Arbeit: Kann Wahrheit die Wirklichkeit in ihrer Vollkommenheit abbilden? Es wird argumentiert, dass aufgrund der Vieldeutigkeit des Wahrheitsbegriffes und der Unmöglichkeit, absolute Wahrheitskriterien zu definieren, die Wahrheit keinen Anspruch auf vollkommene Abbildung der Wirklichkeit erheben kann. Das Kapitel bereitet die Diskussion der nachfolgenden Kapitel vor und dient als Rahmen für die Analyse der vorhergehenden Kapitel.
Schlüsselwörter
Wahrheitsbegriff, Nietzsche, Äquivalenztheorie, Korrespondenztheorie, Sprache, Illusion, Wirklichkeit, Adäquatheit, Vieldeutigkeit, Philosophiegeschichte, Kritik, Objektivität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der Wahrheitsbegriff - Eine philosophische Analyse"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Problematik des Wahrheitsbegriffs in der Philosophiegeschichte. Sie beleuchtet die innere Fragwürdigkeit des Wahrheitsgehalts von „Wahrheit“ und fragt, ob „Wahrheit“ die Wirklichkeit vollkommen und adäquat abbilden kann. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse verschiedener philosophischer Ansätze zur Wahrheit, insbesondere der Sichtweise Nietzsches.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Wahrheitsbegriffs von der Antike bis zur Moderne, Nietzsches Kritik am traditionellen Wahrheitsbegriff, die Rolle der Sprache in der Konstruktion von Wahrheit, die Frage nach der Adäquatheit der Wahrheit und die Problematik der Vieldeutigkeit des Wahrheitsbegriffs.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Entstehung des Wahrheitsbegriffs (inkl. Aristoteles' Äquivalenztheorie), zu Nietzsches Wahrheitsbegriff im außermoralischen Sinn (inkl. Analyse von "Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne"), zur zentralen Frage "Ist die 'Wahrheit' wahr?", sowie eine Schlussfolgerung und ein Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Rolle spielt Nietzsche in dieser Arbeit?
Nietzsches Wahrheitsbegriff, der als Illusion betrachtet wird, da Sprache die Wirklichkeit nicht adäquat abbilden kann, steht im Zentrum der Analyse. Seine Kritik an der Sprache als Werkzeug der Wahrheitsfindung und die damit verbundene limitierte Fähigkeit zur objektiven Abbildung der Realität werden ausführlich untersucht. Der Einfluss des Nihilismus und die Abkehr von einer absolut wahren Darstellung der Welt werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass aufgrund der Vieldeutigkeit des Wahrheitsbegriffs und der Unmöglichkeit, absolute Wahrheitskriterien zu definieren, die Wahrheit keinen Anspruch auf vollkommene Abbildung der Wirklichkeit erheben kann. Die genaue Argumentation und die Schlussfolgerung sind im Kapitel "Ist die 'Wahrheit' wahr?" und der Schlussfolgerung detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wahrheitsbegriff, Nietzsche, Äquivalenztheorie, Korrespondenztheorie, Sprache, Illusion, Wirklichkeit, Adäquatheit, Vieldeutigkeit, Philosophiegeschichte, Kritik, Objektivität.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich akademisch mit dem Wahrheitsbegriff auseinandersetzen möchten. Der Text ist für ein wissenschaftliches Publikum konzipiert und dient der Analyse philosophischer Themen.
- Quote paper
- Doreen Singer (Author), 2016, Ist die 'Wahrheit' wahr? Eine Sinndeutung des Wahrheitsbegriffes in Anlehnung an die Sicht Nietzsches auf die Lüge in der Wahrheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323376