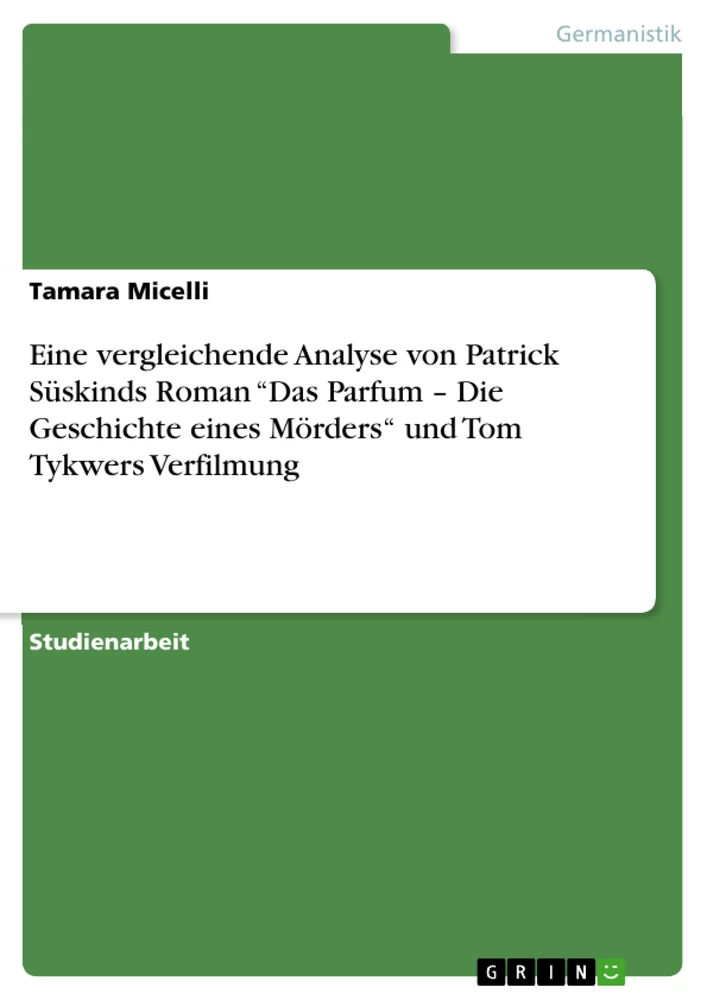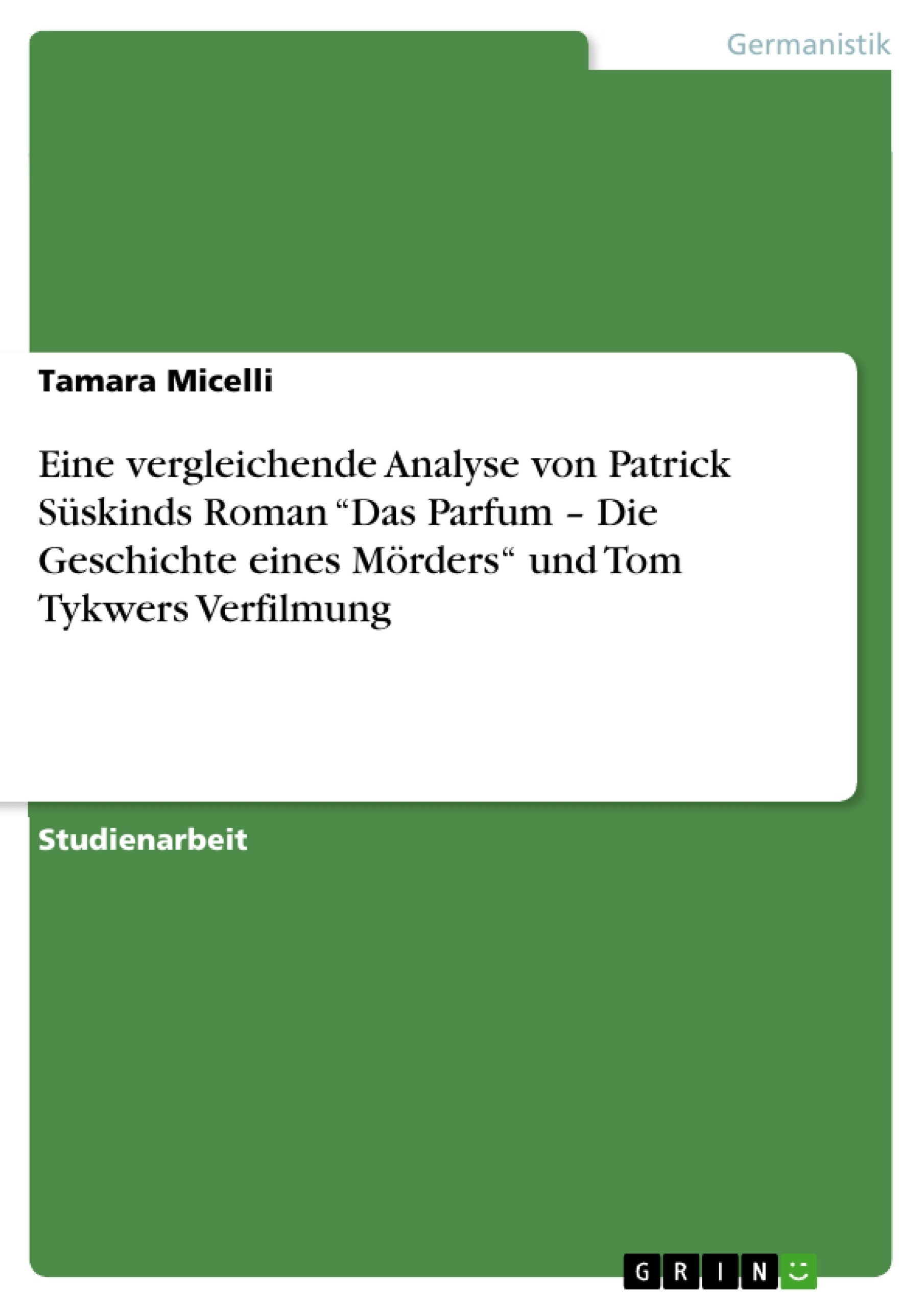Im Jahr 1985 erschien im Diogenes Verlag ein Roman eines deutschsprachigen Autors, den es in dieser Form noch nicht gab. Es handelt sich um Patrick Süskinds „Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders“. Obwohl weder über den Autor selbst, noch über die genaue Entstehungsgeschichte des Buches viel bekannt ist, wurde der Stoff ein Verkaufsschlager.
Es war wahrscheinlich, dass so ein erfolgreiches Buch verfilmt werden sollte. Süskind wollte am Anfang sein Buch nicht freigeben, obwohl Regisseure wie Steven Spielberg, Tim Burton, Ridley Scott und Bernd Eichinger Interesse zeigten. 2001, 20 Jahre nach Erscheinung des Buches, überließ Patrick Süskind Bernd Eichinger, einem guten Freund die Rechte an “Das Parfum“.
In Zusammenarbeit mit Tom Tykwer, arbeitete Eichinger 5 Jahre an der Produktion des Films bis er 2006 erschien.
Im Folgenden werde ich die Romanvorlage in zwei Punkten mit dessen Verfilmung vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Erzähler
- Süskinds Erzähler
- Tykwers Erzähler
- Vergleich des Anfangs
- Der Anfang des Buches
- Der Anfang des Films
- Der Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der vergleichenden Analyse von Patrick Süskinds Roman „Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“ und der gleichnamigen Verfilmung von Tom Tykwer. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der literarischen Vorlage und der filmischen Adaption aufzuzeigen und die jeweiligen Besonderheiten der beiden Medien zu beleuchten.
- Die Rolle des Erzählers in Roman und Film
- Die Darstellung der Hauptfigur Jean-Baptiste Grenouille
- Die Bedeutung des Geruchs in der Geschichte
- Die Adaption des Romans in die filmische Sprache
- Die Frage der Moral und der Interpretation des Verbrechens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Literaturverfilmung ein und stellt die beiden Werke vor. Der zweite Teil befasst sich mit dem Erzähler in Roman und Film, indem er die Erzählperspektive, den Erzählton und die Rolle des Erzählers in der Geschichte analysiert. Im dritten Teil wird der Anfang des Romans mit dem Anfang des Films verglichen, um die Umsetzung der literarischen Vorlage in die filmische Sprache zu untersuchen. Der letzte Teil behandelt den Schluss des Romans und die damit verbundenen Fragen der Interpretation und der Moral.
Schlüsselwörter
Literaturverfilmung, Patrick Süskind, Tom Tykwer, „Das Parfum“, Erzähler, Adaption, Filmsprache, Moral, Verbrechen, Geruchslandschaft, Grenouille.
Häufig gestellte Fragen
Wann erschien der Roman „Das Parfum“ und wer ist der Autor?
Der Roman wurde 1985 von Patrick Süskind veröffentlicht und entwickelte sich schnell zu einem weltweiten Verkaufsschlager.
Wie kam es zur Verfilmung des Stoffes?
Nachdem Süskind die Rechte lange nicht freigeben wollte, überließ er sie 2001 Bernd Eichinger, der den Film zusammen mit Tom Tykwer produzierte.
Wie unterscheidet sich der Erzähler im Buch von dem im Film?
Die Arbeit analysiert die Unterschiede in der Erzählperspektive und wie Tykwer den literarischen Ton filmisch umgesetzt hat.
Welche Rolle spielt der Geruch in beiden Medien?
Es wird untersucht, wie die „Geruchslandschaft“, die Süskind sprachlich meisterhaft beschreibt, von Tykwer visuell und akustisch adaptiert wurde.
Was sind die zentralen Themen der Analyse?
Die Analyse fokussiert auf den Erzähler, den Vergleich von Anfang und Schluss sowie die Darstellung der Hauptfigur Jean-Baptiste Grenouille.
- Quote paper
- Tamara Micelli (Author), 2014, Eine vergleichende Analyse von Patrick Süskinds Roman “Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“ und Tom Tykwers Verfilmung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323398