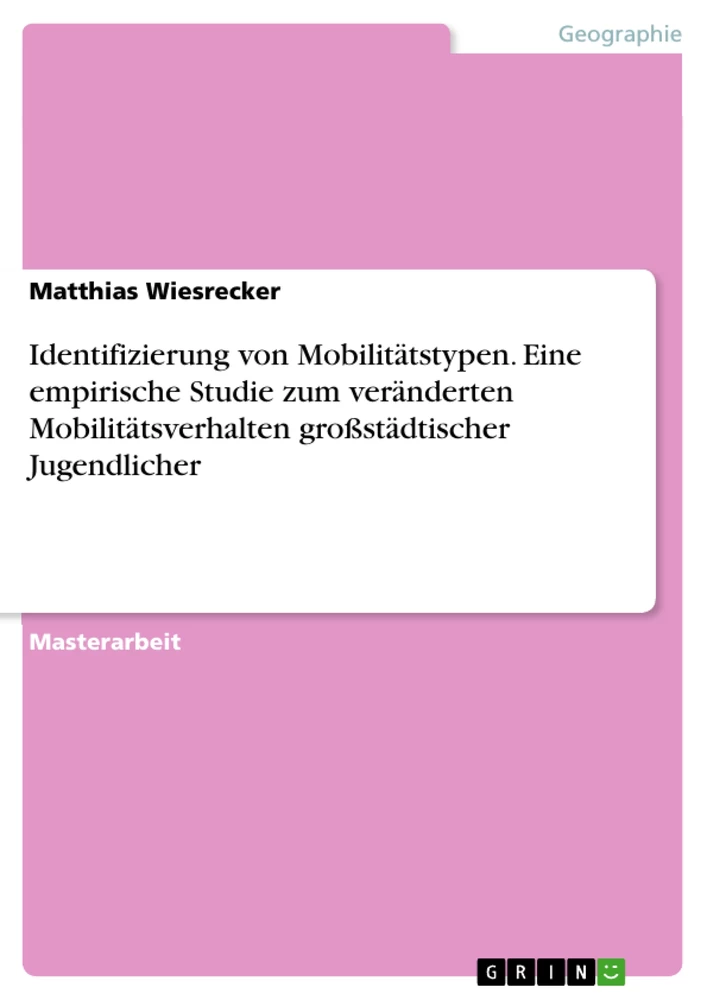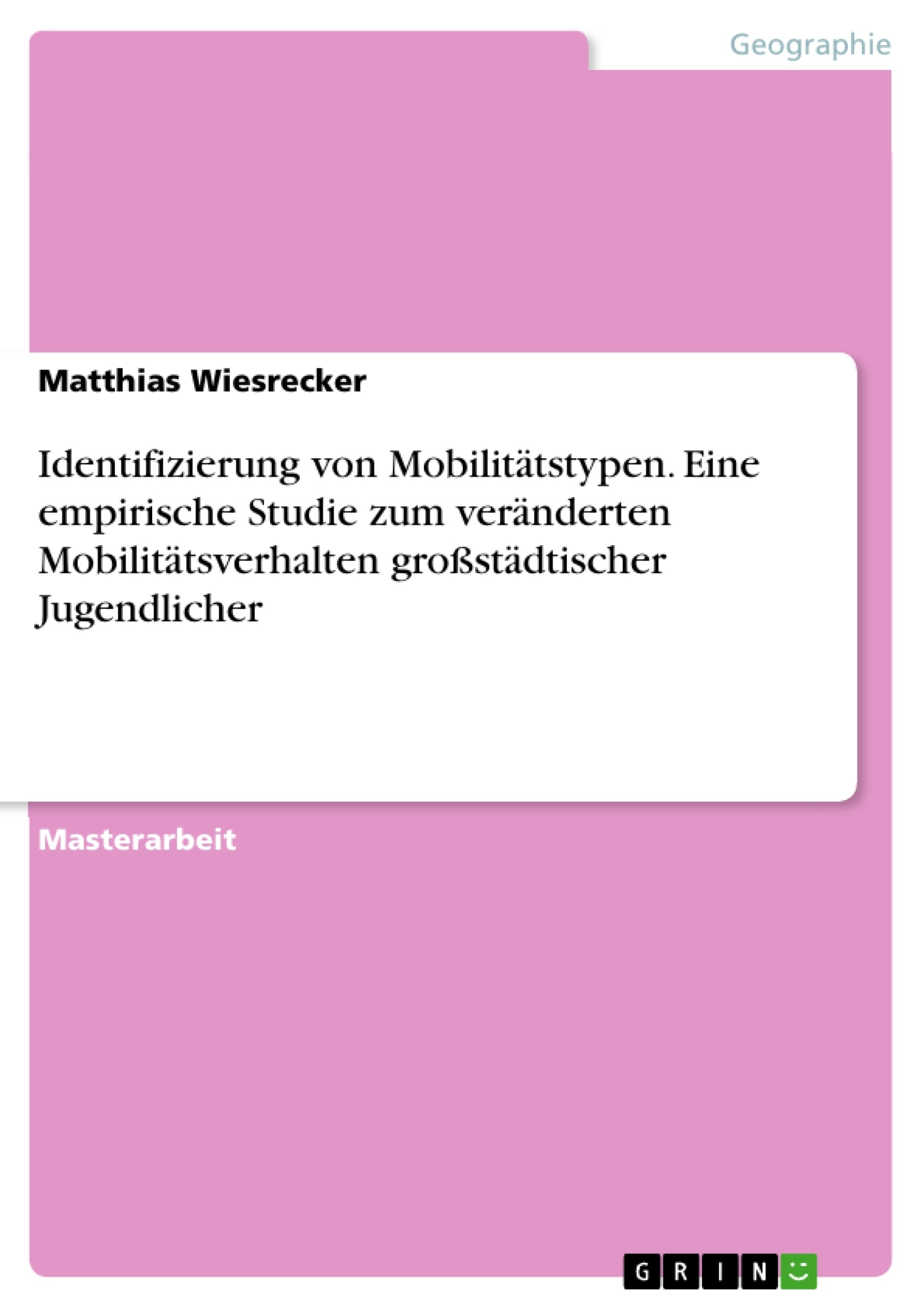Das Automobil nimmt besonders in westlichen Gesellschaften einen hohen Stellenwert ein, denn spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges spiegelt die individuelle Mobilität die Grundzüge der Moderne wieder. Als Folge dieser Omnipräsenz des Automobils wird das Pkw-affine Mobilitätsverhalten durch die Mobilitätssozialisation an Kinder und Jugendliche weitergegeben, wodurch auch für diese der Pkw einen hohen Stellenwert im menschlichen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozess einnimmt. Das Mobilitätsverhalten von Jugendlichen wird also schon im Elternhaus geprägt. Die Bedeutung des Pkw im jugendlichen Alter wird sowohl in der symbolischen Funktion, wie der Zugehörigkeit zu Peergroups oder der räumlichen Emanzipation von den Eltern aufgezeigt, als auch in der hohen Zahl der Führerscheinquote.
Es zeigt sich allerdings, dass sich inzwischen nicht nur in der Wissenschaft erste Zweifel an der zu Eingangs aufgestellten Aussage wiederfinden lassen, auch die Medien haben das Thema längst aufgegriffen: die Loslösung vom Automobil. Zwar beschränkt sich dieser Trend zunächst nur auf wenige gesellschaftliche Gruppen, jedoch bietet die Distanzierung von diesem einflussreichen technischen Artefakt Gründe für eine genauere Untersuchung. Die Rückläufigkeit der Ubiquität des Automobils lässt sich vor allem in der Lebenswelt der Jugendlichen nachweisen.
Alles in allem sind die Erklärungsansätze bis dato allerdings lückenhaft und nicht miteinander vergleichbar. Verschiedene Institute und Studien führen unterschiedliche Zahlen und Gründe an und stützen sich vor allem auf siedlungsstrukturelle und soziodemographische Erklärungsansätze. Des Weiteren existiert keine Einordnung des Mobilitätsverhaltens der untersuchten Jugendlichen in bestimmte Typen. Dabei ließe sich gerade durch eine Typenbildung herausfinden, welche Eigenschaften und Gründe die einzelnen Gruppen aufweisen die auf den Pkw verzichten und stattdessen auf den ÖPNV, das Fahrrad und die multimodalen Angebote zurückgreifen. Die vorliegende Arbeit greift den Aspekt der Typenbildung auf und versucht herauszufinden, inwiefern sich das Mobilitätsverhalten der Jugendlichen charakterisieren lässt und welche primären Gründe für dieses Verhalten verantwortlich sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Einführung in das Thema...
- 1.1. Untersuchungsgenstand – Mobilität, Mobilitätsverhalten und Jugendliche.
- 1.1.1. Mobilitätsverhalten........
- 1.1.2. Jugendliche und Mobilität.
- 1.2. Stand der Forschung
- 1.3. Ziele und Forschungsfrage
- 1.4. Methodischer Aufbau.......
- 2. Mobilität in Deutschland..\n
- 2.1. Das Automobil und die Gesellschaft.
- 2.2. Das Automobil in Deutschland ab dem Zweiten Weltkrieg.
- 2.3. Verkehrsinduzierte Umweltprobleme in (Groß-) Städten......
- 2.3.1. Klimawandel...
- 2.3.2. Luftverschmutzung
- 2.3.3. Lärm........
- 2.4. Verkehrsmaßnahmen in Städten zur Reduzierung von negativen\nUmweltauswirkungen durch den MIV\n
- 2.4.1. Multimodaler- und Intermodaler Verkehr
- 2.4.2. Mobilitätsmanagement .....
- 2.4.3. Städtische Siedlungsstrukturen als Voraussetzung umweltwirksamer\nMaßnahmen......
- 2.5. Mobilität von Jugendlichen
- 2.6. Trends im Mobilitätsverhalten bei Jugendlichen in Deutschland\nzu Anfang des 21. Jahrhunderts..........\n
- 2.6.1. Rückgang bei der Nutzung des Automobils
- 2.6.2. Jugendliche und Alternative Verkehrsangebote zum MIV
- 2.6.3. Smartphones .....
- 2.7. Verkehrsraum Hamburg
- 2.7.1. Bevölkerungsentwicklung in Hamburg.
- 2.7.2. Verkehrsangebot in Hamburg
- 2.7.2.1. ÖPNV........
- 2.7.2.2. Stadt Rad.
- 2.7.2.3. Car-Sharing-Angebote in Hamburg.
- 2.7.3. Mobilitätsverhalten Jugendlicher in Hamburg.
- 3. Mobilitätsverhalten...\n
- 3.1. Deterministische Ansätze zur Beschreibung des Mobilitätsverhaltens
- 3.2. Nichtdeterministische Ansätze..\n
- 3.2.1. Rational Choice.......
- 3.2.2. Psychoanalytischer Ansatz.
- 3.2.3. Soziodemographische Typologien........
- 3.2.4. Lebensstile und soziale Milieus.
- 3.2.5. Mobilitätsstile.....
- 3.3. Einstellungsbasierte Mobilitätstypen
- 3.4. Sozialpsychologische Handlungstheorien der der einstellungsbasierten\nMobilitätstypen
- 3.4.1. Die Theorie des geplanten Verhaltens
- 3.4.1.1. PMN - Perceived Mobility Necessities..\n
- 3.4.1.2. Norm-Aktivations-Theorie
- 3.4.1.3. Symbolische Einstellungsdimensionen
- 3.5. Einstellungsbasierte Mobilitätstypen bei Jugendlichen
- 4. Zwischenfazit..\n
- 5. Analyse des Mobilitätsverhaltens Hamburger Studierender.\n
- 5.1. Befragter Personenkreis.......
- 5.2. Untersuchungsgebiet..\n
- 5.3. Vorgehensweise .........\n
- 5.3.1. Erstellung des Fragebogens.
- 5.3.2. Auswertungsdesign des Fragebogens
- 5.4. Auswertung der empirischen Daten.....
- 5.4.1. Allgemeine Auswertung.
- 5.4.1.1. Herkunft der Studierenden
- 5.4.1.2. Wohnort der Studierenden .\n
- 5.4.2. These 1: Studierende die keinen Führerschein oder Pkw besitzen,\nwohnen tendenziell in der inneren Stadt....\n
- 5.4.3. These 2: Studierende greifen aufgrund des Wohnortes und\nden damit verbundenen Verkehrsangeboten auf\nAlternativen zum MIV zurück.....\n
- 5.4.4. These 3: Mitfahrgelegenheiten und Car-Sharing-Angebote\nmachen den Besitz eines eigenen Pkw überflüssig.\n
- 5.4.5. These 4: Der Nicht-Besitz von Pkw und Führerschein ist bei\nStudierenden vor allem auf die ökonomische Situation\nzurückzuführen\n
- 5.4.6. These 5: Das Smartphone wird für viele Hamburger Studierende\nals Statussymbolersatz für das Auto angesehen, wodurch\nNutzung und Anschaffung des Pkw sinken.\n
- Analyse des Mobilitätsverhaltens Jugendlicher in Großstädten
- Identifizierung von Trends im Mobilitätsverhalten
- Untersuchung der Faktoren, die das Mobilitätsverhalten beeinflussen
- Bewertung der Bedeutung von alternativen Verkehrsmitteln
- Beurteilung des Einflusses von Smartphones auf das Mobilitätsverhalten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht das veränderte Mobilitätsverhalten großstädtischer Jugendlicher und fokussiert dabei auf die Nutzung von alternativen Verkehrsmitteln und die Gründe für die Abkehr vom Auto. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Studie, die das Mobilitätsverhalten Hamburger Studierender beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Mobilität und Mobilitätsverhalten ein, beleuchtet den Forschungsstand und definiert die Ziele und Forschungsfrage der Arbeit. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Automobil in Deutschland und seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft, insbesondere in Großstädten. Es werden Verkehrsinduzierte Umweltprobleme und mögliche Lösungsansätze wie multimodaler und intermodaler Verkehr sowie Mobilitätsmanagement diskutiert. Weiterhin wird die Mobilität von Jugendlichen in Deutschland und Hamburg im Kontext des 21. Jahrhunderts beleuchtet. Kapitel 3 analysiert verschiedene Ansätze zur Beschreibung des Mobilitätsverhaltens, einschließlich deterministischer und nichtdeterministischer Modelle. Es werden sozialpsychologische Handlungstheorien vorgestellt, die das einstellungsbasierte Mobilitätsverhalten erklären. Kapitel 4 bietet ein Zwischenfazit der bisherigen Ergebnisse. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Studie, die das Mobilitätsverhalten Hamburger Studierender untersucht. Es werden verschiedene Thesen aufgestellt und anhand der erhobenen Daten überprüft.
Schlüsselwörter
Mobilitätsverhalten, Jugendliche, Großstädte, Automobil, Umweltprobleme, Verkehrsinduzierte Umweltprobleme, Mobilitätsmanagement, Multimodaler Verkehr, Intermodaler Verkehr, Alternative Verkehrsmittel, Smartphones, Empirische Studie, Hamburger Studierende.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert sich das Mobilitätsverhalten von Jugendlichen heute?
Es gibt einen Trend zur Loslösung vom eigenen Auto, besonders in Großstädten. Jugendliche nutzen verstärkt ÖPNV, Fahrräder und multimodale Angebote.
Welche Rolle spielt das Smartphone für die Mobilität?
Das Smartphone ersetzt für viele Jugendliche das Auto als Statussymbol und dient als wichtiges Werkzeug zur Nutzung flexibler Verkehrsangebote (Car-Sharing, Apps).
Was sind die Gründe für den Rückgang beim Autobesitz unter Studenten?
Neben ökonomischen Gründen spielen der Wohnort in der Innenstadt, Umweltbewusstsein und die Verfügbarkeit von Alternativen wie Car-Sharing eine zentrale Rolle.
Was versteht man unter "multimodaler Mobilität"?
Multimodalität bedeutet die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel innerhalb eines Zeitraums, um flexibel und effizient ans Ziel zu kommen.
Wie beeinflusst die Erziehung das Mobilitätsverhalten?
Die Mobilitätssozialisation im Elternhaus prägt oft die Pkw-Affinität, doch großstädtische Strukturen brechen diese Muster zunehmend auf.
- Quote paper
- Matthias Wiesrecker (Author), 2013, Identifizierung von Mobilitätstypen. Eine empirische Studie zum veränderten Mobilitätsverhalten großstädtischer Jugendlicher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323422