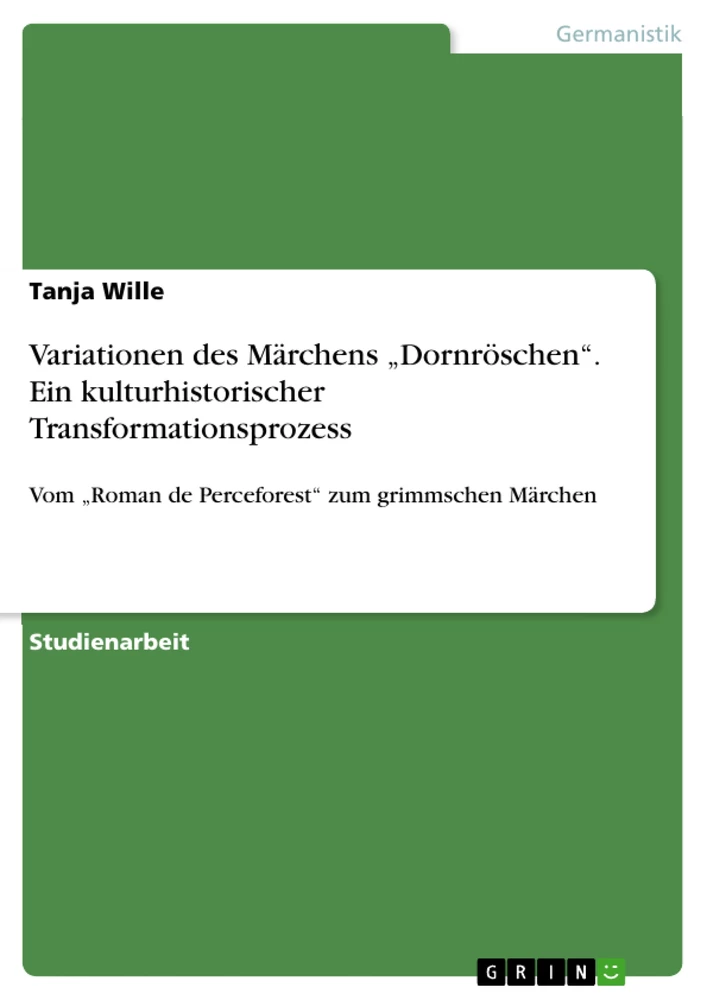Die vorliegende Arbeit soll die Entstehungsgeschichte der uns unter dem Namen „Dornröschen“ geläufigen Erzählung darlegen und den Einfluss des jeweiligen Zeitgeistes auf die narrative Struktur des Märchens vergleichend beschreiben. Ausgangspunkt bildet hierbei die erste schriftliche Quelle aus dem Jahr 1330, weiterhin werden das Märchen des neapolitanischen Dichters Giambattista Basile, „Sonne, Mond und Talia“, sowie die Geschichte „Die schlafende Schöne im Walde“ von Charles Perrault in die Betrachtung einbezogen.
Die Geschichte des „Dornröschen“ ist eines der populärsten Märchen unseres Kulturkreises. Die im Jahr 1812 im ersten Band der Grimmschen „Kinder- und Hausmärchen“ enthaltene Fassung stellt die in Deutschland bis heute bekannteste Überlieferung des Dornröschenstoffes dar.
Die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm begriffen die ihnen zugetragenen Märchen als durch das kollektive Gedächtnis oral tradierte Volkspoesie, welche Fragmente germanischer Mythologie enthält. Ihre Motivation für das Zusammentragen der Geschichten formulierten sie im Vorwort der im Jahr 1819 erschienenen zweiten Auflage folgendermaßen: „Es war vielleicht gerade Zeit, diese Mährchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden“. Viele der von den Grimms bearbeiteten und herausgegebenen Texte wurden jedoch bereits geraume Zeit vor dem Erscheinen ihrer Sammlung durch einzelne Autoren literarisiert, und auch die Grimms „hatten ihre Kinder- und Hausmärchen […] fast gänzlich am Schreibtisch komponiert“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Varianten des Märchens „Dornröschen“
- Entstehungsgeschichte – früheste Überlieferungen
- „Sonne, Mond und Talia“ – Giambattista Basile
- „Die schlafende Schöne im Walde" – Charles Perrault
- „Dornröschen“ – Jakob und Wilhelm Grimm
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entstehungsgeschichte des Märchens „Dornröschen“ und analysiert die verschiedenen Versionen des Stoffes, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Die Arbeit untersucht den Einfluss des jeweiligen Zeitgeistes auf die narrative Struktur des Märchens und zeigt, wie sich die Geschichte an die jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Normen angepasst hat.
- Die Entwicklung des Dornröschen-Motivs von der ersten schriftlichen Quelle aus dem 14. Jahrhundert bis zur Grimmschen Fassung
- Der Einfluss mittelalterlicher medizinischer Vorstellungen und der Angst vor dem Scheintod auf die Entstehung des Märchens
- Die Rolle der Gewalt und der Vergewaltigung in den frühen Versionen des Märchens
- Die Bedeutung des Zeitgeistes des Barock für die Version von Giambattista Basile
- Die Entwicklung des Märchens zu einer Kindergeschichte im 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik und stellt die Relevanz des Märchens „Dornröschen“ für die Kulturgeschichte dar. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Varianten des Märchens, beginnend mit der ersten schriftlichen Quelle, dem „Roman de Perceforest“ aus dem Jahr 1330. Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Motivs der schlafenden Schönen und die Rolle der Gewalt in den frühen Versionen des Märchens. Der dritte Abschnitt widmet sich der Version von Giambattista Basile „Sonne, Mond und Talia“, die im 17. Jahrhundert entstand. Hierbei wird der Einfluss des Barock auf die Gestaltung des Märchens beleuchtet. Die weiteren Kapitel befassen sich mit den Versionen von Charles Perrault und den Brüdern Grimm und analysieren die jeweiligen Veränderungen und Anpassungen des Stoffes an den jeweiligen Zeitgeist.
Schlüsselwörter
Dornröschen, Märchen, Entstehungsgeschichte, Varianten, Zeitgeist, Mittelalter, Barock, Roman de Perceforest, Sonne, Mond und Talia, Giambattista Basile, Charles Perrault, Brüder Grimm, Gewalt, Vergewaltigung, Scheintod, medizinische Vorstellungen, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Welche ist die älteste schriftliche Quelle des Dornröschen-Stoffes?
Die älteste Quelle ist der "Roman de Perceforest" aus dem Jahr 1330.
Wie unterscheidet sich die Fassung von Giambattista Basile von modernen Versionen?
Basiles "Sonne, Mond und Talia" (17. Jh.) ist durch den Zeitgeist des Barock geprägt und enthält deutlich gewalttätigere Elemente, wie die Vergewaltigung der schlafenden Protagonistin.
Welche Rolle spielten medizinische Vorstellungen bei der Entstehung des Märchens?
Mittelalterliche Vorstellungen über den Scheintod und medizinische Grenzphänomene beeinflussten das Motiv des hundertjährigen Schlafes maßgeblich.
Warum bearbeiteten die Brüder Grimm das Märchen so stark?
Die Grimms wollten Fragmente germanischer Mythologie bewahren, passten die Geschichten aber am Schreibtisch an die bürgerlichen Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts an, um sie als Kinderliteratur zu etablieren.
Was trug Charles Perrault zur Entwicklung von Dornröschen bei?
Perrault literarisierte den Stoff in Frankreich ("Die schlafende Schöne im Walde") und trug zur Popularisierung des Märchens in europäischen Adelskreisen bei.
- Citation du texte
- Tanja Wille (Auteur), 2010, Variationen des Märchens „Dornröschen“. Ein kulturhistorischer Transformationsprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323440