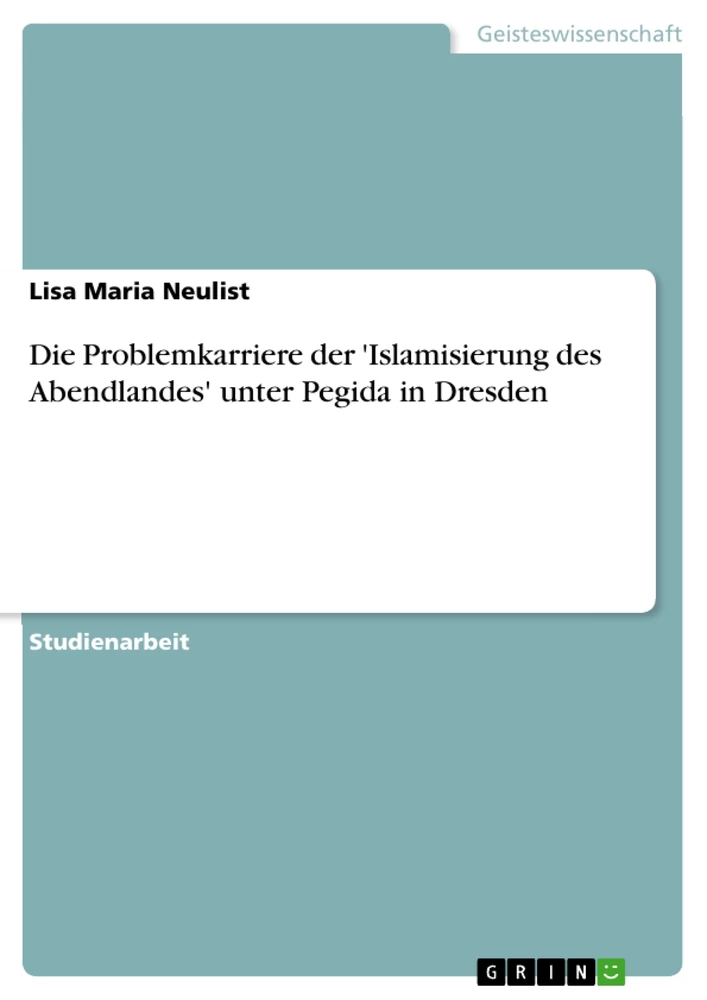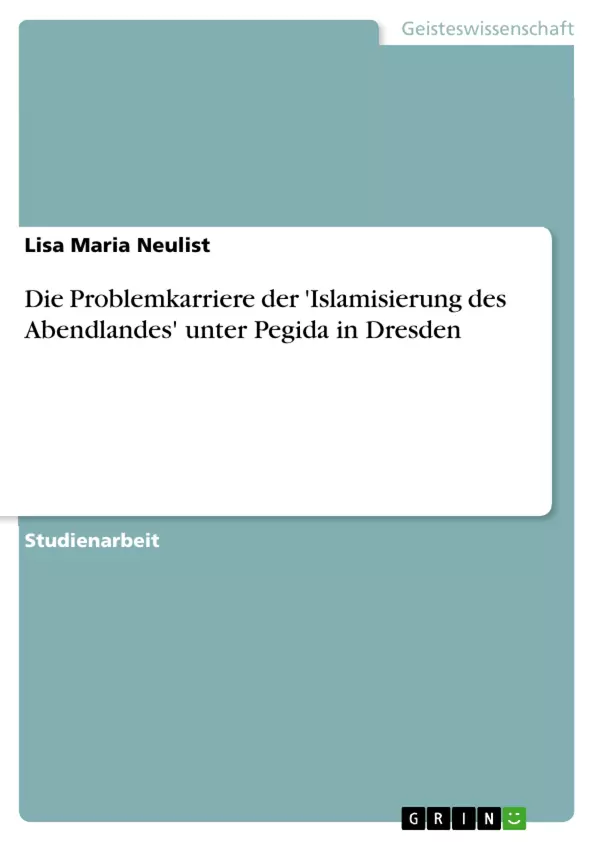In Dresden treibt es tausende Menschen auf die Straße, eine neue Bewegung, die Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes). Ziel der Bewegung ist eine Abgrenzung zu 'fremden Konflikten'.
Seit den Protesten bleibt die Frage offen, was die Bewegung genau will, wer die Akteure sind und wo das Problem ausgemacht werden kann. Die Akteure der Bewegung sehen die deutsche Kultur durch eine ‚Islamisierung‘ gefährdet. Schuld daran ist die Asylpolitik Deutschlands.
Es soll nicht die Frage dieser Arbeit sein, die deutsche Gesellschaft und Kultur auf eine Islamisierung hin zu untersuchen, geschweige denn eine positive oder negative Wertung für potentielle Prozesse zu konstatieren, da dies außerhalb von soziologischen Fragestellungen liegt.
Untersucht werden soll, wie eine solche Bewegung in einem Teil Deutschlands entstehen kann, in dem es so wenige Ausländer gibt. Wie konnte die ‚Islamisierung‘ zu einem Problem Deutschlands werden, ohne dass eine kollektive Übereinstimmung über einen Sachverhalt von Islamisierung vorhanden ist. Fragen sollen beantwortet werden, wie ob die ‚Islamisierung‘ oder die ‚Pegida‘ ein soziales Problem geworden sind und wer von der Problemkarriere des Sachverhalts eventuell profitiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Problemkarriere der 'Islamisierung des Abendlandes'
- Definition, soziales Problem'
- Problemkarriere und Phasenentwicklung der Pegida und der Islamisierung
- Der kollektive Akteur
- Die soziale Bewegung PEGIDA
- Die Problemnutzer
- Virtuelle Probleme am Beispiel Alien Abduction und Ritual Cult Abuse
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Pegida-Bewegung in Dresden, die die „Islamisierung des Abendlandes“ als Bedrohung für die deutsche Gesellschaft darstellt. Ziel ist es, die Problemkarriere dieses vermeintlichen Problems zu analysieren und zu verstehen, wie diese Bewegung in einer Region mit einer geringen Anzahl von Muslimen entstanden ist. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die „Islamisierung“ zu einem Problem in Deutschland wurde, obwohl es keinen Konsens über die Existenz eines islamistischen Problems gibt.
- Die Problemkarriere der „Islamisierung des Abendlandes“ als soziales Problem
- Die Rolle der Pegida-Bewegung in der Konstruktion des Problems
- Der Einfluss von Medien und Diskursstrategien auf die Problemwahrnehmung
- Die Bedeutung der Problemdeutung in der Entstehung sozialer Probleme
- Die Frage nach den Akteuren und Nutznießern der Problemkarriere
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Pegida-Bewegung in Dresden vor und beleuchtet die kontroverse Debatte um die „Islamisierung des Abendlandes“. Das zweite Kapitel behandelt die Definition und Entstehung sozialer Probleme. Dabei wird die Bedeutung der Problemkarriere und der Rolle des kollektiven Akteurs in der Konstruktion eines Problems erläutert. Das dritte Kapitel analysiert die Problemkarriere der „Islamisierung“ im Kontext der Pegida-Bewegung und untersucht die Strategien, die die Bewegung zur Verbreitung ihrer Problemdeutung nutzt. Das vierte Kapitel befasst sich mit virtuellen Problemen und zeigt am Beispiel von Alien Abduction und Ritual Cult Abuse, wie bestimmte Sachverhalte durch kollektive Akteure als Problem konstruiert werden können, ohne dass ein objektiver Konsens über ihre Existenz besteht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „Islamisierung“, „Problemkarriere“, „soziale Bewegung“, „kollektiver Akteur“, „Problemdeutung“, „Diskursstrategien“, „virtuelle Probleme“, „Pegida“, „Dresden“ und „Deutschland“. Die Arbeit analysiert die Konstruktion eines sozialen Problems und die Rolle der Pegida-Bewegung in diesem Prozess.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Pegida?
Pegida steht für „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“. Es ist eine soziale Bewegung, die Ende 2014 in Dresden entstand und gegen die deutsche Asylpolitik und eine vermeintliche Überfremdung protestiert.
Warum entstand Pegida ausgerechnet in Dresden?
Es ist paradox, dass die Bewegung in einer Region mit sehr geringem Ausländeranteil so stark wurde. Dies deutet darauf hin, dass die „Islamisierung“ eher als symbolisches Problem und Projektionsfläche für allgemeine Unzufriedenheit dient.
Wie wird ein Thema zu einem „sozialen Problem“?
Ein Thema wird dann zu einem sozialen Problem, wenn kollektive Akteure (wie Bewegungen oder Medien) einen Sachverhalt erfolgreich als bedrohlich definieren und eine öffentliche Debatte darüber erzwingen, unabhängig von objektiven Fakten.
Was sind „virtuelle Probleme“?
Virtuelle Probleme sind Sachverhalte, die durch Diskurse und Erzählungen als real empfundene Bedrohungen konstruiert werden, ohne dass es eine breite empirische Basis oder einen gesellschaftlichen Konsens über ihre Existenz gibt.
Wer profitiert von der „Problemkarriere“ der Islamisierung?
Von der Thematisierung profitieren politische Akteure am rechten Rand, die das Thema zur Mobilisierung nutzen, sowie Medien, die durch die Polarisierung Aufmerksamkeit generieren.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Lisa Maria Neulist (Author), 2015, Die Problemkarriere der 'Islamisierung des Abendlandes' unter Pegida in Dresden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323538