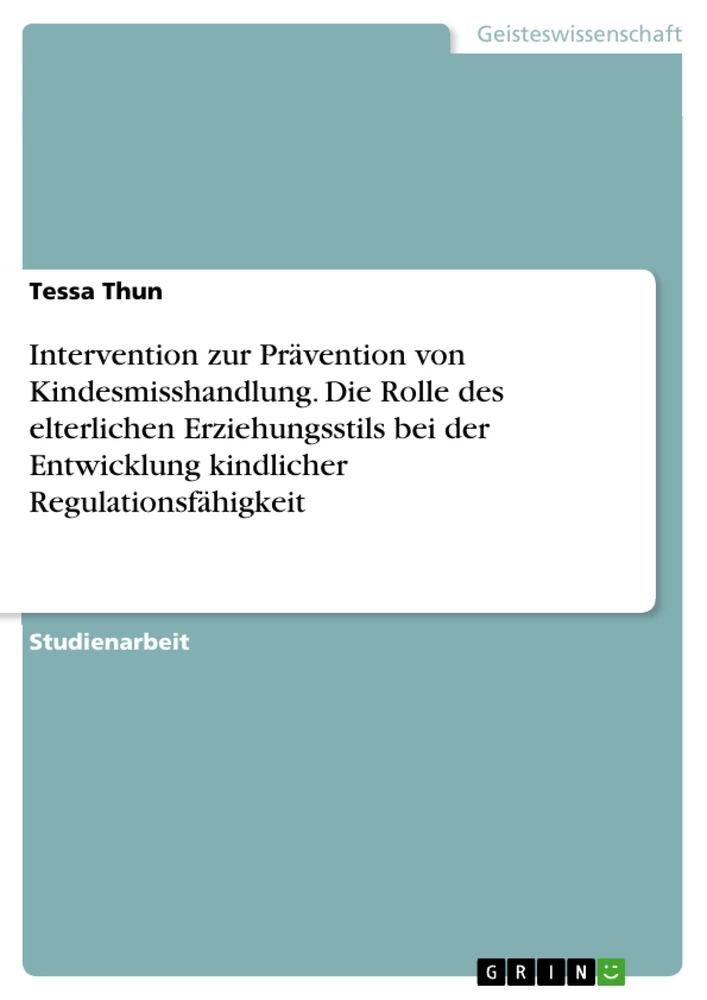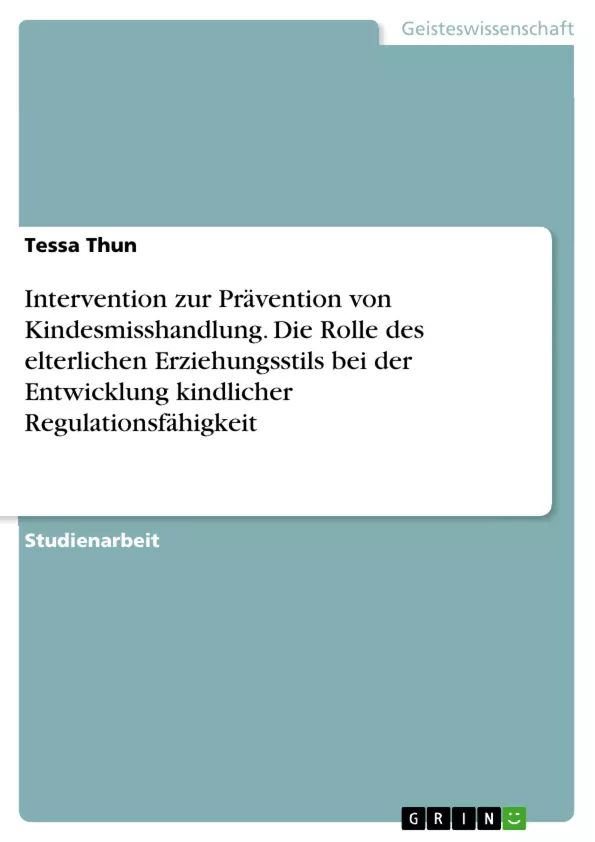Im Rahmen dieser Hausarbeit soll herausgearbeitet werden, welche Rolle der elterliche Erziehungsstil bei der Entwicklung kindlicher Regulationsfähigkeit spielt und ob Interventions- beziehungsweise Präventionsprogramme, welche am elterlichen Erziehungsverhalten und an elterlichen Problemlösestrategien ansetzen, eine gute Möglichkeit darstellen, Kindesmisshandlung vorzubeugen.
Nach Bast (1975) ist Kindesmisshandlung eine nicht zufällige, bewusste oder unbewusste gewaltsame seelische und/oder körperliche Beeinträchtigung oder Vernachlässigung des Kindes durch Eltern oder andere Erziehungspersonen, die das Kind schädigt, verletzt, in seiner Entwicklung hemmt oder sogar zum Tode führt. Unter Misshandlung fallen sowohl körperlicher, emotionaler und sexueller Missbrauch, als auch Vernachlässigung.
Im Gegensatz zu den jährlich angezeigten Fällen von Kindesmisshandlung unterhalb der Ein-Prozent-Grenze, sprechen retrospektive Befragungen von Jugendlichen und Erwachsenen hingegen für Lebenszeitprävalenzen von über zehn Prozent. Die begrenzte Anzeigebereitschaft und- fähigkeit der minderjährigen Opfer und ihrer Bezugspersonen führe zwangsläufig zu einer drastischen Untererfassung der Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen. Somit dürfte den Behörden die überwiegende Mehrzahl der Misshandlungs- und Vernachlässigungsfälle unbekannt bleiben.
Kindesmisshandlung- und vernachlässigung stellen allerdings hohe Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung und zudem sogar teilweise eine Todesursache im Kindes- und Jugendalter dar. Wie auch die in dieser Hausarbeit vorgestellten Artikel beschreiben, leiden betroffene Kinder und Jugendliche in der Folge an einer Bandbreite von psychischen-, Verhaltens- und interpersonalen Problemen. Wut, Feindseligkeit, Schuldgefühle, Scham, Angst und Depression sind häufig auftretende emotionale Reaktionen von Kindern, die Opfer von Misshandlung geworden sind. Wenn es zu Misshandlung durch die Eltern kommt, sei diese Beziehung erwartungsgemäß gestört. Misshandelte Kinder in dieser Untersuchung wiesen entsprechend ein höheres Maß an Reizbarkeit, emotionaler Labilität und internalisierenden Verhaltens auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Beschreibung der Studien
- 3. Allgemeine Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Prävention von Kindesmisshandlung und untersucht dabei die Rolle des elterlichen Erziehungsstils bei der Entwicklung kindlicher Regulationsfähigkeit.
- Definition und Häufigkeit von Kindesmisshandlung
- Negative Folgen von Kindesmisshandlung für die kindliche Entwicklung
- Die Bedeutung von Emotionsregulation für Kinder
- Der Einfluss des elterlichen Erziehungsstils auf die Entwicklung kindlicher Regulationsfähigkeit
- Präventionsmaßnahmen zur Förderung einer positiven Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung definiert Kindesmisshandlung und beleuchtet die hohe Dunkelziffer und die negativen Folgen für die kindliche Entwicklung. Sie unterstreicht die Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz.
2. Beschreibung der Studien
Dieses Kapitel stellt verschiedene Studien vor, die den Zusammenhang zwischen Kindesmisshandlung, elterlichem Erziehungsstil und der Entwicklung kindlicher Regulationsfähigkeit untersuchen. Die Studien beleuchten dabei die Auswirkungen von Misshandlung auf die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern und analysieren die Rolle der elterlichen Unterstützung und Sensitivität in diesem Kontext.
3. Allgemeine Diskussion
Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der vorgestellten Studien diskutiert und die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen hervorgehoben. Es werden verschiedene Ansätze zur Förderung einer positiven Entwicklung von Kindern vorgestellt, darunter Familienbasierte Interventionen und Elterntrainings, die die Erziehungskompetenz der Eltern verbessern sollen.
Schlüsselwörter
Kindesmisshandlung, Prävention, elterlicher Erziehungsstil, Regulationsfähigkeit, Emotionsregulation, Familienbasierte Interventionen, Elterntraining, Risikofaktoren, Schutzfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt der elterliche Erziehungsstil bei der Entwicklung kindlicher Regulationsfähigkeit?
Der elterliche Erziehungsstil, insbesondere Unterstützung und Sensitivität, ist entscheidend für die Entwicklung der Emotionsregulation bei Kindern. Ein Mangel an positiver Erziehung kann zu emotionaler Labilität und Reizbarkeit führen.
Wie wird Kindesmisshandlung in dieser Arbeit definiert?
Kindesmisshandlung wird als nicht zufällige, bewusste oder unbewusste gewaltsame seelische oder körperliche Beeinträchtigung oder Vernachlässigung definiert, die das Kind schädigt, verletzt oder in seiner Entwicklung hemmt.
Warum ist die Dunkelziffer bei Kindesmisshandlung so hoch?
Die begrenzte Anzeigebereitschaft und -fähigkeit der minderjährigen Opfer sowie ihrer Bezugspersonen führt dazu, dass die überwiegende Mehrzahl der Fälle den Behörden unbekannt bleibt.
Welche emotionalen Reaktionen zeigen misshandelte Kinder häufig?
Häufige Reaktionen sind Wut, Feindseligkeit, Schuldgefühle, Scham, Angst, Depression sowie ein höheres Maß an emotionaler Labilität.
Welche Präventionsmaßnahmen werden zur Vorbeugung von Kindesmisshandlung vorgeschlagen?
Vorgeschlagen werden familienbasierte Interventionen und Elterntrainings, die die Erziehungskompetenz und Problemlösestrategien der Eltern verbessern sollen.
- Quote paper
- Tessa Thun (Author), 2016, Intervention zur Prävention von Kindesmisshandlung. Die Rolle des elterlichen Erziehungsstils bei der Entwicklung kindlicher Regulationsfähigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323580