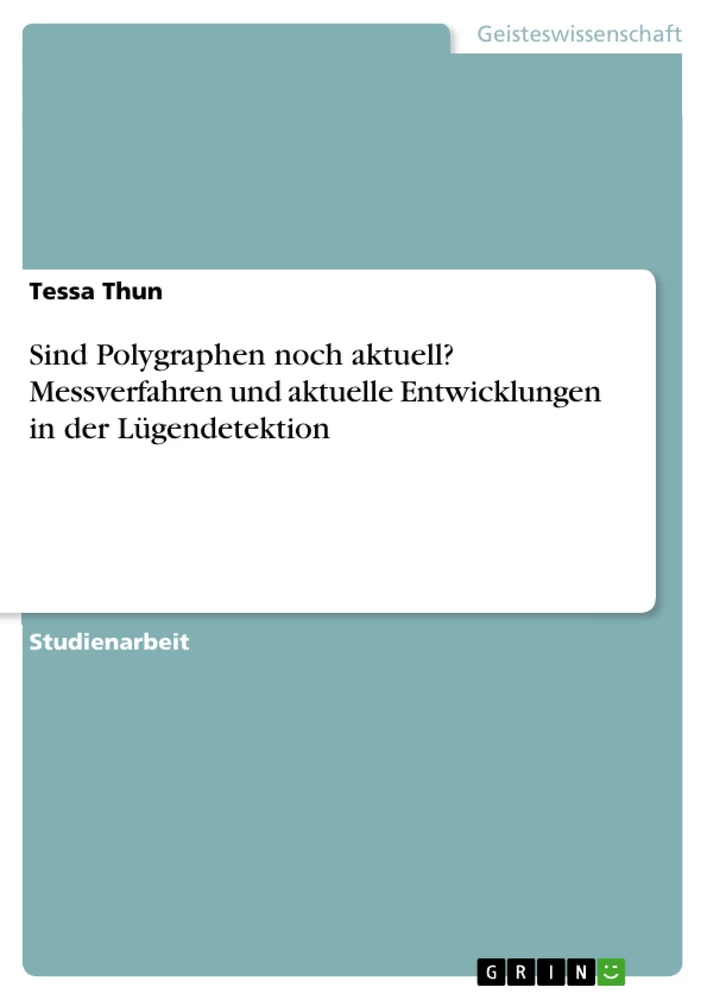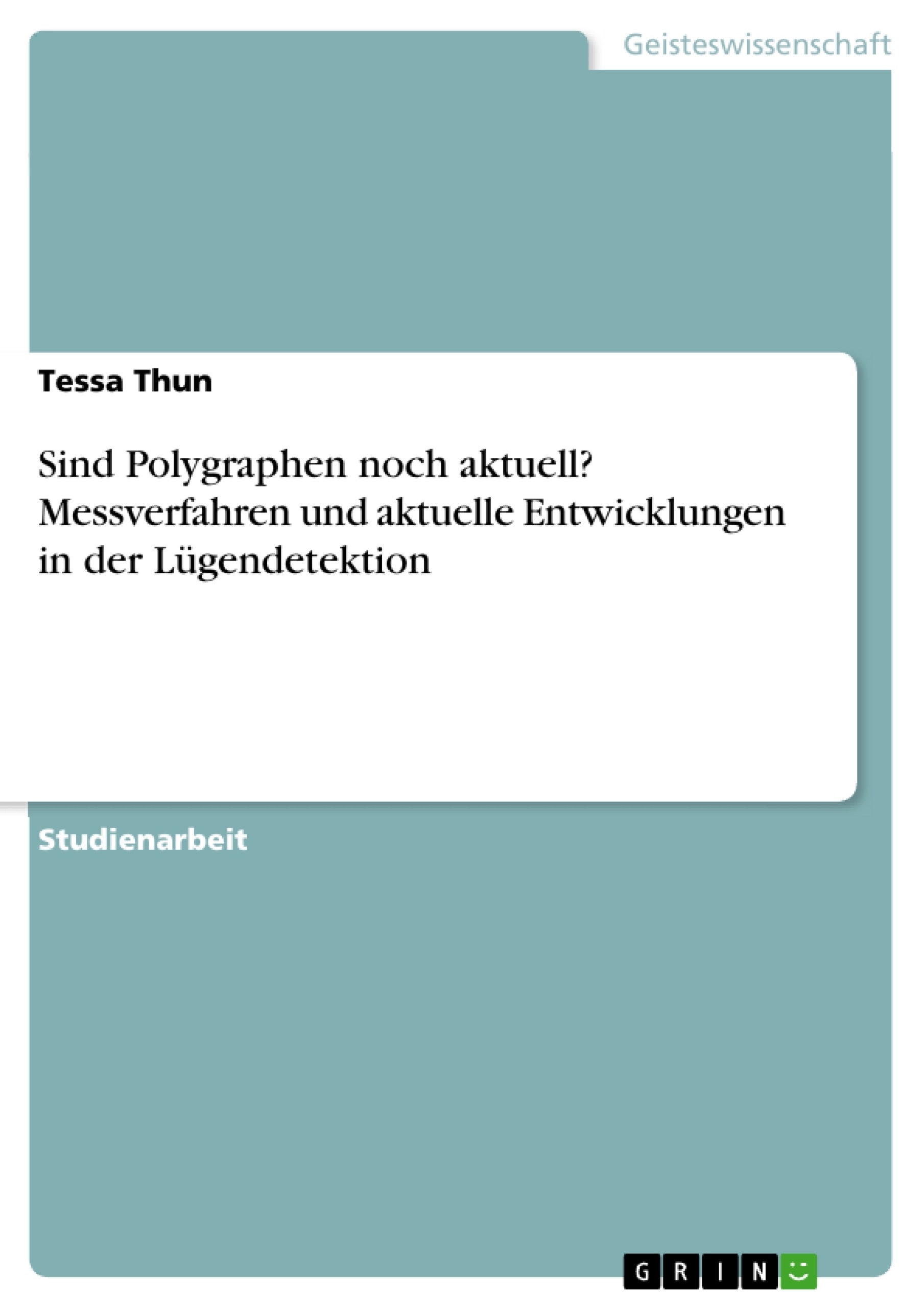Es handelt sich um ein Missverständnis, wenn im Volksmund oder in diversen Fernsehprogrammen von „Lügendetektion“ die Rede ist. Dieser Begriff vermittelt den Eindruck, es gäbe Geräte und Auswertungstechniken, welche in der Lage wären Lügen zu identifizieren, indem man die Körpereaktionen misst und diese dann zuordnet. Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es keine spezifische körperliche Reaktion auf eine Lüge gibt. Es stellt sich daher die Frage, ob Messwerte einer erhöhten körperlichen Reaktion tatsächlich im Zusammenhang mit der gestellten Frage stehen.
Mit der Beurteilung einer Täterschaft ist wesentlich mehr verbunden als die Auswertung der Registrierkurve, die von einem Gerät ausgespuckt wird. Es geht um eine durchdachte Befragungstechnik, Experten, welche die Beurteilung menschlichen Verhaltens vornehmen, und inzwischen auch um neuere Methoden der Messung körperlicher Reaktionen, welche unter anderem die Gehirnaktivität hinzuzieht. Schlüsse über das Individuum und seine individuellen Reaktionen können nur dann gezogen werden, wenn die entsprechenden Werte jener Person miteinander verglichen werden, denn es gibt keine allgemeingültige Regel, welche körperlich messbaren Reaktionen ein „Lügender“ zeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte des Lügendetektors
- Messverfahren der Lügendetektion – die klassische Polygraphie
- Physiologische Maße
- Befragungstechnik
- Auswertung polygraphischer Tests im Bezug auf die Befragungstechnik
- Aktuelle Entwicklungen
- Messung zentralnervöser Veränderungen
- Heutige Anwendung
- Studie
- Hypothesen
- Methode
- Ergebnisse
- Diskussion zur Studie
- Diskussion
- Klassische Polygraphie zur Täterbeurteilung? Sollten Lügendetektoren auch in Deutschland als Beweismittel zugelassen werden?
- Schutz vor Terrorismus oder Eingriff in die Privatsphäre?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte und die aktuellen Methoden der Lügendetektion, insbesondere die klassische Polygraphie. Sie beleuchtet die physiologischen Messverfahren und deren Grenzen sowie die Bedeutung der Befragungstechnik. Weiterhin werden aktuelle Entwicklungen und die ethischen Implikationen der Anwendung von Lügendetektoren diskutiert.
- Die Geschichte und Entwicklung des Lügendetektors
- Die physiologischen Messverfahren der klassischen Polygraphie (Atmung, Hautleitfähigkeit, Blutdruck)
- Die Rolle der Befragungstechnik bei der Aussagebeurteilung
- Aktuelle Entwicklungen in der Lügendetektion (zentralnervöse Veränderungen)
- Ethische und rechtliche Aspekte des Einsatzes von Lügendetektoren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung verdeutlicht, dass der Begriff "Lügendetektion" irreführend ist, da keine spezifische körperliche Reaktion auf eine Lüge existiert. Statt dessen wird der Fokus auf die "Psychophysiologische Aussagebeurteilung" gelegt, welche die Auswertung physiologischer Reaktionen in Verbindung mit einer durchdachten Befragungstechnik beinhaltet. Der Text betont die Bedeutung individueller Unterschiede und die Notwendigkeit, Messwerte im Kontext des individuellen Reaktionsmusters zu interpretieren. Die Unzulänglichkeit einer rein technischen Betrachtung wird hervorgehoben und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes unter Einbezug von Expertenwissen betont.
Geschichte des Lügendetektors: Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung des Lügendetektors nach, beginnend mit Lombrosos Entdeckung des Zusammenhangs zwischen Lüge und Pulsfrequenz. Es beschreibt die Beiträge von Jung und Wertheimer, die Entwicklung des ersten Lügendetektors durch Benussi und die Experimente Keelers mit dem klassischen Polygraphen. Der Text beleuchtet auch die juristische Geschichte des Lügendetektors in Deutschland, insbesondere das Verbot seiner Verwendung als Beweismittel im Strafverfahren. Der Fokus liegt auf der Evolution der Technologie und der unterschiedlichen Bewertungen verschiedener Befragungstechniken.
Messverfahren der Lügendetektion - die klassische Polygraphie: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die physiologischen Maße, die in der klassischen Polygraphie verwendet werden: Atmung, Hautleitfähigkeit und Blutdruck. Für jedes Maß werden die Messmethoden, die zugrundeliegenden physiologischen Prozesse und die jeweiligen Limitationen (z.B. die Willkürlichkeit der Atmungskontrolle) ausführlich erläutert. Der Text verweist auf relevante Forschungsliteratur und diskutiert kritisch die Interpretation der Messergebnisse, wobei die Komplexität und die noch nicht vollständig erforschten Aspekte der elektrodermalen Aktivität hervorgehoben werden. Die Beschreibung der Blutdruckmessung nach Riva-Rocci inkludiert auch die Erläuterung des Verfahrens zur Vermeidung von Störfaktoren.
Schlüsselwörter
Lügendetektion, Polygraphie, Psychophysiologische Aussagebeurteilung, physiologische Messverfahren, Hautleitfähigkeit, Blutdruck, Atmung, Befragungstechnik, Täterbeurteilung, Beweismittel, ethische Aspekte, Terrorismus, Privatsphäre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Lügendetektion
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Lügendetektion, insbesondere der klassischen Polygraphie. Sie untersucht die Geschichte, die Methoden, die physiologischen Messverfahren, die Befragungstechniken und die ethischen Implikationen der Lügendetektion. Ein besonderer Fokus liegt auf den Grenzen der Methode und der kritischen Auseinandersetzung mit ihrer Anwendung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte des Lügendetektors, die physiologischen Messverfahren der klassischen Polygraphie (Atmung, Hautleitfähigkeit, Blutdruck), die Bedeutung der Befragungstechnik, aktuelle Entwicklungen in der Lügendetektion (zentralnervöse Veränderungen), und die ethischen und rechtlichen Aspekte des Einsatzes von Lügendetektoren. Die Arbeit beinhaltet auch eine eigene Studie mit Hypothesen, Methode, Ergebnissen und Diskussion.
Welche Methoden der Lügendetektion werden beschrieben?
Im Mittelpunkt steht die klassische Polygraphie mit ihren drei Hauptmessverfahren: Atmung, Hautleitfähigkeit und Blutdruck. Die Arbeit beschreibt detailliert die Messmethoden, die zugrundeliegenden physiologischen Prozesse und die jeweiligen Limitationen. Zusätzlich werden aktuelle Entwicklungen wie die Messung zentralnervöser Veränderungen angesprochen.
Welche Rolle spielt die Befragungstechnik?
Die Befragungstechnik spielt eine entscheidende Rolle, da die Interpretation der physiologischen Messwerte im Kontext der Befragung erfolgen muss. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer durchdachten Befragungstechnik und deren Einfluss auf die Aussagebeurteilung.
Welche ethischen und rechtlichen Aspekte werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die ethischen und rechtlichen Implikationen des Einsatzes von Lügendetektoren, einschließlich der Frage nach der Zulassung als Beweismittel in Deutschland und dem Abwägen von Sicherheitsinteressen (z.B. Terrorismusbekämpfung) gegen den Schutz der Privatsphäre.
Gibt es eine eigene Studie in der Arbeit?
Ja, die Arbeit beinhaltet eine eigene Studie mit Hypothesen, Methode, Ergebnissen und einer ausführlichen Diskussion der Ergebnisse.
Ist der Begriff "Lügendetektion" treffend?
Die Arbeit argumentiert, dass der Begriff "Lügendetektion" irreführend ist, da keine spezifische körperliche Reaktion auf eine Lüge existiert. Stattdessen wird der Begriff "Psychophysiologische Aussagebeurteilung" präferiert, der den Fokus auf die Auswertung physiologischer Reaktionen im Kontext einer gezielten Befragung legt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lügendetektion, Polygraphie, Psychophysiologische Aussagebeurteilung, physiologische Messverfahren, Hautleitfähigkeit, Blutdruck, Atmung, Befragungstechnik, Täterbeurteilung, Beweismittel, ethische Aspekte, Terrorismus, Privatsphäre.
Welche historischen Aspekte werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Lügendetektors von Lombroso bis zu Keeler, inklusive der Entwicklung der Technologie und der verschiedenen Befragungstechniken. Sie berücksichtigt auch die juristische Geschichte des Lügendetektors in Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Tessa Thun (Autor:in), 2013, Sind Polygraphen noch aktuell? Messverfahren und aktuelle Entwicklungen in der Lügendetektion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323582