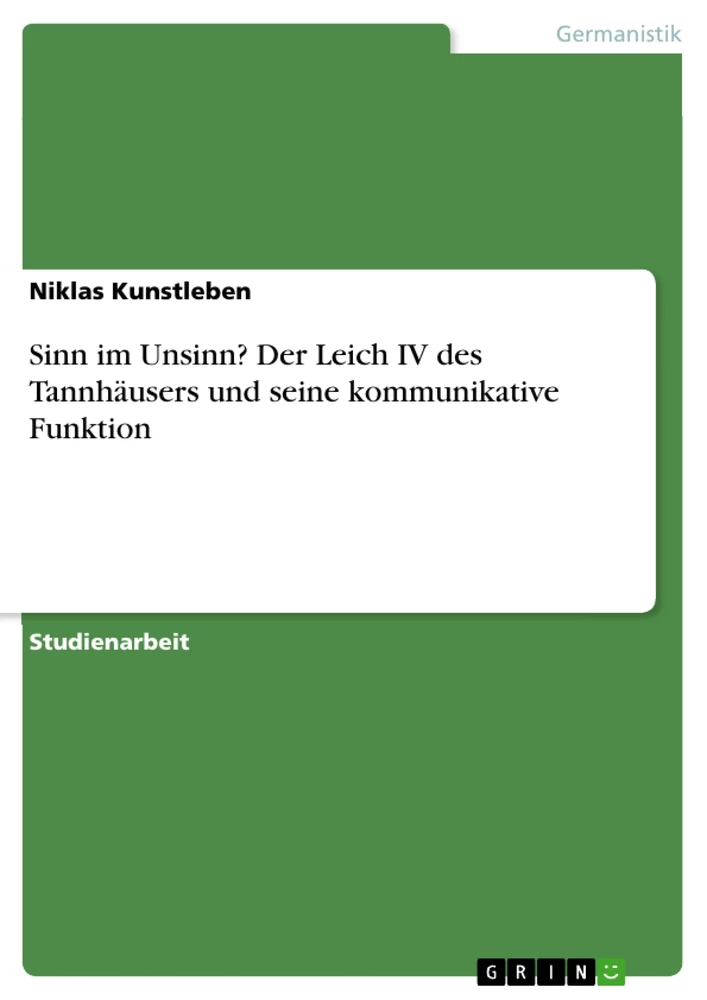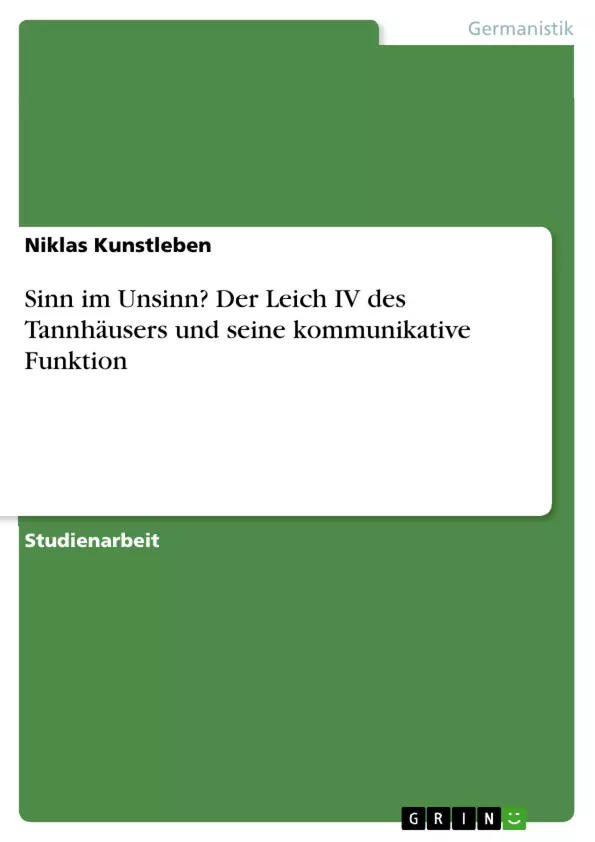„Der Tannhäuser, ein ‚Postmodernist‘ des 13. Jahrhunderts?“ Auch wenn Zuschreibungen zu dieser diffusen Epoche zur Farce avancieren, deutet Jürgen Kühnels zuletzt unbeantwortete Frage auf einen Wandel in der Rezeption des Tannhäusers hin. Viele Jahre als uninspirierter Minnesänger abgetan, erlebte sein Oeuvre eine Revision, die Bewertung seiner lyrischen Qualität eine Expansion. So beweist die neue Forschung seine literarische Legitimität – die Daseinsberechtigung eines Tannhäusers abseits der gleichnamigen Legende.
Diese Arbeit reiht sich in diesen Diskurs ein und zeigt anhand einer Untersuchung des Leich IV die literarischen Dimensionen der Tannhäuser-Dichtung auf. Dabei wird auf Grundlage der Thesen von Claudia Händl und Thomas Cramer versucht, dem ersten „Nonsens-Gedicht“ der deutschen Literatur einen kommunikativen Sinn zuzuschreiben.
Kapitel 2.1 schafft zunächst ein Grundlagenwissen über den historischen Tannhäuser. Diese Ausführungen stützen sich dabei auf die Thesen von Johannes Siebert – wobei sein Biographie-Versuch methodische Kritik zulässt und viele Eckdaten nicht wissenschaftlich bewiesen sind. Trotzdem soll eine verkürzte Darstellung seiner Hauptthesen zur Einleitung und zum Verständnis der folgenden Untersuchung dienen. Dabei gibt Kapitel 2.2 zunächst einen groben Überblick über das Oeuvre sowie die Rezeption des Tannhäuser. Kapitel 3. versucht eine definitorische Grundlage des ‚Leich‘-Begriffs zu geben, dieser wird dabei explizit auf den Tanzleich, wie wir ihn beim Tannhäuser finden, ausgerichtet. Mit Kapitel 3.1 beginnt die Untersuchung des Leich IV, zunächst mit einem Fokus auf die Thesen von Händl: Hier steht das vorgestellte fröide-Konzept im Zentrum der Analyse. Kapitel 3.2 erweitert daraufhin die interpretatorische Dimension um die Überlegungen von Cramer, die eine Sprachkritik im Text vermuten. Im Fazit werden die Ergebnisse zusammengefasst und resümiert, inwieweit der Leich IV trotz unterstelltem Unsinn doch kommunikativen Sinn besitzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Tannhäuser
- Tannhäuser: Leben
- Tannhäuser: Wirken und Rezeption
- Leich IV:,Leich‘-Begriff
- Leich IV: Aktualisierung des fröide-Konzepts
- Leich IV: Kritik an der Sprache
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Leich IV des Tannhäusers hinsichtlich seiner kommunikativen Funktion und reiht sich damit in den Diskurs über die literarische Legitimität des Tannhäuser ein. Ziel ist es, dem ersten „Nonsens-Gedicht“2 der deutschen Literatur einen kommunikativen Sinn zuzuschreiben und damit die literarischen Dimensionen der Tannhäuser-Dichtung aufzuzeigen.
- Die historische Rekonstruktion des Dichters Tannhäuser
- Die literarische Qualität des Oeuvres des Tannhäusers
- Die Aktualisierung des fröide-Konzepts im Leich IV
- Die Sprachkritik im Leich IV
- Die kommunikative Funktion des Leich IV
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2.1 bietet eine kurze Darstellung des prominentesten Versuchs einer biographischen Rekonstruktion des Tannhäusers, angestellt von Johannes Siebert. Kapitel 2.2 gibt einen Überblick über das Oeuvre sowie die Rezeption des Tannhäusers. Kapitel 3. versucht eine definitorische Grundlage des ,Leich‘-Begriffs zu geben. Kapitel 3.1 analysiert den Leich IV mit einem Fokus auf die Thesen von Händl, die das fröide-Konzept in den Mittelpunkt rücken. Kapitel 3.2 erweitert die interpretatorische Dimension um die Überlegungen von Cramer, die eine Sprachkritik im Text vermuten.
Schlüsselwörter
Tannhäuser, Leich IV, fröide-Konzept, Sprachkritik, kommunikative Funktion, Minnesang, Nonsens-Gedicht, deutsche Literatur, historische Rekonstruktion, literarische Legitimität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Leich IV“ des Tannhäusers?
Der Leich IV gilt als das erste „Nonsens-Gedicht“ der deutschen Literatur und wird in dieser Arbeit auf seine kommunikative Funktion hin untersucht.
Welches Ziel verfolgt die Untersuchung der Tannhäuser-Dichtung?
Ziel ist es, dem vermeintlichen „Unsinn“ im Text einen tieferen kommunikativen Sinn zuzuschreiben und die literarische Legitimität des Tannhäusers aufzuzeigen.
Was besagt das „fröide-Konzept“ im Kontext dieser Arbeit?
Das fröide-Konzept, basierend auf Thesen von Claudia Händl, steht im Zentrum der Analyse zur Aktualisierung höfischer Werte im Leich IV.
Wird in dem Gedicht Kritik an der Sprache geübt?
Ja, die Arbeit bezieht Überlegungen von Thomas Cramer ein, die eine Sprachkritik hinter den scheinbar unsinnigen Formulierungen des Textes vermuten.
Wer war der historische Tannhäuser?
Das Dokument liefert Grundlagen zum Leben und Wirken des Dichters, wobei es sich unter anderem auf die (methodisch teils kritisierte) Biographie von Johannes Siebert stützt.
- Quote paper
- Niklas Kunstleben (Author), 2016, Sinn im Unsinn? Der Leich IV des Tannhäusers und seine kommunikative Funktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323658