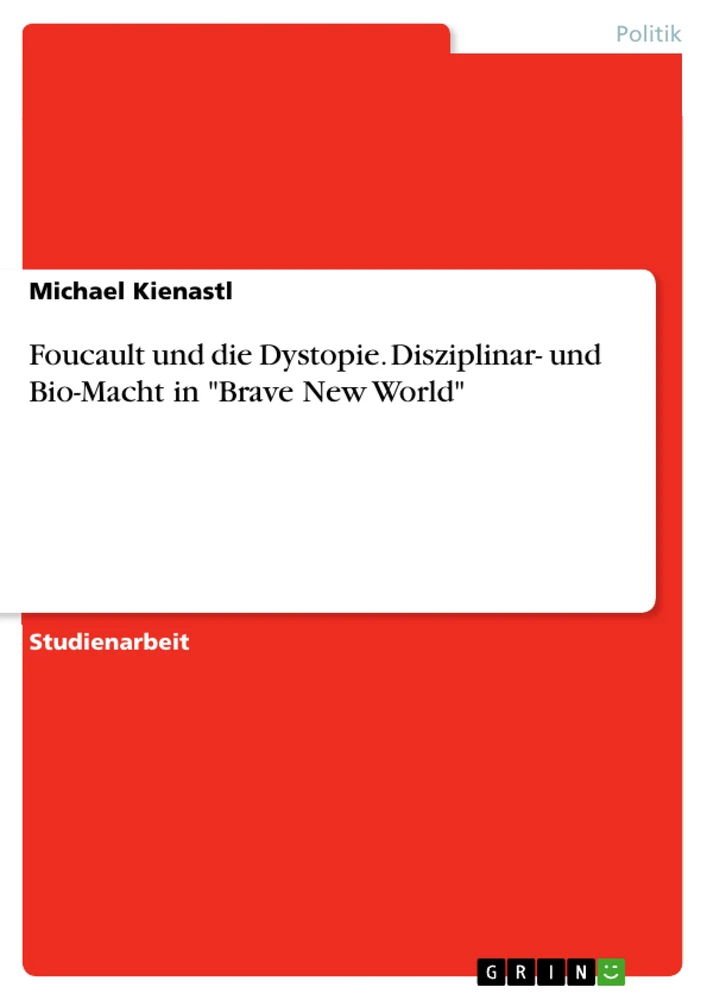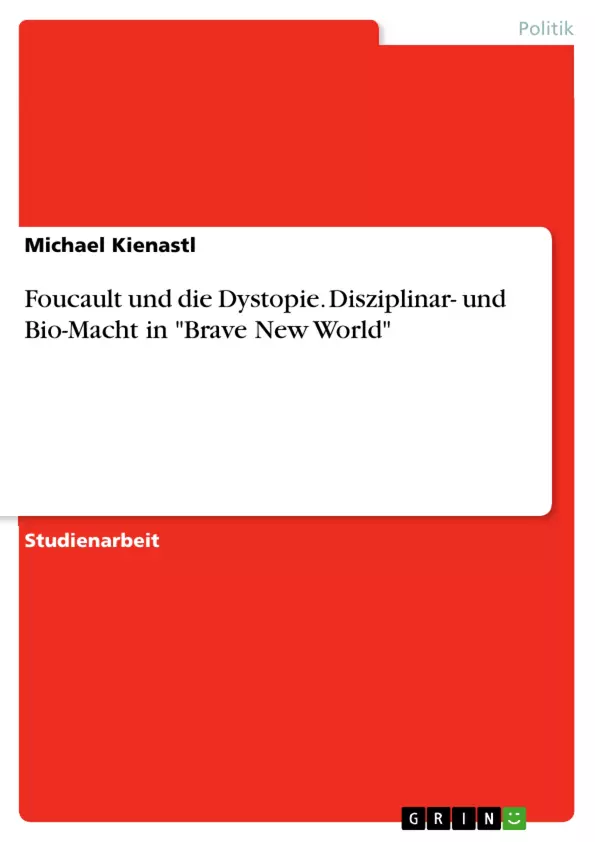„Jahrtausende hindurch ist der Mensch das geblieben, was er für Aristoteles war: ein lebendes Tier, das auch einer politischen Existenz fähig ist. Der moderne Mensch ist ein Tier, in dessen Politik sein Leben als Lebewesen auf dem Spiel steht“ (Foucault 1995: 171). Dieses Zitat des französischen Philosophen Michel Foucault verkehrt das bekannte Aristotelische Postulat vom Menschen als zoon politikon, als soziales, politisches Wesen zur Erreichung des größtmöglichen Glücks, in sein Gegenteil und stellt die Politik als absolute Lebensnotwendigkeit in den Mittelpunkt des menschlichen Daseins.
Foucault kommt zu diesem Schluss, weil „das Leben relativ beherrschbar geworden ist und die Optimierung dieser Beherrschung des Lebens zum Gegenstand der Politik geworden ist“ (Heidenreich 2005: 113). Dies ist das Resultat seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit in den letzten Jahren seines Lebens, also den späten 1970er Jahren. Zentral war hier die Definition der verschiedenen Spielarten der Macht. Foucault zeigte, dass aus der bis zur frühen Neuzeit typischen Souveränitätsmacht, realhistorisch und im Sinne Thomas Hobbes‘ Leviathans, die Disziplinarmacht, für welche er auch den Begriff des Panoptismus verwandte, und später die Bio-Macht, entstanden.
Diese Konzepte, für welche u.a. seine Werke „Überwachen und Strafen“, „Der Wille zum Wissen“, sowie seine in Buchform unter dem Titel „In Verteidigung der Gesellschaft“ herausgegebenen Vorlesungen am Collège de France 1975/76 exemplarisch stehen, sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Jedoch sollen diese Konzepte nicht im luftleeren Raum analysiert werden. Mitentwickler des Transhumanismus war vor einigen Jahrzehnten der Biologe und Eugeniker Julian Huxley. Eben dieser war der Bruder des Schriftstellers Aldous Huxley, welcher mit seinem dystopischen Roman „Brave New World“ in den 1930er Jahren ein grauenhaftes Zukunftsszenario erstellte.
Die zu beantwortende Frage lautet also: Wie und wo finden sich Foucaults Konzepte der Disziplinar- und Bio-Macht im Kastensystem von „Brave New World“ wieder? Hierzu sollen im Folgenden zuerst die beiden Konzepte der Macht einzeln vorgestellt werden, worauf eine kurze Darstellung des Kastensystems in „Brave New World“ folgt, um schlussendlich beides zusammenzuführen und zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Disziplinierung und Panoptismus
- Regulierung und Bio-Macht
- Das Kastensystem in Brave New World
- Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Anwendung der von Michel Foucault entwickelten Machtkonzepte der Disziplinar- und Bio-Macht im dystopischen Roman „Brave New World" von Aldous Huxley. Im Zentrum der Betrachtung steht das Kastensystem in „Brave New World" und die Frage, wie dieses System die Foucaultschen Machtkonzepte in die Praxis umsetzt.
- Disziplinar- und Bio-Macht nach Foucault
- Das Kastensystem in „Brave New World“
- Die Anwendung von Disziplinar- und Bio-Macht im Kastensystem
- Die Bedeutung der Eugenik und Dysgenik für die Machtstrukturen
- Die Bedeutung von „Brave New World“ für die aktuelle Debatte um Transhumanismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Foucaults Konzept der Macht und die Bedeutung seiner Werke für die Analyse von „Brave New World“ dar. Es wird die Verbindung zwischen den Machtkonzepten und der aktuellen Debatte um Transhumanismus hergestellt.
- Disziplinierung und Panoptismus: Dieses Kapitel erläutert Foucaults Konzept der Disziplinar- und Panoptismus-Macht, basierend auf seinem Werk „Überwachen und Strafen“. Es werden die Entstehung dieser Machtformen aus der Souveränitätsmacht und ihre Anwendung in Gefängnissen, Schulen und Fabriken beschrieben.
- Regulierung und Bio-Macht: Dieses Kapitel befasst sich mit Foucaults Bio-Macht, welche sich auf die Steuerung und Kontrolle der menschlichen Lebensformen fokussiert. Es werden die verschiedenen Spielarten der Bio-Macht und ihre Verbindung zum Konzept der Eugenik erörtert.
- Das Kastensystem in Brave New World: Dieses Kapitel stellt das Kastensystem in Aldous Huxleys Roman „Brave New World“ vor und beschreibt die Mechanismen der Eugenik und Dysgenik, die zur Schöpfung dieser Klassen beitragen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Disziplinar- und Bio-Macht, Panoptismus, Eugenik, Dysgenik, Kastensystem, Transhumanismus, dystopische Literatur und „Brave New World". Die Forschungsarbeiten von Michel Foucault und Aldous Huxley bilden die Grundlage der Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Foucault unter "Bio-Macht"?
Bio-Macht bezeichnet eine Machtform, die nicht mehr nur durch Strafen droht, sondern das Leben der Bevölkerung durch Regulierung, Gesundheitspolitik und Eugenik optimiert und kontrolliert.
Wie spiegelt sich Disziplinarmacht in "Brave New World" wider?
Durch das Kastensystem und die Konditionierung der Menschen von der "Flasche" an wird jeder Einzelne perfekt in seine soziale Rolle eingegliedert (Panoptismus).
Was ist der Unterschied zwischen Eugenik und Dysgenik?
Eugenik zielt auf die "Verbesserung" des Erbguts (höhere Kasten), während Dysgenik die gezielte Verschlechterung (z.B. durch Sauerstoffentzug bei den Epsilon-Kasten) beschreibt.
Was bedeutet das Zitat vom Menschen als "Tier, in dessen Politik sein Leben auf dem Spiel steht"?
Foucault meint damit, dass der moderne Mensch zum Objekt politischer Steuerung geworden ist, wobei seine biologische Existenz das zentrale Feld der Machtausübung darstellt.
Welche Rolle spielt Transhumanismus in dieser Analyse?
Die Arbeit zieht Parallelen zwischen Huxleys Dystopie und aktuellen transhumanistischen Bestrebungen, den Menschen technologisch und biologisch zu optimieren.
- Citation du texte
- Michael Kienastl (Auteur), 2016, Foucault und die Dystopie. Disziplinar- und Bio-Macht in "Brave New World", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323705