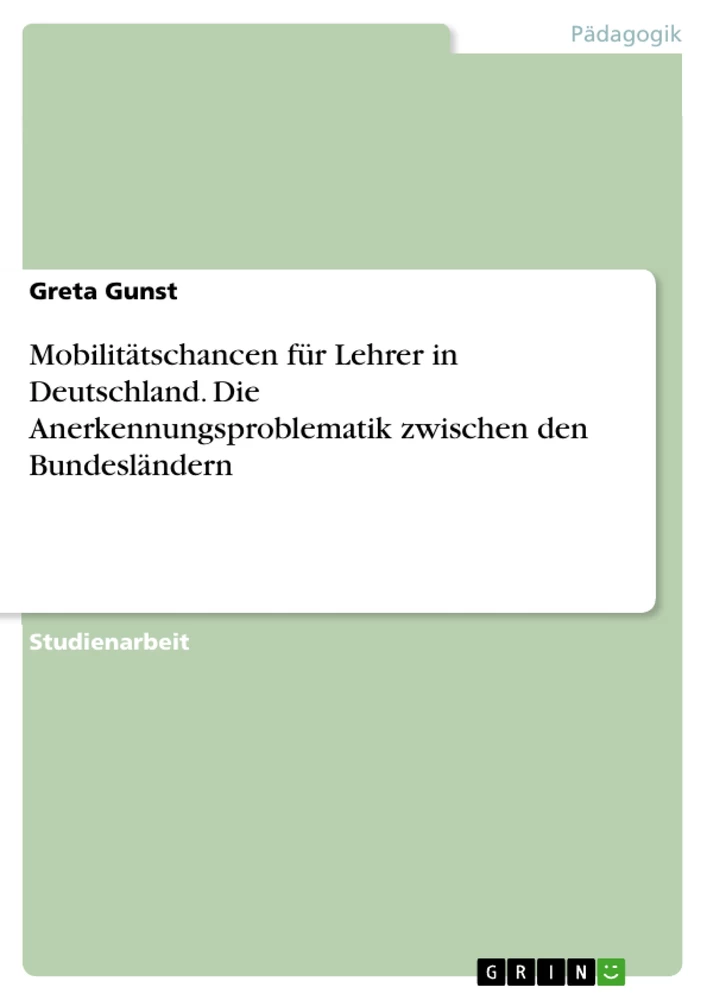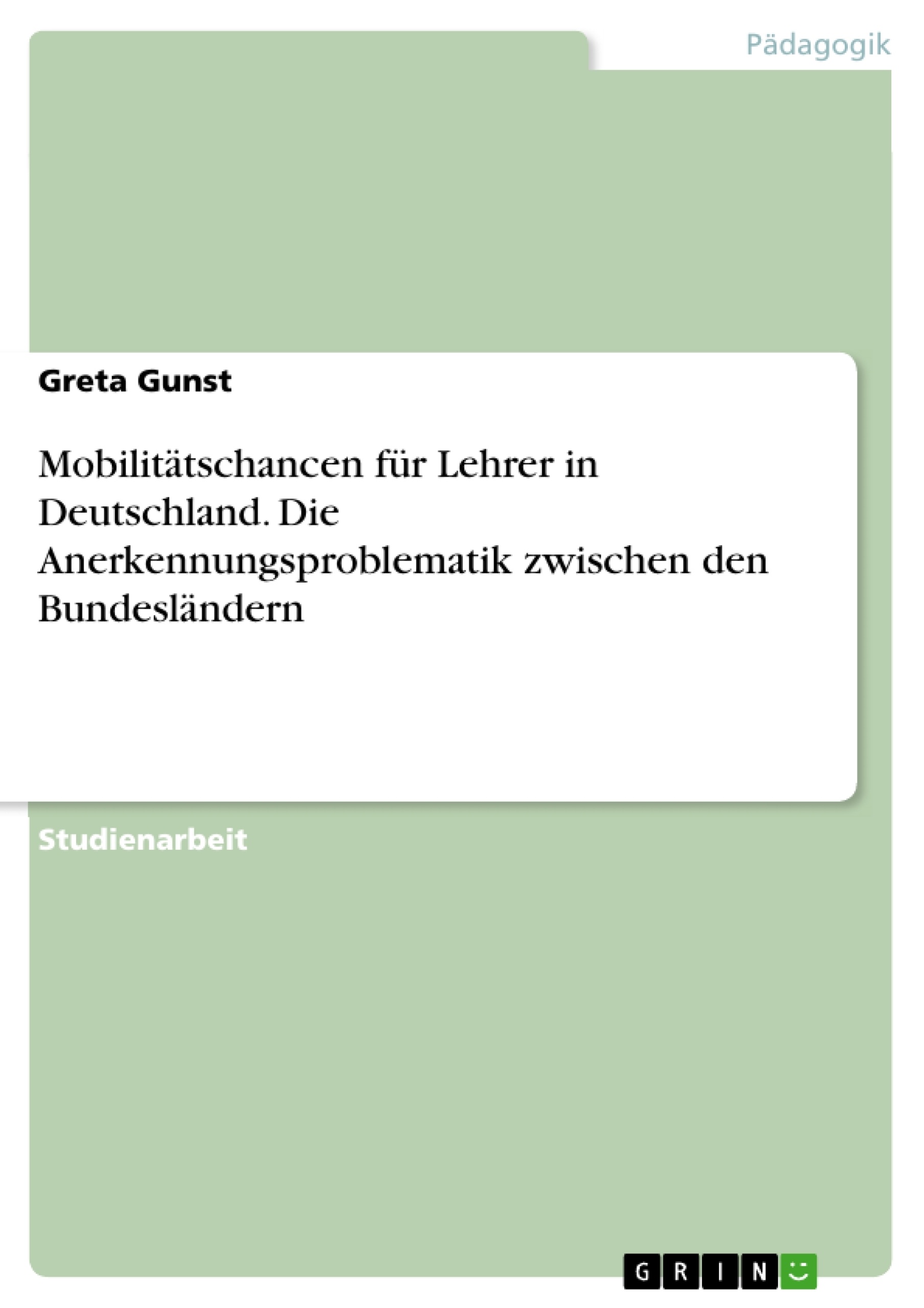Diese Arbeit versucht aufzuzeigen, wie sich die Regelungen der Kultusminister Konferenz von 1989 bis heute geändert haben und Rückschlüsse auf die Mobilität der Lehrer in Deutschland zu ziehen. Um das zu verdeutlichen geht das Schreiben auf manche Regelungen unterschiedlicher Bundesländer ein umso die großen Gefälle zwischen ihnen zu zeigen. In dem ersten Teil wird ein kurzer Überblick über die Vielfältigkeit der Mobilitätsbegriffe geschaffen.
Die Mobilität der deutschen Lehrkräfte stellt ein wichtiges Thema in der heutigen modernen Gesellschaft dar. Mobil zu sein bedeutet heute mehr denn je, weil das Ausmaß an Mobilität Folgen für das Individuum und seine soziale Integration hat. Bis vor 2013 konnte von beruflicher Mobilität der Lehrer kaum die Rede sein. Obwohl die gegenseitige Anerkennung der Lehramtsabschlüsse allgemein gefordert wurde, konnte das nicht umgesetzt werden. Es gibt schon eine EU-Richtlinie, die den Lehrern europaweit berufliche Mobilität garantiert. Innerhalb Deutschlands schaut das anders aus. Aufgrund unterschiedlicher Regelungen der Lehrerausbildung in den 16 Bundesländern, haben Lehramtsabsolventen und Lehramtsabsolventinnen mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn sie zwischen Bundesländern wechseln möchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Mobilitätschancen für Lehrer
- 2.1 Mobilität - Begriffsbestimmung
- 2.2 Ausgangslage
- 2.3 Anerkennungsproblematik zwischen den Bundesländern
- 2.4 Der Beschluss vom Kultusminister vom 5.10.1990
- 3 Kurzer Blick in die Anerkennungspraxis der deutschen Länder
- 3.1 Die Rechtslage in den ostdeutschen Ländern
- 3.2 Die Rechtslage in den westdeutschen Ländern
- 4 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.03.2013
- 5 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Mobilitätschancen von Lehrkräften in Deutschland, indem sie die Entwicklung der Regelungen der Kultusministerkonferenz von 1989 bis heute betrachtet. Sie untersucht, wie die unterschiedlichen Regelungen der Lehrerausbildung in den Bundesländern die Mobilität von Lehramtsabsolventen und -absolventinnen beeinflussen und welche Herausforderungen die Anerkennung von Lehramtsprüfungen mit sich bringt.
- Entwicklung der Mobilitätschancen für Lehrer in Deutschland
- Anerkennungsproblematik von Lehramtsprüfungen zwischen den Bundesländern
- Einfluss unterschiedlicher Lehrerausbildungsregelungen auf die Mobilität von Lehrkräften
- Rolle der Kultusministerkonferenz bei der Gestaltung der Mobilität von Lehrkräften
- Vergleich der Anerkennungspraxis in Ost- und Westdeutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Mobilität von Lehrkräften in Deutschland ein und zeigt die Relevanz des Themas in der heutigen Gesellschaft auf. Es wird auf die Problematik der Anerkennung von Lehramtsprüfungen zwischen den Bundesländern hingewiesen und die Notwendigkeit von Veränderungen im Hinblick auf die Mobilität von Lehrkräften betont.
Kapitel 2 definiert den Begriff der Mobilität und beleuchtet die verschiedenen Facetten und Dimensionen. Es werden sowohl objektive als auch subjektive Faktoren, die die Mobilität beeinflussen, erläutert.
Kapitel 3 beleuchtet die Rechtslage in den ost- und westdeutschen Ländern im Hinblick auf die Anerkennung von Lehramtsprüfungen. Es werden Beispiele aus der Praxis angeführt, um die Unterschiede in den Regelungen der Bundesländer zu verdeutlichen.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.03.2013, der erstmals Transparenz und Erleichterungen für die Lehrermobilität geschaffen hat.
Schlüsselwörter
Lehrermobilität, Lehramtsanerkennung, Kultusministerkonferenz, Bundesländer, Rechtslage, Anerkennungspraxis, Lehrerausbildung, Mobilitätschancen, Strukturwandel, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Lehrer Schwierigkeiten beim Wechsel zwischen Bundesländern?
Grund sind die unterschiedlichen Regelungen zur Lehrerausbildung und die teilweise mangelnde gegenseitige Anerkennung der Lehramtsabschlüsse.
Was hat der KMK-Beschluss von 2013 bewirkt?
Der Beschluss der Kultusministerkonferenz schuf erstmals mehr Transparenz und Erleichterungen für die Mobilität von Lehrkräften innerhalb Deutschlands.
Gibt es Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland bei der Anerkennung?
Ja, die Arbeit vergleicht die spezifische Rechtslage und Anerkennungspraxis in den ost- und westdeutschen Bundesländern.
Welche Rolle spielt die EU bei der Lehrermobilität?
Es gibt eine EU-Richtlinie, die Lehrern europaweit Mobilität garantiert, was die innerdeutschen Hürden oft paradox erscheinen lässt.
Was bedeutet „Mobilität“ im Kontext dieser Arbeit?
Mobilität umfasst sowohl die räumliche als auch die berufsrechtliche Beweglichkeit von Lehrkräften über Ländergrenzen hinweg.
- Quote paper
- Greta Gunst (Author), 2015, Mobilitätschancen für Lehrer in Deutschland. Die Anerkennungsproblematik zwischen den Bundesländern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323768