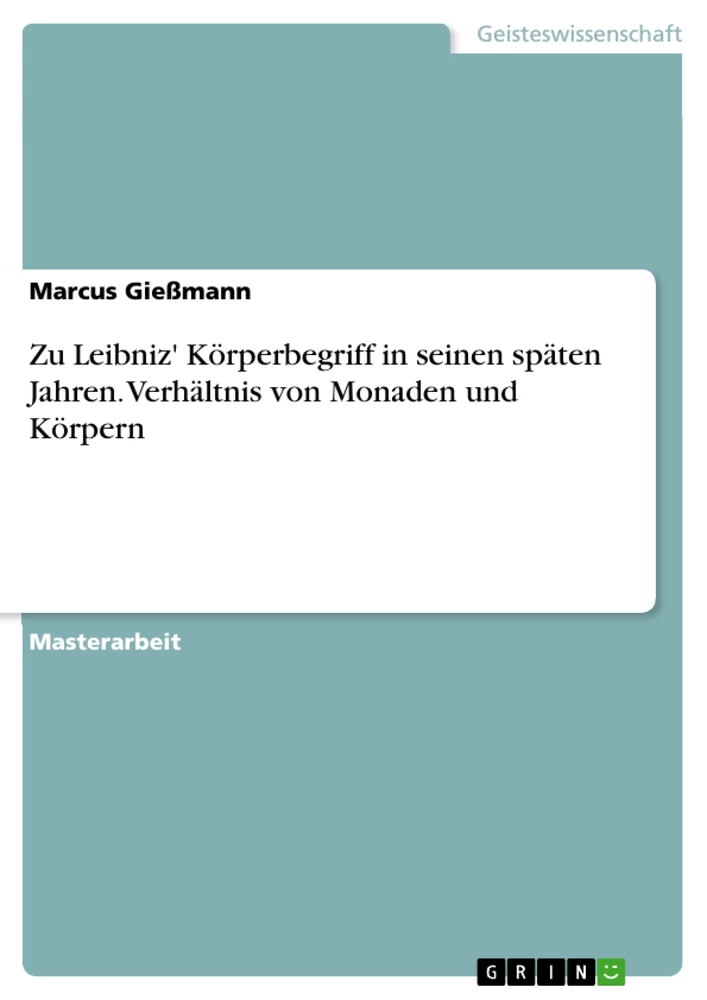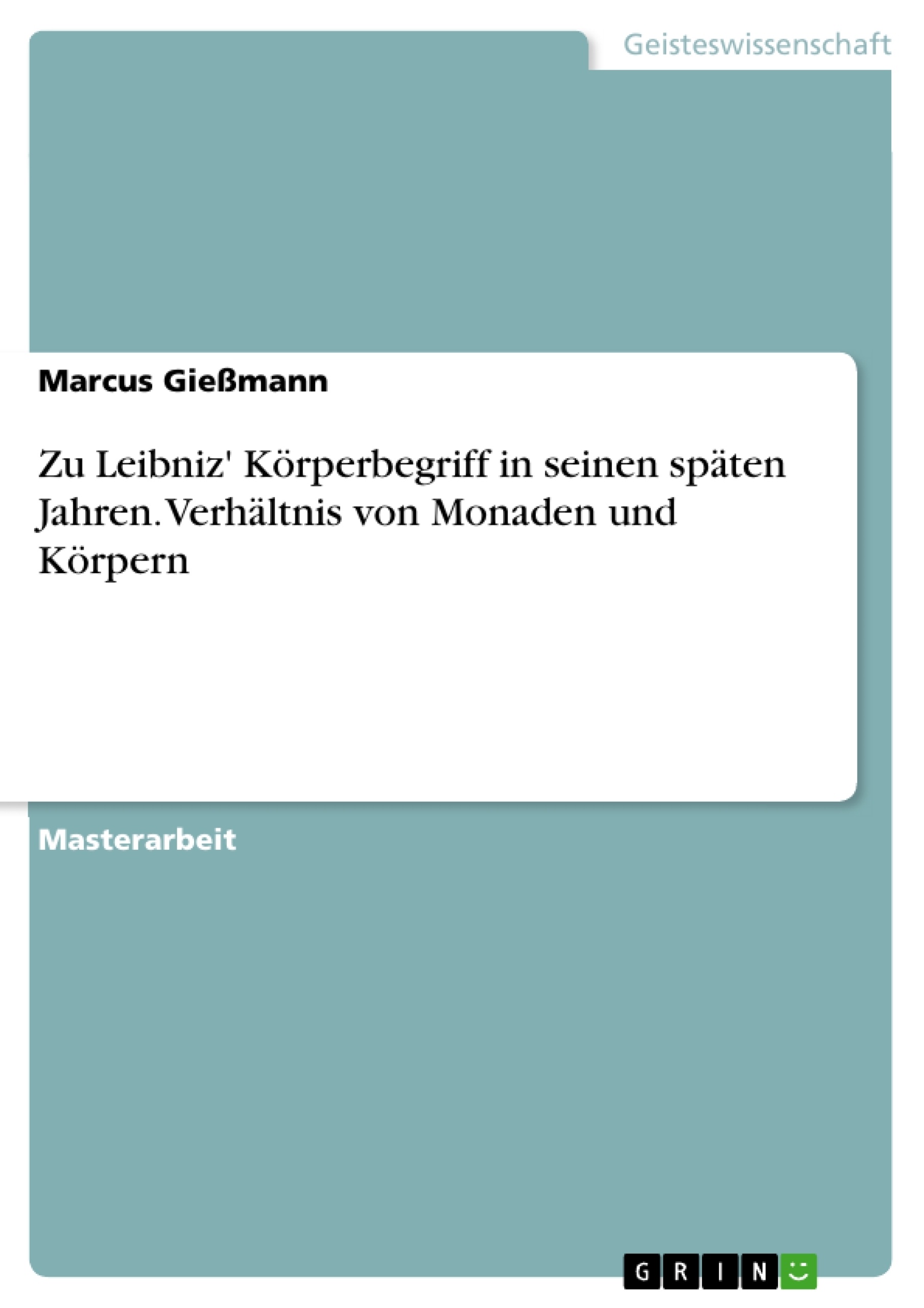"Herr Marcus Gießmann – im Folgenden auch ›Verfasser‹ genannt – legt eine Arbeit über Leibniz’ metaphysische Lehre vor, so wie sie sich hauptsächlich in den Schriften seiner späten Schaffensphase, insbesondere, wenngleich nicht ausschließlich, in der Monadologie (1714), präsentiert. Der Verfasser nimmt sich ein schwieriges Thema vor, das bis heute in der Forschungsgemeinschaft kontrovers diskutiert wird; an dieser Stelle sei beispielshalber nur an die Arbeiten von Rutherford [1995], Hartz [2007], Garber [2009] sowie Rutherford [2009] erinnert. Die Arbeit weist eine klare Struktur auf. Nach einer kurzen, in die Thematik einführenden Einleitung, behandelt der Verfasser im ersten Kapitel Leibniz’ epistemologischen Ansatz, wobei er seine Unterscheidung zwischen Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten kurz darstellt und erörtert. Im dritten Kapitel unternimmt der Verfasser den Versuch, zu zeigen, wie das Einsetzen von den im vorhergehenden Kapitel dargestellten epistemologischen Werkzeugen Leibniz zur Annahme von Monaden geführt haben könnten. Das dritte Kapitel ist einer Erörterung der Eigenschaften von Monaden gewidmet, wobei die folgenden zentralen Eigenschaften von Monaden präsentiert und kritisch diskutiert werden: (i) Einheit per se; (ii) Perzeption, (iii) Apperzeption, (iv) Appetition, (v) Entelechie und (vi) punktuelle Struktur. Da die Auseinandersetzung mit der Rede von der Annahme von Monaden die Rede von zusammengesetzten, ausgedehnten, zudem materiellen Körpern mit sich bringt, widmet sich der Verfasser entsprechend im vierten Kapitel der Erörterung der Eigenschaften von Körpern, die er – Leibniz’ Auffassung darstellend – in den Eigenschaften der (i) Ausdehnung und der (ii) Masse individuiert, wobei letztere sich weiter durch den Begriff der (passiven und aktiven) Kraft ausbuchstabieren lässt. Die nächsten zwei Kapitel, mit ihren zwei zentralen Fragen, machen den Kern der Arbeit aus. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie Monaden Körper konstituieren können. Dabei setzt sich der Verfasser vor allem mit dem Versuch von Savile [2000], diese Frage zu beantworten, auseinander. Die Rekonstruktion von Saviles Argumentation führt den Verfasser dazu, Saviles Ansatz, besonders seine Begründung der Konstitution von Masse, als gescheitert anzusehen. Das sechste Kapitel behandelt die zweite, mit der ersten eng verknüpfte, zentrale Frage der Arbeit, und zwar die Frage nach..."
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Leibniz' epistemologische Rahmensetzung
- 1.1 Vernunftwahrheiten
- 1.1.1 Der Satz des auszuschließenden Widerspruchs
- 1.1.2 Der Satz des ausgeschlossenen Dritten
- 1.1.3 Der Satz des zureichenden Grundes
- 1.1.4 Die Identität des Ununterscheidbaren und die Ununterscheidbarkeit des Identischen
- 1.2 Tatsachenwahrheiten
- 2. Die Annahme von Monaden
- 2.1 Das Problem der Annahme von Monaden in der Monadologie
- 3. Eigenschaften von Monaden
- 3.1 Monaden sind Einheiten per se
- 3.2 Perzeption und Apperzeption
- 3.2.1 Perzeptionsgrade
- 3.3 Appetition und Entelechie
- 3.4 Die punktuelle Struktur von Monaden
- 4. Eigenschaften von Körpern
- 4.1 Räumliche Ausdehnung
- 4.2 Besitz von Masse
- 5. Wie können Monaden Körper konstituieren?
- 5.1 Wie ist es möglich, dass Monaden Körper konstituieren?
- 5.1.1 Wie ermöglichen Monaden räumliche Ausdehnung?
- 5.1.2 Wie ermöglichen Monaden Masse?
- 5.1.2.1 Rekonstruktion von Saviles Argumentation
- 5.1.2.2 Reflexion der Rekonstruktion von Saviles Argumentation
- 6. Wie sind Körper zu begreifen?
- 6.1 Körper als Phänomene
- 6.1.1 Das Verhältnis zwischen Monaden und Körpern als Phänomene
- 6.1.1.1 Rekonstruktion der Entwicklung des Phänomenbegriffs anhand des Regenbogenbeispiels
- 6.2 Körper als „well-founded phenomena“
- 7. Emanation oder Emergenz?
- 8. Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit Leibniz' Körperbegriff in seinen späten Jahren. Sie untersucht, wie Monaden Körper konstituieren können und wie diese Körper zu begreifen sind. Die Arbeit greift dabei auf Leibniz' Schriften wie die „Metaphysische Abhandlung“, die „Auf Vernunft gegründeten Prinzipien der Natur und Gnade“, „Neues System der Natur und der Gemeinschaft der Substanzen, wie der Vereinigung zwischen Körper und Geist“ und die „Monadologie“ zurück. Die Arbeit fokussiert dabei insbesondere auf die „Monadologie“, da diese eine einfache, aber starke These im Hinblick auf zusammengesetzte Monaden vertritt. Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte:- Leibniz' epistemologische Rahmensetzung
- Die Annahme von Monaden
- Eigenschaften von Monaden
- Eigenschaften von Körpern
- Das Verhältnis zwischen Monaden und Körpern
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie können Monaden Körper konstituieren und wie sind diese Körper zu begreifen? Sie erläutert die Problematik des Verhältnisses zwischen Monaden und Körpern und stellt die relevanten Schriften von Leibniz vor.
- Kapitel 1 behandelt Leibniz' epistemologische Rahmensetzung, die auf den Sätzen des auszuschließenden Widerspruchs, des ausgeschlossenen Dritten und des zureichenden Grundes basiert. Es wird auch die Identität des Ununterscheidbaren und die Ununterscheidbarkeit des Identischen erläutert.
- Kapitel 2 geht auf die Annahme von Monaden in der Monadologie ein und stellt das Problem der Annahme von Monaden in der Monadologie dar.
- Kapitel 3 behandelt die Eigenschaften von Monaden, wie ihre Einheitlichkeit, ihre Perzeption und Apperzeption, ihre Appetition und Entelechie sowie ihre punktuelle Struktur.
- Kapitel 4 erläutert die Eigenschaften von Körpern, insbesondere ihre räumliche Ausdehnung und ihren Besitz von Masse.
- Kapitel 5 untersucht die Frage, wie Monaden Körper konstituieren können. Es wird untersucht, wie Monaden räumliche Ausdehnung und Masse ermöglichen. Dabei wird auch Saviles Argumentation rekonstruiert und reflektiert.
- Kapitel 6 befasst sich mit der Frage, wie Körper zu begreifen sind. Es werden Körper als Phänomene und als „well-founded phenomena“ betrachtet. Dabei wird das Verhältnis zwischen Monaden und Körpern als Phänomene untersucht und die Entwicklung des Phänomenbegriffs anhand des Regenbogenbeispiels rekonstruiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Körperbegriff bei Leibniz, insbesondere mit der Frage, wie Monaden Körper konstituieren können und wie diese Körper zu begreifen sind. Die Arbeit greift dabei auf die Schriften von Leibniz zurück, insbesondere auf die „Monadologie“. Die zentralen Themen der Arbeit sind: Monaden, Körper, Ausdehnung, Masse, Phänomene, „well-founded phenomena“, Substanz, epistemologische Rahmensetzung, Vernunftwahrheiten, Tatsachenwahrheiten, Perzeption, Apperzeption, Appetition, Entelechie.Häufig gestellte Fragen
Was sind Monaden laut Leibniz?
Monaden sind einfache, punktuelle Substanzen, die als „Einheiten per se“ die Grundlage der Wirklichkeit bilden und Eigenschaften wie Perzeption und Appetition besitzen.
Wie verhalten sich Monaden zu materiellen Körpern?
Die Arbeit untersucht die schwierige Frage, wie aus den nicht-ausgedehnten Monaden zusammengesetzte, ausgedehnte Körper mit Masse entstehen können.
Was bedeutet es, dass Körper „well-founded phenomena“ sind?
Leibniz betrachtet Körper als Phänomene, die jedoch in der Realität der Monaden begründet sind (wohlbegründete Phänomene), ähnlich wie ein Regenbogen in Wassertropfen begründet ist.
Welche epistemologischen Sätze sind für Leibniz' Metaphysik zentral?
Zentral sind der Satz des auszuschließenden Widerspruchs, der Satz des zureichenden Grundes sowie die Identität des Ununterscheidbaren.
Was ist der Unterschied zwischen Perzeption und Apperzeption?
Perzeption ist der innere Zustand der Monade, der äußere Dinge repräsentiert, während Apperzeption das bewusste Bewusstsein oder die Reflexion dieser Zustände beschreibt.
Welche Rolle spielt die Kraft in Leibniz' Körperbegriff?
Körper werden durch Ausdehnung und Masse individuiert, wobei Masse durch passive und aktive Kraft weiter definiert wird.
- Quote paper
- Marcus Gießmann (Author), 2015, Zu Leibniz' Körperbegriff in seinen späten Jahren. Verhältnis von Monaden und Körpern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323772