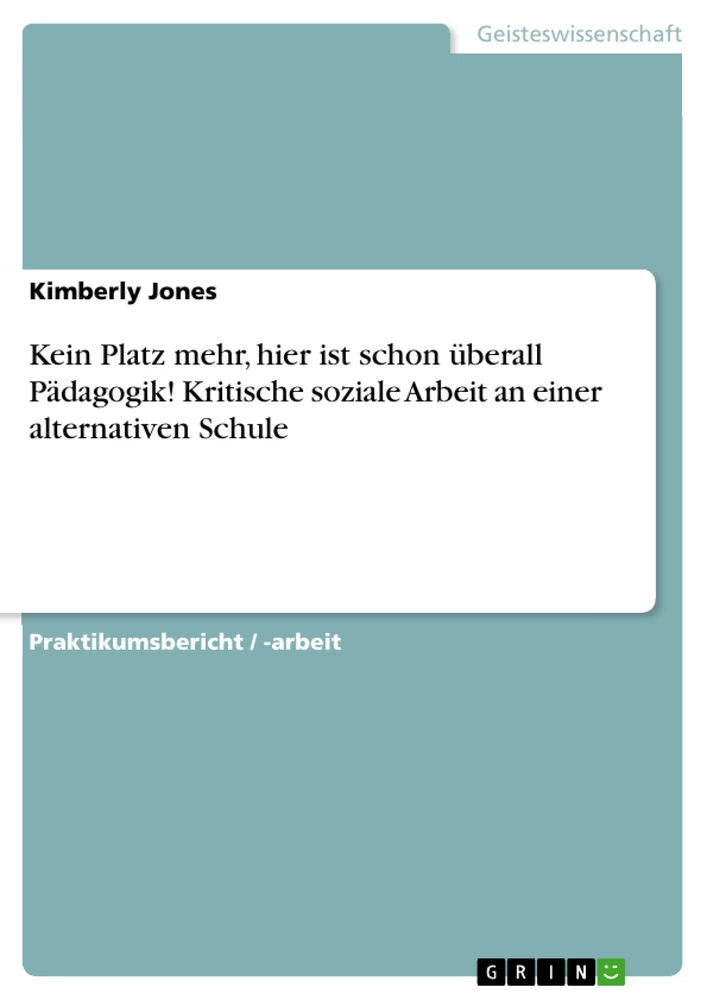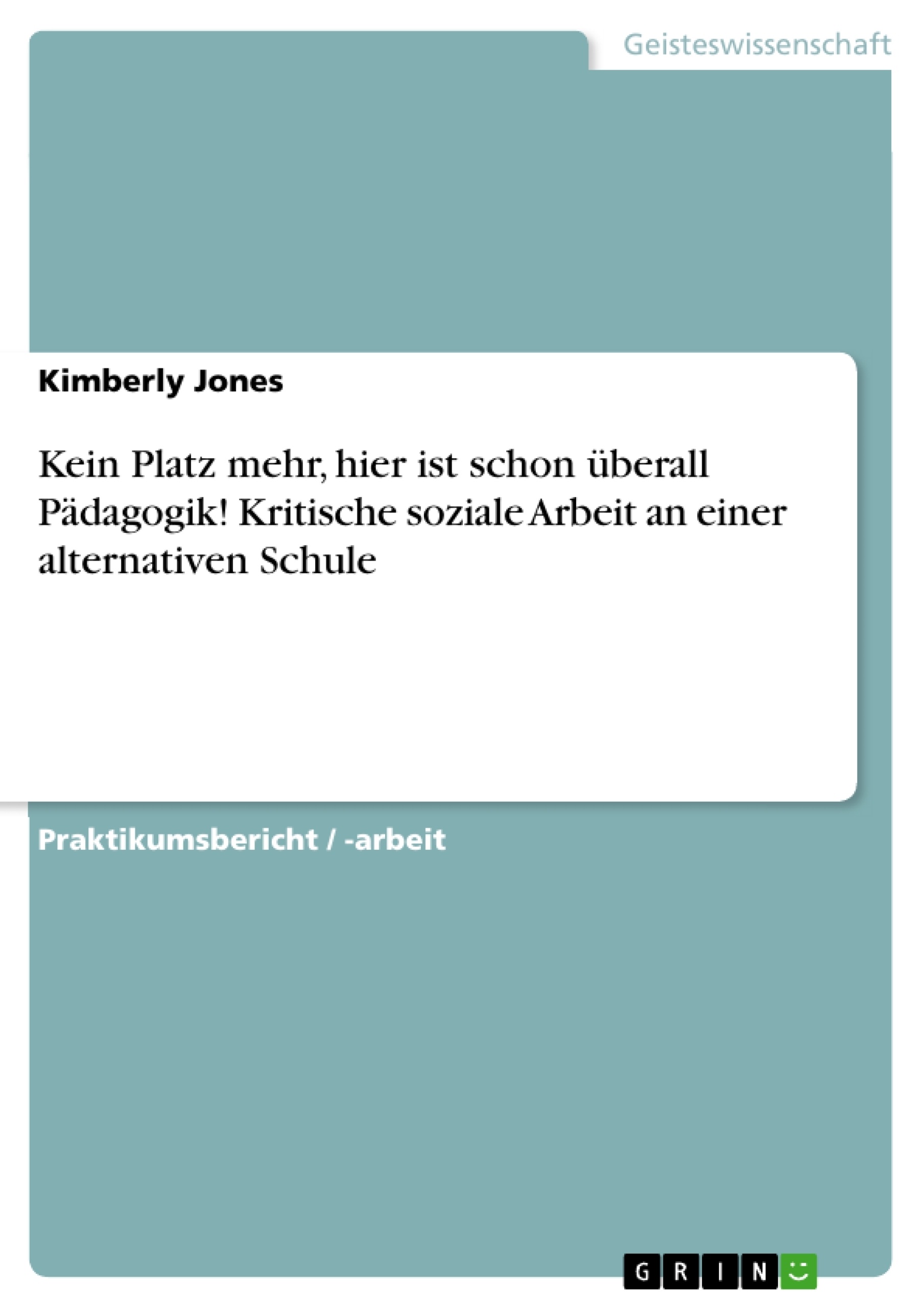Die Vereinbarkeit von kritischer Sozialarbeit mit Schulsozialarbeit erscheint zunächst utopisch. Die hier beschriebene Schule mit einem alternativen Schulsystem zeigt jedoch beispielhaft, dass es möglich ist an einer Schule kritische, selbstbestimmte Soziale Arbeit in der Praxis anzuwenden.
Es ist besonders im sozialpädagogischen Arbeitsbereich bekannt, dass die A-Schule durch ihr besonderes Konzept einen Arbeitsbereich darstellt, der zunächst von Außen sehr „einfach“ scheint. So hat die Schule den Ruf, eines Selbstläufers, welcher auch dem Klientel zugeschrieben wird, dass man an der sogenannten „Eliteschule“ vorfindet. Übliche Probleme, wie sie an Regelschulen zu finden sind, treten hier nicht oder nur stark reduziert auf.
Doch wird dies oft damit verwechselt, dass eine alternative Schule nicht zwingend weniger Probleme hat, als eine Regelschule, sich die Problemlagen und Bedürfnisse stattdessen bloß auf andere Bereiche verlagern. Ein Praktikum an der A-Schule verdeutlichte, dass die Schulsozialarbeit hier anders verortet ist, als es in Regelschulen der Fall ist. Die besonderen Strukturen der Schule, bringen besondere Aufgaben für die Schulsozialarbeit mit sich.
Aber macht es das generell einfacher? Ist die Arbeit an einer Schule mit pädagogischen Grundmauern auch unmittelbar ein Ort der einfachen Schulsozialarbeit? Es stellt sich die Frage, ob Soziale Arbeit sich hier überhaupt noch als eigene Profession durchsetzen kann oder sie eher gezwungen ist, sich unterzuordnen, ist die A-Schule doch schon pädagogisch genug?! Im Laufe des Praktikums zeigten sich viele Arbeitsbereiche der sozialen Arbeit im Kontext der alternativen Schule.
Es zeigte sie, wie die Schulsozialarbeit verortet ist, welche professionellen, sozialen und ökonomischen Interessen dahinterstehen und wie sie in Wechselwirkung zu ihrem Umfeld steht. Außerdem wurde in dem Praktikum deutlich, welche Eigenschaften Schulsozialarbeit mit sich bringen sollte, welche Rolle Belastungsfähigkeit und Ausgeglichenheit spielen und warum selbstkritische Reflexion aber auch Empathie einen großen Stellenwert haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die A-Schule - Das Konzept
- Die Entstehung der A-Schule
- Gründung, Entwicklung und Leitgedanken der A-Schule
- Selbstregulierung – ein Arbeitsprinzip der A-Schule
- Kein Platz mehr – Hier ist schon überall Pädagogik
- Kritische soziale Arbeit – Die Pädagogik an der A-Schule
- Selbstbestimmte Schulsozialarbeit
- Erziehungsbegriff
- Bildungsbegriff
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Praxisbericht beleuchtet die Rolle der Schulsozialarbeit an der A-Schule, einer alternativen Ganztagsschule. Er analysiert die Besonderheiten des pädagogischen Konzepts der A-Schule und die Herausforderungen, die sich für die soziale Arbeit in diesem Kontext ergeben. Der Bericht untersucht, wie sich die Schulsozialarbeit an die besonderen Strukturen der A-Schule anpasst und welche professionellen, sozialen und ökonomischen Interessen dabei eine Rolle spielen.
- Das pädagogische Konzept der A-Schule und seine Auswirkungen auf die Schulsozialarbeit
- Die Rolle der Schulsozialarbeit in einer Schule mit starkem pädagogischen Fokus
- Die Bedeutung von Selbstbestimmung, Selbstregulierung und Eigeninitiative im Schulalltag
- Die Herausforderungen und Chancen der Schulsozialarbeit an der A-Schule
- Die Bedeutung von professioneller Kompetenz, Belastungsfähigkeit und Empathie in der Schulsozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die A-Schule und ihre besonderen Strukturen im Kontext der Schulsozialarbeit vor. Sie beleuchtet die Frage, ob sich Soziale Arbeit in einer Schule mit pädagogischen Grundmauern als eigenständige Profession durchsetzen kann.
Kapitel 2 beschreibt das Konzept der A-Schule, ihre Entstehung und Entwicklung, sowie die grundlegenden Prinzipien des pädagogischen Ansatzes. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Selbstregulierung als Arbeitsprinzip der A-Schule.
Kapitel 3 befasst sich mit der kritischen sozialen Arbeit an der A-Schule. Es analysiert die Rolle der Schulsozialarbeit und ihre Ausrichtung im Kontext des pädagogischen Konzepts. Die Themen Selbstbestimmte Schulsozialarbeit, Erziehungsbegriff und Bildungsbegriff werden dabei beleuchtet.
Schlüsselwörter
Alternative Schule, Schulsozialarbeit, Selbstregulierung, Pädagogisches Konzept, Selbstbestimmung, Eigeninitiative, kritische soziale Arbeit, Erziehungsbegriff, Bildungsbegriff, Belastungsfähigkeit, Empathie.
Häufig gestellte Fragen
Kann kritische Sozialarbeit an Schulen funktionieren?
Ja, der Bericht zeigt am Beispiel einer alternativen Schule, dass selbstbestimmte und kritische Soziale Arbeit in der Praxis möglich ist.
Was unterscheidet die A-Schule von Regelschulen?
Sie nutzt das Prinzip der Selbstregulierung und hat ein alternatives Schulsystem, das andere Anforderungen an die Schulsozialarbeit stellt.
Welche Kompetenzen braucht ein Schulsozialarbeiter dort?
Besonders wichtig sind Belastungsfähigkeit, Ausgeglichenheit, Empathie und die Fähigkeit zur selbstkritischen Reflexion.
Ist die Arbeit an einer „Eliteschule“ einfacher?
Nein, die Problemlagen verschieben sich lediglich in andere Bereiche und erfordern eine starke professionelle Eigenständigkeit der Sozialarbeit.
Wie ist die Schulsozialarbeit an der A-Schule verortet?
Sie muss sich als eigene Profession gegenüber der bereits stark pädagogisch geprägten Struktur der Schule behaupten.
- Citation du texte
- Kimberly Jones (Auteur), 2016, Kein Platz mehr, hier ist schon überall Pädagogik! Kritische soziale Arbeit an einer alternativen Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323868