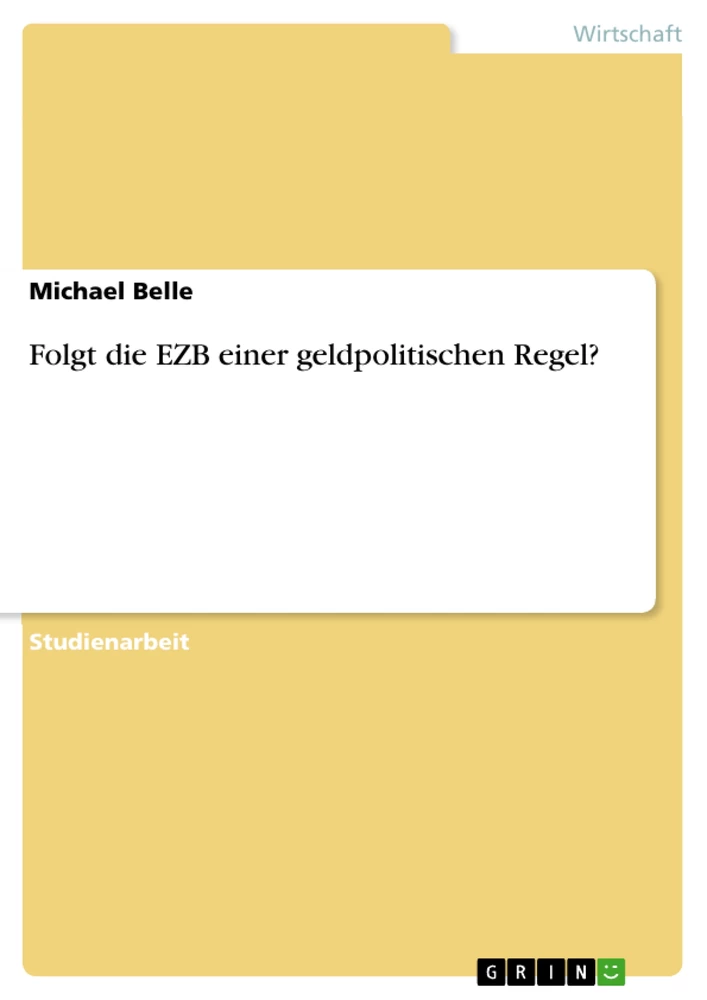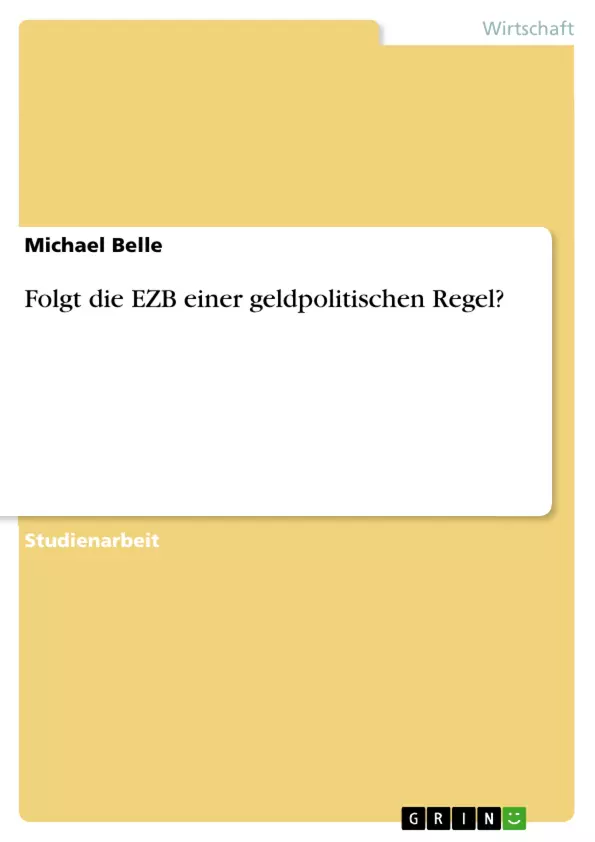Mit der dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) übernahm am 01.01.1999 das Europäische System der Zentralbanken (ESZB), bestehend aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und der jeweiligen Zentralbank der Mitgliedsstaaten, unter der Verantwortung der EZB die Geldpolitik für den „Euroraum“.
Fortan wird eine einheitliche Geldpolitik für alle Mitgliedstaaten praktiziert. Der Zusammenschluss war ein Meilenstein in der Geschichte Europas, denn die beteiligten nationalen Zentralbanken gaben somit freiwillig ihre Souveränität für die neue supra-nationale Institution auf.
Das primäre Ziel der Europäischen Zentralbank sowie auch der meisten anderen Zentralbanken ist die Bekämpfung der Inflation und folglich die Gewährleistung der Preisniveaustabilität. Darüber herrscht heutzutage sowohl in der Theorie als auch in der Praxis Konsens.
Dissonanz herrscht hingegen in diversen anderen Punkten. (a) Kann die EZB neben der Preisniveaustabilität noch andere Ziele verfolgen? (b) Mit welcher Strategie soll die Zentralbank diese Ziele erreichen? (c) Wie groß sollte der diskretionäre Handlungsspielraum der EZB tatsächlich sein? (d) Sollen geldpolitische Entscheidungen auf Basis einer definierten Regel erfolgen?
Zur Beantwortung der Frage, ob die EZB einer geldpolitischen Regel folgt werden zur strukturierten Problemerfassung zunächst die diskretionäre und die regelgebundene Geldpolitik voneinander abgegrenzt. Im Anschluss daran werden die Ziele der Europäischen Zentralbank dargestellt und drei ausgewählte geldpolitische Regeln etwas näher betrachtet, um herauszufinden, inwieweit die EZB diesen Regeln folgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 DISKRETIONÄRE VERSUS REGELGEBUNDENE GELDPOLITIK
- 2.1 Diskretionäre Geldpolitik
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Ausgewählte Chancen und Risiken
- 2.2 Regelgebundene Geldpolitik
- 2.2.1 Definition
- 2.2.2 Ausgewählte Chancen und Risiken
- 2.1 Diskretionäre Geldpolitik
- 3 ZIELE DER EZB ALS TRÄGER DER EUROPÄISCHEN GELDPOLITIK
- 3.1 Operative Ziele und Zwischenziele
- 3.2 Endziele
- 3.2.1 Preisstabilität
- 3.2.1.1 Definition
- 3.2.1.2 Bedeutung
- 3.2.1.3 Zwei-Säulen-Strategie
- 3.2.2 Unterstützung der allgemeinen Wirtschaft in der EU
- 3.2.1 Preisstabilität
- 4 DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER GELDPOLITISCHER REGELN
- 4.1 Taylor-Regel
- 4.1.1 Modellbeschreibung
- 4.1.2 Kritische Würdigung
- 4.1.3 Folgt die EZB der Taylor-Regel
- 4.2 Geldmengenstrategie
- 4.2.1 Modellbeschreibung
- 4.2.2 Kritische Würdigung
- 4.2.3 Folgt die EZB einer Geldmengenstrategie?
- 4.3 Direkte Inflationssteuerung
- 4.3.1 Modellbeschreibung
- 4.3.2 Kritische Würdigung
- 4.3.3 Folgt die EZB einer direkten Inflationssteuerung?
- 4.1 Taylor-Regel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Frage, ob die Europäische Zentralbank (EZB) einer geldpolitischen Regel folgt. Sie untersucht die Vor- und Nachteile diskretionärer und regelgebundener Geldpolitik und stellt die Ziele der EZB dar, insbesondere die Preisstabilität und die Unterstützung der allgemeinen Wirtschaft in der EU.
- Diskretionäre vs. Regelgebundene Geldpolitik
- Ziele der EZB
- Analyse verschiedener geldpolitischer Regeln (Taylor-Regel, Geldmengenstrategie, Direkte Inflationssteuerung)
- Bewertung der Anwendung dieser Regeln durch die EZB
- Diskussion der Herausforderungen für die EZB im Kontext der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einführung in das Thema und stellt die Forschungsfrage nach der Anwendung geldpolitischer Regeln durch die EZB. Kapitel 2 beleuchtet die beiden zentralen Ansätze der Geldpolitik: die diskretionäre und die regelgebundene Geldpolitik. Es werden die Definitionen, Chancen und Risiken beider Ansätze erläutert. Kapitel 3 beschreibt die Ziele der EZB als Träger der europäischen Geldpolitik, mit Schwerpunkt auf die Preisstabilität und die Unterstützung der allgemeinen Wirtschaft in der EU. Kapitel 4 analysiert ausgewählte geldpolitische Regeln, darunter die Taylor-Regel, die Geldmengenstrategie und die direkte Inflationssteuerung. Es werden die Modellbeschreibungen, die kritische Würdigung und die Anwendung dieser Regeln durch die EZB untersucht.
Schlüsselwörter
Europäische Zentralbank, Geldpolitik, Regelgebundenheit, Diskretion, Preisstabilität, Taylor-Regel, Geldmengenstrategie, Direkte Inflationssteuerung, Europäische Wirtschafts- und Währungsunion.
Häufig gestellte Fragen
Folgt die EZB einer festen geldpolitischen Regel?
Die Arbeit untersucht, ob die EZB nach Regeln wie der Taylor-Regel agiert oder eher diskretionäre (fallweise) Entscheidungen trifft.
Was ist das primäre Ziel der Europäischen Zentralbank?
Das Hauptziel ist die Gewährleistung der Preisniveaustabilität zur Bekämpfung der Inflation im Euroraum.
Was besagt die Taylor-Regel?
Die Taylor-Regel ist ein Modell, das vorschlägt, wie Zentralbanken die Leitzinsen in Abhängigkeit von der Inflationsrate und der Wirtschaftsleistung anpassen sollten.
Was ist die Zwei-Säulen-Strategie der EZB?
Sie basiert auf einer wirtschaftlichen Analyse (kurzfristige Risiken für die Preisstabilität) und einer monetären Analyse (langfristiger Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation).
Was ist diskretionäre Geldpolitik?
Hierbei handeln Notenbanken nach eigenem Ermessen ohne feste Bindung an mathematische Regeln, um flexibel auf Krisen reagieren zu können.
- Arbeit zitieren
- Michael Belle (Autor:in), 2015, Folgt die EZB einer geldpolitischen Regel?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323946