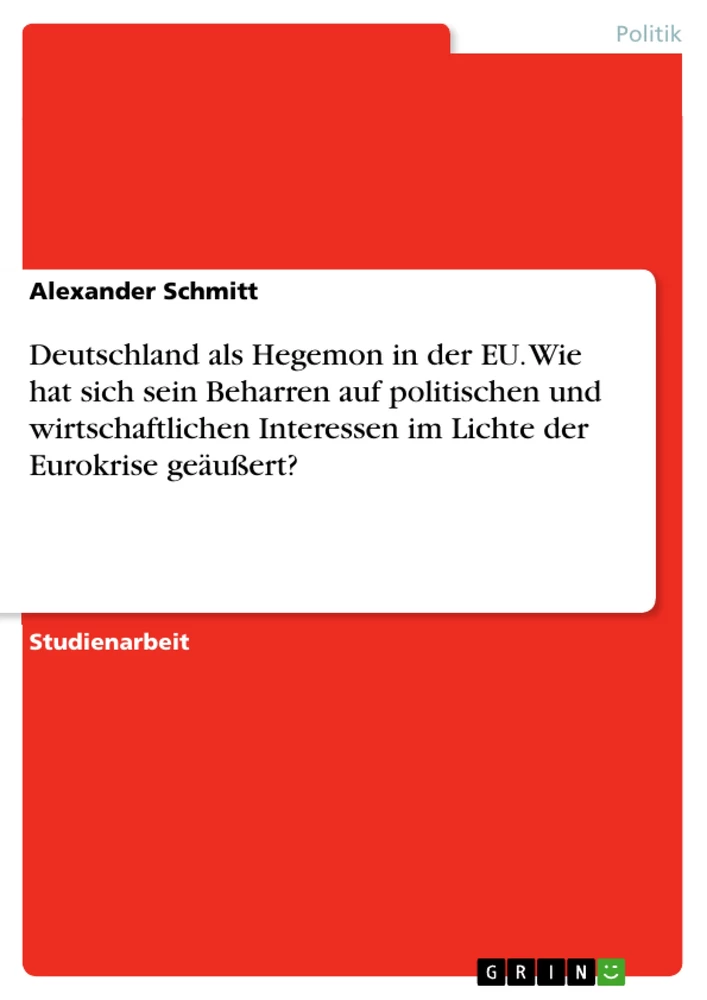Ist Deutschland als Hegemon innerhalb der EU anzusehen? Diese Frage wird unter den Rückgriff auf den Hegemoniebegriff behandelt und dabei Deutschlands wirtschafts- und integrationspolitisches Handeln während der Eurokrise untersucht.
Nachdem der Hegemoniebegriff eingeführt worden ist, wird sich mit Hegemonie im Kontext der EU auseinandergesetzt, welche aufgrund des Fehlens einer relativ unabhängigen übergeordneten Zentralinstanz intergouvernemental (Stichwort deutsch-französisches Tandem) bzw., ausgehend von deutscher Hegemonie von einem Staat ausgeübt wird, welcher trotz formaler Gleichheit aller Mitgliedstaaten eine Präponderanz aufweist bzgl. Größe und ökonomischem Gewicht.
Im Anschluss daran wird auf das sogenannte Merkiavelli-Prinzip eingegangen, ein Begriff, der einem Essay Ulrich Becks aus dem „Spiegel“ entnommen ist.
Der Autor dieser Seminararbeit macht sich die Analogie des Merkiavellismus zu Eigen. Dieser personifiziert in der Person der Bundeskanzlerin Angela Merkel den Anspruch Deutschlands, durch eine „Zuckerbot-und Peitschenpolitik“, bzw. das Offenhalten mehrerer policy-Optionen von den Ländern insbesondere der Eurozone Gefolgschaft, bzw. etwas neutraler formuliert: das Eingehen auf deutsche Interessen, zu stimulieren.
Die deutsche Rolle in der Eurokrise wird hernach daraufhin beleuchtet, inwiefern Deutschland nationale politische und wirtschaftliche Interessen zum Ausdruck gebracht hat. Wie kann man die Wahrnehmung Deutschlands in der EU charakterisieren? Als ein emanzipiertes Deutschland, welches sich durch eigendefinierte Interessen auszeichnet und außerhalb eines Integrationszusammenhanges agiert, welcher unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg noch Staatsräson war?
Diese Seminararbeit erhebt keinen empirisch-detaillierten Analyseanspruch der europäischen Schulden- und Finanzkrise. Dies wäre aufgrund der Komplexität des Analysegegenstandes und der notwendigen Beschränkung der Seitenzahl nicht, bzw. nur unzureichend zu leisten.
Vielmehr soll der Frage nachgegangen werden, immer unter der Leitannahme einer deutschen Hegemonie, in welchen Bereichen, Verhaltensweisen oder Charakteristika deutscher Europapolitik sich eine Hegemonialrolle offenbart.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Begriff des Hegemons
- Theorie hegemonialer Stabilität
- Hegemonie in der EU
- Deutschland als Hegemon?
- Das „Merkiavelli-Prinzip“
- Deutschlands Rolle in der Eurokrise
- Dauerkrisenmanagement und Exportüberschusspolitik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Deutschland als Hegemon in der EU, insbesondere illustriert an der Eurokrise, anzusehen ist und wie sich sein Beharren auf nationale Interessen latent oder manifest äußert, bzw. geäußert hat.
- Abgrenzung des Hegemoniebegriffs von Führung
- Analyse der Hegemonie im Kontext der EU
- Untersuchung des „Merkiavelli-Prinzips“ als Ausdruck deutscher Hegemonialpolitik
- Beurteilung der Rolle Deutschlands in der Eurokrise
- Betrachtung der deutschen Europapolitik unter dem Aspekt der Hegemonie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Deutschland als Hegemon in der EU“ dar und führt in die Fragestellung der Seminararbeit ein. Der theoretische Rahmen beleuchtet den Begriff des Hegemons und die Theorie hegemonialer Stabilität. Das Kapitel „Hegemonie in der EU“ untersucht die Besonderheiten der Hegemonie in einem supranationalen Kontext wie der EU. Im anschließenden Kapitel „Deutschland als Hegemon?“ wird das „Merkiavelli-Prinzip“ analysiert und die Rolle Deutschlands in der Eurokrise beleuchtet.
Schlüsselwörter
Hegemonie, Deutschland, EU, Eurokrise, „Merkiavelli-Prinzip“, nationale Interessen, Führungsrolle, Dominanz, Stabilität, Internationale Beziehungen, Kindleberger, Neorealismus.
Häufig gestellte Fragen
Ist Deutschland ein Hegemon in der EU?
Die Arbeit untersucht, ob Deutschland aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke und Größe eine dominierende Führungsrolle einnimmt, die über formale Gleichheit hinausgeht.
Was versteht man unter dem "Merkiavelli-Prinzip"?
Der Begriff beschreibt eine Machtpolitik (Zuckerbrot und Peitsche), die durch das Offenhalten von Optionen andere EU-Staaten dazu bewegt, deutschen Interessen zu folgen.
Wie äußerte sich die deutsche Hegemonie in der Eurokrise?
Deutschland setzte maßgeblich Sparvorgaben und Reformen in anderen Euro-Ländern durch, oft verknüpft mit finanziellen Hilfen und nationalen wirtschaftlichen Interessen.
Was bedeutet Exportüberschusspolitik im EU-Kontext?
Es beschreibt die deutsche Strategie, Wirtschaftswachstum primär durch Exporte zu generieren, was innerhalb der Eurozone zu Ungleichgewichten und Spannungen führen kann.
Hat sich Deutschlands Rolle seit dem 2. Weltkrieg gewandelt?
Die Arbeit fragt, ob Deutschland heute emanzipierter agiert und eigene nationale Interessen stärker gewichtet als die reine europäische Integration.
- Quote paper
- Alexander Schmitt (Author), 2013, Deutschland als Hegemon in der EU. Wie hat sich sein Beharren auf politischen und wirtschaftlichen Interessen im Lichte der Eurokrise geäußert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/324018