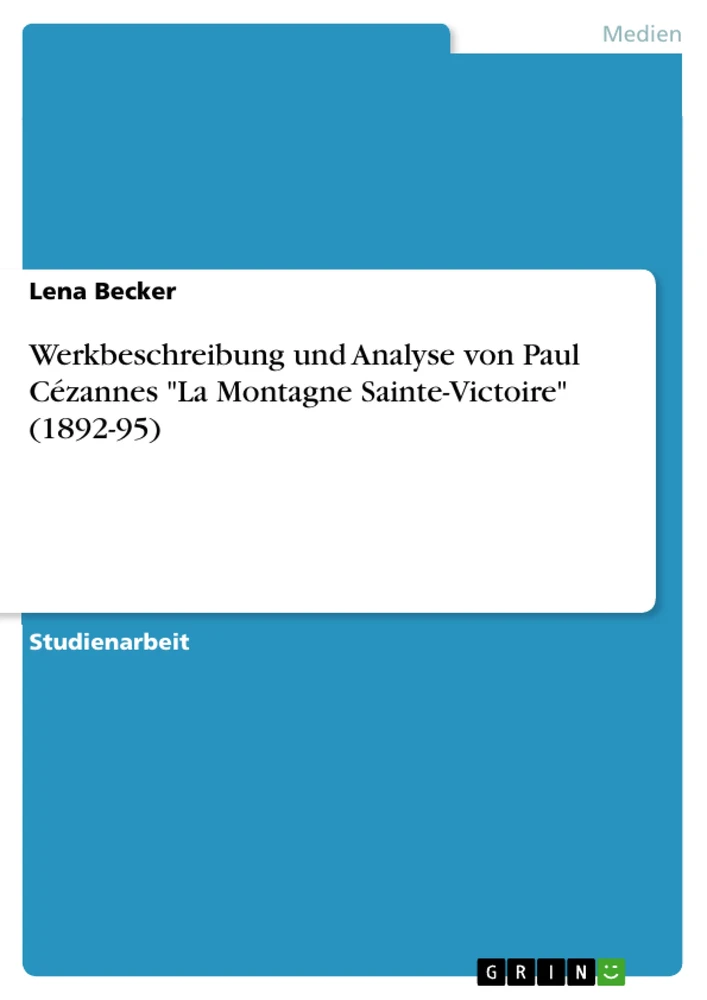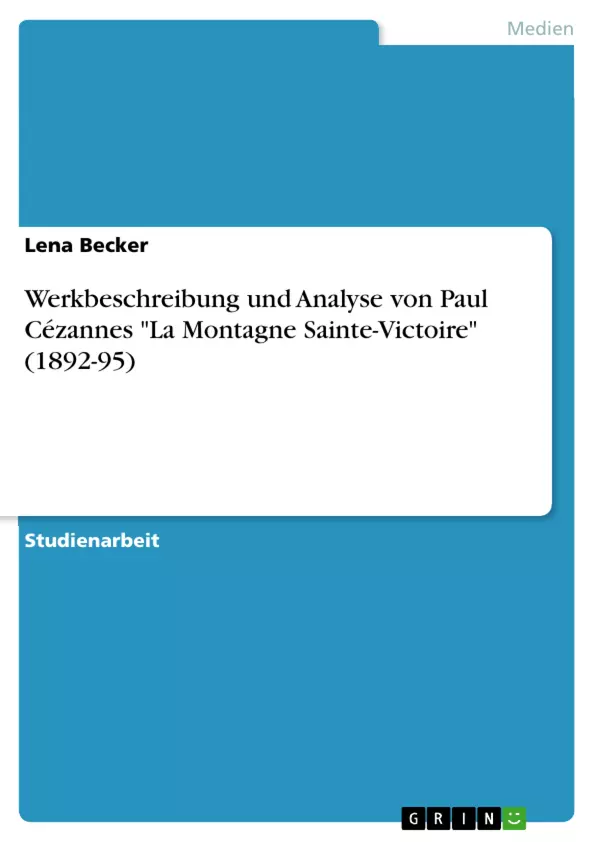Der französische Maler Paul Cézanne (1839-1906) kehrte in der Zeit nach seinen romantischen Frühwerken um 1870 immer wieder zu einem Motiv zurück: Dem Montagne Sainte-Victoire, einem Gebirge bei Aix-en-Provence im Süden von Frankreich, das er von seinem Atelier nahe der Les Lauves genannten Anhöhe in der Provence aus sehen konnte. Insgesamt schuf er ungefähr 80 Gemälde, Zeichnungen und Aquarelle aus diversen Perspektiven unter dem Vorhaben, die Landschaft um das Kalksteinmassiv in seiner Natur abzubilden. In dieser Phase entstand auch das Gemälde, welches im Zentrum dieser Seminararbeit steht: "La Montagne Sainte-Victoire" von 1892-95.
Anhand dieser Landschaftsmalerei soll veranschaulicht werden, mit welchen eigenen, bildlichen Darstellungsmöglichkeiten und Regeln Cézanne die Medialität des Bildes und dessen Gegenständlichkeit zum Vorschein brachte. Über das Hauptwerk hinaus werden die wichtigsten Schritte seiner Malerei anhand exemplarischer Bildwerke aufgewiesen und vergleichend behandelt.
- Arbeit zitieren
- Lena Becker (Autor:in), 2016, Werkbeschreibung und Analyse von Paul Cézannes "La Montagne Sainte-Victoire" (1892-95), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/324157