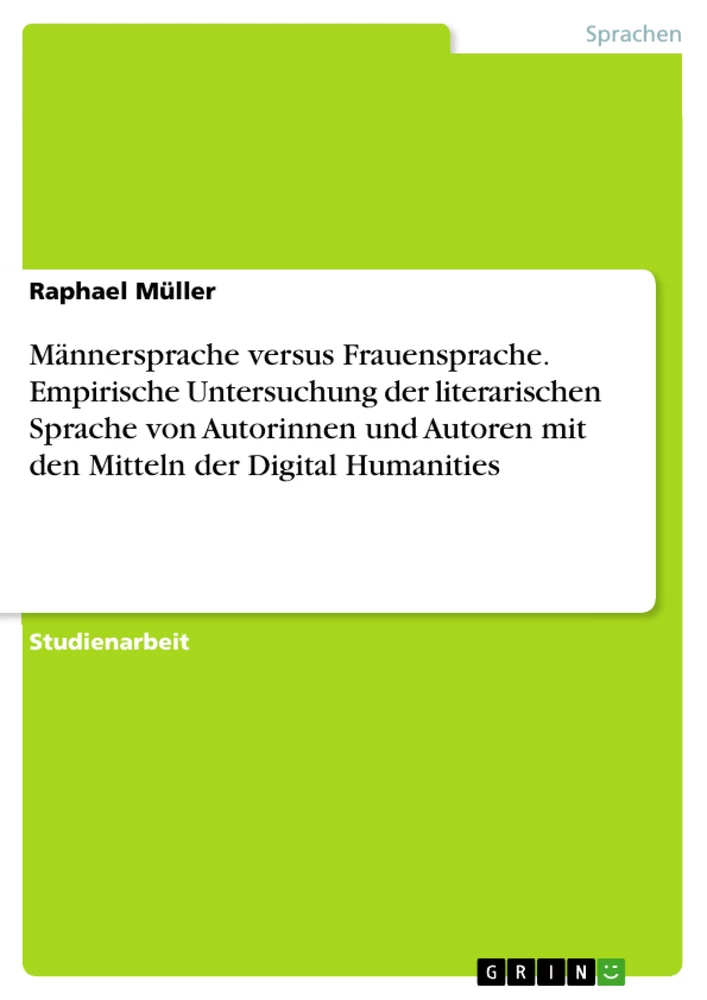Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mich mit den sprachlichen Gemeinsamkeiten und Unterschieden der literarischen Sprache von Männern und Frauen. Das Klischee von geschlechtstypischer Sprache oder geschlechtstypischen Kommunikationsstilen sieht 'Männersprache' als tendenziell sachbezogener, konfrontativer, selbstbezogener, aber auch selbstsicherer. 'Frauensprache' hingegen gilt als emotionaler, personenorientiert und harmoniebestrebt. Wobei sich die folgende Untersuchung aus Gründen der Praktikabilität auf die literarische Schriftsprache des 18.-20. Jahrhunderts konzentriert.
Die Methoden der 'Digital Humanities' bieten nun die Möglichkeit, ohne Kostenaufwand und auf verhältnismäßig einfache Weise große Korpora, im Hinblick auf den Einfluss des Faktors Geschlecht auf die Sprache, miteinander zu vergleichen und auf verschiedene Arten zu analysieren. So lassen sich aus großen Textmengen unter anderem Wortlisten extrahieren, die es ermöglichen, die geschlechtsspezifischen Unterschiede, vor allem in Bezug auf den Wortschatz, zu untersuchen.
Diese Ausarbeitung soll neben dem Untersuchungsgegenstand 'Frauensprache - Männersprache' einen besonderen Fokus auf die technischen Details und Möglichkeiten der 'Digital Humanities' legen, insbesondere auf frei zugängliche Programme ('R' und 'Rstudio' mit dem 'stylo'-Modul, 'Gephi', 'AntConc', 'VoyantTools') und Korpora ('ProjectGutenberg', 'WikiSource').
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Analyse
- Korpus
- R-Stylo 'Cluster Analyse'
- R-Stylo 'Consensus Tree'
- Gephi Visualisierungen
- R-Stylo 'Oppose'-Funktion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit sprachlichen Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der literarischen Sprache von Männern und Frauen. Sie analysiert ein Korpus französischer Texte aus dem 18.-20. Jahrhundert mithilfe von Methoden der Digital Humanities, um den Einfluss des Geschlechts auf die Sprache zu untersuchen.
- Untersuchung von geschlechtsspezifischen sprachlichen Mustern in literarischen Texten
- Anwendung von Methoden der Digital Humanities, wie R-Stylo und Gephi, zur Analyse großer Textmengen
- Vergleich von Wortfrequenzen und sprachlichen Präferenzen zwischen Autorinnen und Autoren
- Analyse der sprachlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen „Frauensprache“ und „Männersprache“
- Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf die bestehende Forschung zu geschlechtsspezifischer Sprache
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert das bestehende Wissen zu geschlechtsspezifischer Sprache. Sie führt in die Methoden der Digital Humanities ein und beschreibt die Auswahl des Korpus sowie die verwendeten Analysetools.
Das Kapitel „Analyse“ beschreibt die Zusammensetzung des Korpus, die Anwendung von R-Stylo zur Cluster-Analyse und Erstellung von Consensus Trees sowie die Visualisierung der Ergebnisse mit Gephi. Weiterhin werden die Ergebnisse der Oppose-Funktion präsentiert, die kontrastive Unterschiede in den Wortpräferenzen zwischen Autorinnen und Autoren aufzeigt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Schlüsselbegriffe der Hausarbeit sind Frauensprache, Männersprache, Digital Humanities, R-Stylo, Gephi, Cluster-Analyse, Consensus Tree, Oppose-Funktion, Wortfrequenzen, sprachliche Präferenzen, Emotionswörter.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es typische Unterschiede zwischen Männersprache und Frauensprache?
Klischees sehen Männersprache als sachbezogener und Frauensprache als emotionaler. Die Arbeit untersucht empirisch, ob sich diese Muster in der Literatur des 18.-20. Jahrhunderts bestätigen.
Was sind Digital Humanities?
Digital Humanities nutzen computergestützte Methoden, um große Mengen an Texten (Korpora) statistisch zu analysieren und Muster wie Wortfrequenzen sichtbar zu machen.
Welche Software wird für die Textanalyse verwendet?
Eingesetzt werden Programme wie R (mit dem stylo-Modul), Gephi für Visualisierungen sowie AntConc und VoyantTools.
Was ist eine Cluster-Analyse in der Linguistik?
Eine Cluster-Analyse gruppiert Texte basierend auf ihrer stilistischen Ähnlichkeit, um herauszufinden, ob das Geschlecht der Autoren ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal ist.
Was bewirkt die "Oppose"-Funktion in R-Stylo?
Diese Funktion vergleicht zwei Textgruppen und identifiziert Wörter, die signifikant häufiger von Frauen bzw. Männern verwendet werden, wie z.B. bestimmte Emotionswörter.
- Quote paper
- Raphael Müller (Author), 2016, Männersprache versus Frauensprache. Empirische Untersuchung der literarischen Sprache von Autorinnen und Autoren mit den Mitteln der Digital Humanities, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/324170