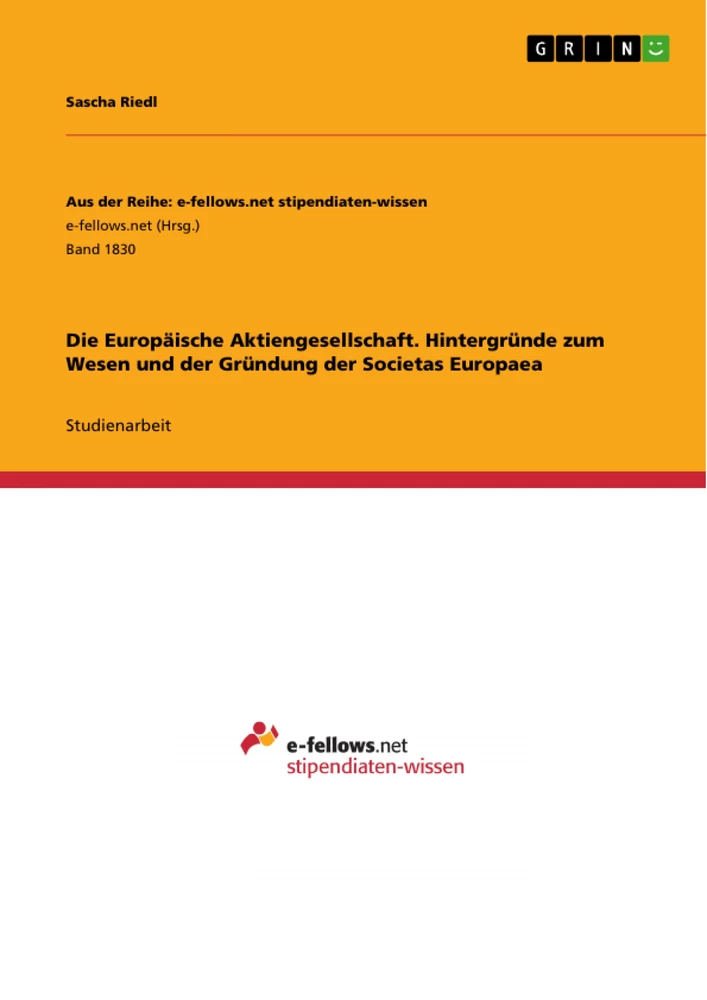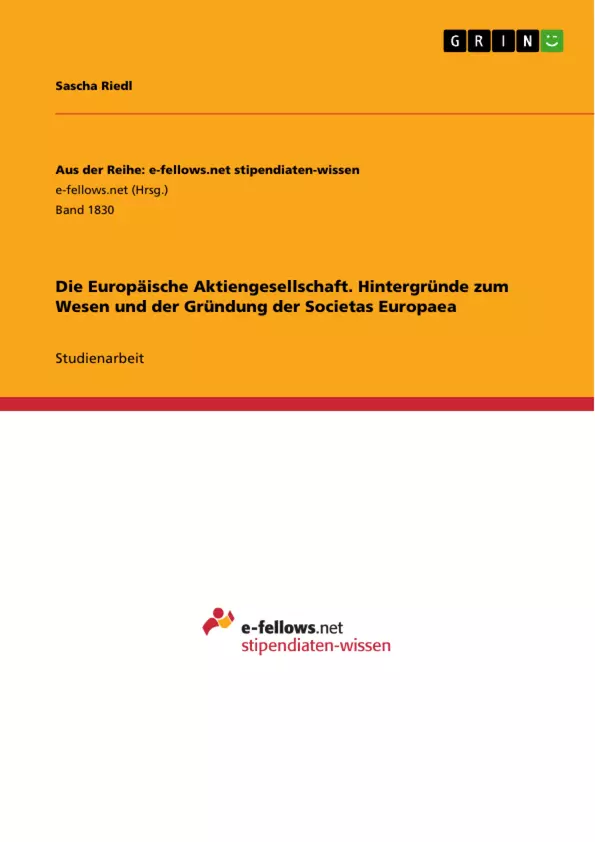Seit dem 08.10.2004 haben europäische Unternehmen mit dem Inkrafttreten der Verordnung über das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft die Möglichkeit, sich als neue und supranationale Rechtsform in Gestalt einer Europäischen Aktiengesellschaft, auch Europa-AG genannt, zu konstituieren. Der Europäische Gesetzgeber bietet somit, nach mehreren Dekaden kontroverser Diskussionen, insbesondere europaweit agierenden Unternehmungen wesentliche Erleichterungen hinsichtlich ihrer Flexibilität und grenz-überschreitenden Mobilität und schafft einen einheitlichen Rahmen für die gemeinsame Organisation global tätiger Unternehmen und Konzerne.
Hintergrund der Einigung nach der Jahrtausendwende und der anschließenden Implementierung der SE in deutsches Recht mit dem SEEG ist der Grundgedanke, eine gesellschaftsrechtliche Organisationsform zu schaffen, die unabhängig vom individuellen Recht der Mitgliedsstaaten ist, sondern lediglich europäischem Recht unterworfen ist. Grenzüberschreitende Betätigungen sollen erleichtert und der bürokratische Aufwand bei Gründung ausländischer Tochterunternehmen vermieden werden. In einer vom globalisierten Wandel geprägten Umwelt wie der unseren macht sich trotz dieser Vorzüge eine gewisse Dezenz bei den inländischen Unternehmen bemerkbar: Neben einigen namhaften Unternehmen wie BASF SE, Porsche SE oder Allianz SE haben sich seit dem Inkrafttreten der SE-VO nur knapp 300 inländische Unternehmen entschieden, sich als Europäische Aktiengesellschaft zu etablieren.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den genannten Problemstellungen und systematisiert alle für die Europäische Aktiengesellschaft relevanten Rechtsvorschriften. Ferner gibt sie einen Überblick über die grundlegende Struktur der Europa-AG und klärt sowohl Haftungs- als auch Mitbestimmungsfragen seitens der Arbeitnehmer. Weiterhin grenzt sie die SE von ihrem nationalen Vorgänger der AG ab und zeigt anschaulich die wesentlichen Vor- und Nachteile des neuen Statuts auf. Zudem wird kurz auf die Besteuerung der Europäischen Aktiengesellschaft eingegangen; aufgrund der Komplexität des Sachverhalts wird sich hierbei auf die laufende inländische Ertragsbesteuerung beschränkt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. RECHTSGRUNDLAGEN
- 3. WESEN DER SOCIETAS EUROPAEA
- 3.1 Merkmale
- 3.2 Organe
- 3.2.1 Monistisches System
- 3.2.2 Dualistisches System
- 4. GRÜNDUNG
- 4.1 Verschmelzung
- 4.2 Errichtung einer Holding-SE
- 4.3 Errichtung einer Tochter-SE
- 4.4 Umwandlung
- 5. ARBEITNEHMERMITBESTIMMUNG
- 6. HAFTUNG
- 7. AUFLÖSUNG DER GESELLSCHAFT
- 8. STEUERLICHE ASPEKTE
- 9. KRITISCHE WÜRDIGUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Europäische Aktiengesellschaft (SE) als neue und supranationale Rechtsform für europäische Unternehmen. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, die Struktur der SE, die Gründungsmöglichkeiten sowie die besonderen Aspekte der Arbeitnehmermitbestimmung und Haftung. Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile der SE im Vergleich zur Aktiengesellschaft (AG) betrachtet, und es wird ein Überblick über die steuerlichen Aspekte gegeben.
- Rechtliche Grundlagen der SE
- Struktur und Organe der SE
- Gründungsmöglichkeiten und -verfahren
- Arbeitnehmermitbestimmung in der SE
- Haftungsregelungen der SE
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Europäische Aktiengesellschaft (SE) vor und erläutert die Hintergründe ihrer Entstehung. Es wird auf die Bedeutung der SE für grenzüberschreitende Unternehmensaktivitäten und die Herausforderungen für Unternehmen bei der Wahl dieser Rechtsform eingegangen.
- Kapitel 2: Rechtsgrundlagen: Hier werden die rechtlichen Grundlagen der SE erläutert, insbesondere die Verordnung über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-VO) und die entsprechenden nationalen Gesetze.
- Kapitel 3: Wesen der Societas Europaea: Dieses Kapitel beleuchtet die Merkmale der SE und beschreibt ihre Organstruktur. Es wird auf die Unterschiede zwischen monistischen und dualistischen Systemen eingegangen.
- Kapitel 4: Gründung: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Möglichkeiten der SE-Gründung, darunter Verschmelzung, Errichtung einer Holding-SE, Errichtung einer Tochter-SE und Umwandlung.
- Kapitel 5: Arbeitnehmermitbestimmung: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Arbeitnehmermitbestimmung in der SE. Es werden die verschiedenen Mitbestimmungsmodelle und deren Umsetzung in der Praxis betrachtet.
- Kapitel 6: Haftung: Dieses Kapitel untersucht die Haftungsregelungen der SE. Es wird auf die Haftung der Gesellschafter, der Organe und der SE selbst eingegangen.
- Kapitel 7: Auflösung der Gesellschaft: Dieses Kapitel behandelt die Auflösung der SE und die verschiedenen Möglichkeiten der Liquidation.
- Kapitel 8: Steuerliche Aspekte: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die steuerlichen Aspekte der SE, wobei der Fokus auf die laufende inländische Ertragsbesteuerung liegt.
Schlüsselwörter
Europäische Aktiengesellschaft (SE), Societas Europaea, Rechtsform, Gründung, Arbeitnehmermitbestimmung, Haftung, Steuerliche Aspekte, SE-VO, SEEG, AG, grenzüberschreitende Unternehmensaktivitäten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Societas Europaea (SE)?
Die SE, auch Europa-AG genannt, ist eine supranationale Rechtsform für Aktiengesellschaften in der EU, die grenzüberschreitende Mobilität und eine einheitliche Organisation ermöglicht.
Welche Gründungsmöglichkeiten gibt es für eine SE?
Eine SE kann durch Verschmelzung, Errichtung einer Holding- oder Tochtergesellschaft oder durch Umwandlung einer bestehenden nationalen AG gegründet werden.
Was ist der Unterschied zwischen dem monistischen und dualistischen System?
Im dualistischen System gibt es Vorstand und Aufsichtsrat (Trennung), während im monistischen System ein einziger Verwaltungsrat die Leitung und Überwachung übernimmt.
Wie ist die Arbeitnehmermitbestimmung in der SE geregelt?
Die Mitbestimmung basiert auf Verhandlungen zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretern, wobei das Prinzip der Vorher-Nachher-Sicherung gilt.
Welche steuerlichen Besonderheiten gelten für die Europa-AG?
Die SE unterliegt in der Regel der laufenden Ertragsbesteuerung des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, wobei grenzüberschreitende Erleichterungen angestrebt werden.
- Quote paper
- Sascha Riedl (Author), 2015, Die Europäische Aktiengesellschaft. Hintergründe zum Wesen und der Gründung der Societas Europaea, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/324176