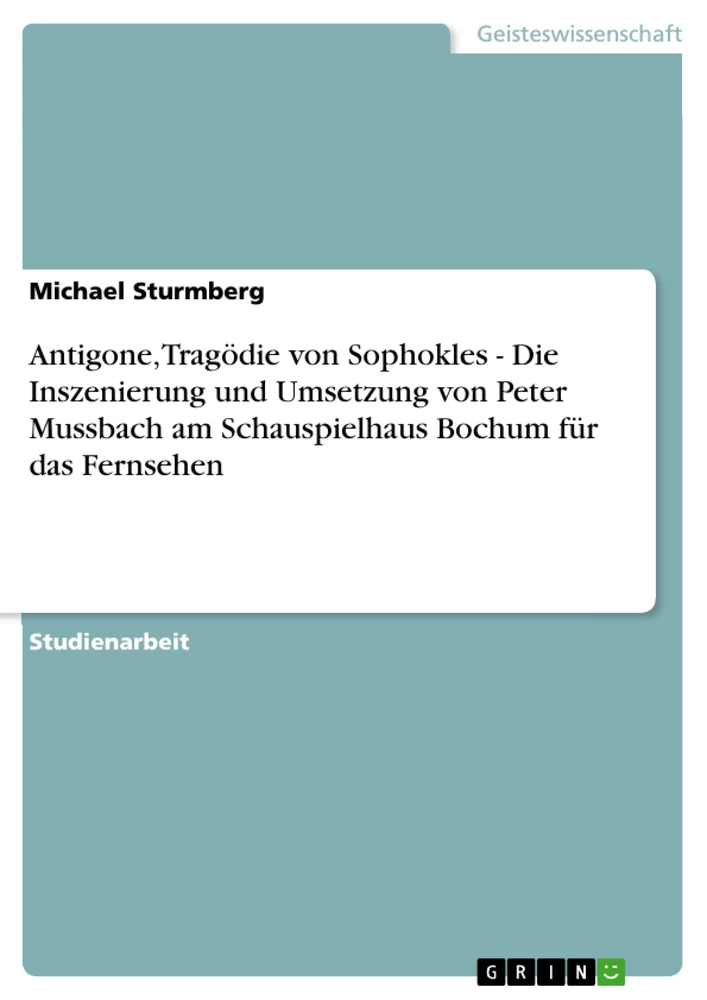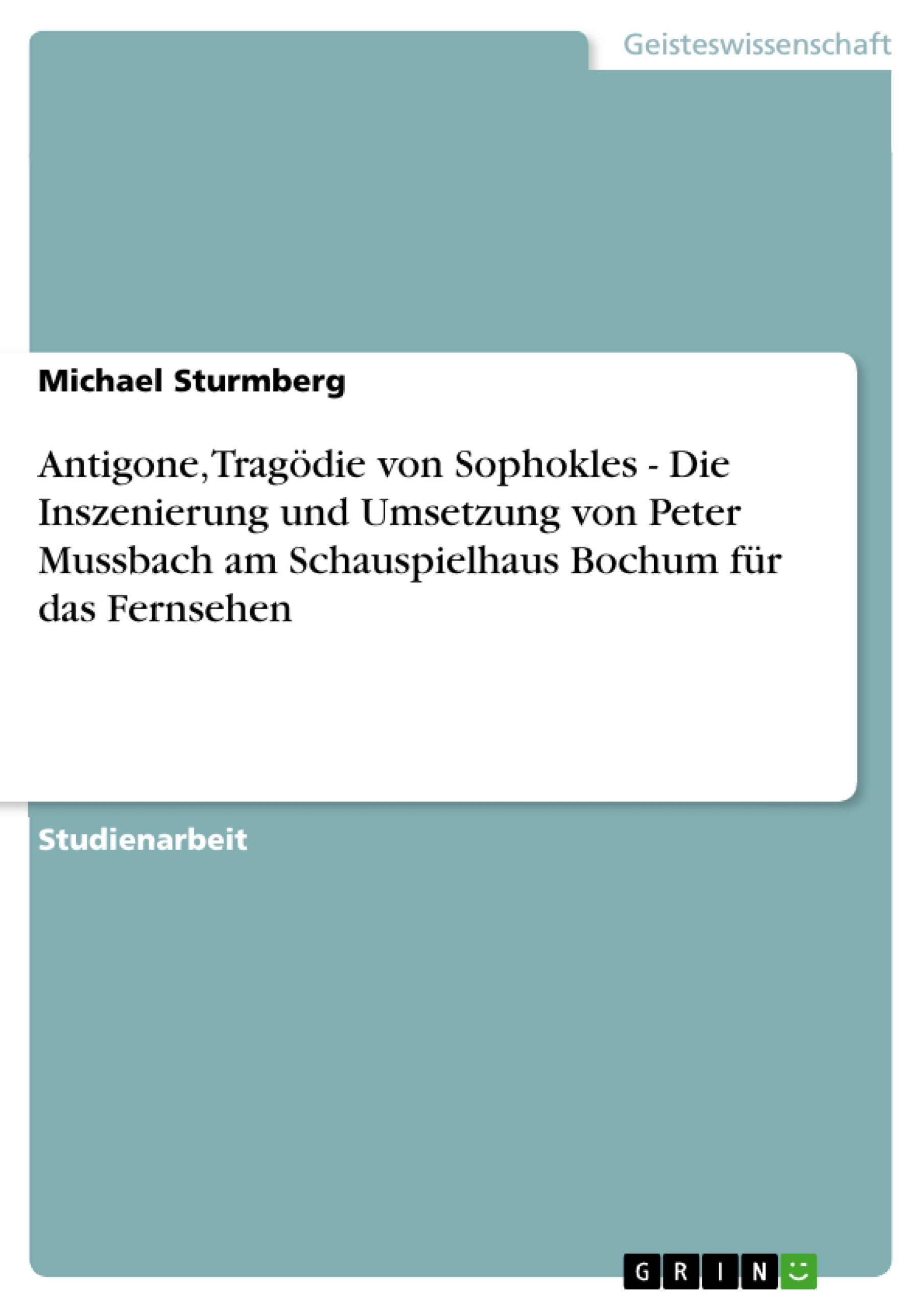Die Tragödie „Antigone“ von Sophokles wurde vor über 2400 Jahren (vermutlich im Jahr 442 oder 441 v. Chr.) in Athen zum ersten Mal aufgeführt. Heute ist das Stück eine der sieben erhaltenen Tragödien von Sophokles (insgesamt hatte er 123 geschrieben), die überliefert worden sind. Zahlreiche Übersetzungen und Bearbeitungen hat es seitdem zur Antigone gegeben. Und auch in den letzten Jahrzehnten wurde der Mythos durch verschiedene Inszenierungen immer wieder unterschiedlich behandelt und aufgegriffen. Bedeutende Aufführungen hat es z. B. 1978 in Frankfurt, Bremen und Berlin gegeben, die vor allem durch einen politischen Kontext bestimmt waren. Spätere Aufführungen lösten sich jedoch von einem politisch motivierten Hintergrund und setzten andere Schwerpunkte, wie z. B. den Geschlechterkampf zwischen Mann (Kreon) und Frau (Antigone) .
Auf der einen Seite haben wir es dabei mit Inszenierungen zu tun, die sich um eine möglichst originalgetreue Wiedergabe bemühen, d. h. denen der Aufführungsstil der Antike zu Grunde liegt. Demgegenüber stehen auf der anderen Seite bewusst modernisierte Inszenierungen, die z. B. durch die Art der Bühnengestaltung, der Figuren und deren schauspielerische Leistung den religiös-kultisch bestimmten Gehalt der griechischen Tragödie auf andere Weise vermitteln .
Zur letztgenannten Gruppe zählt u. a. die Inszenierung von Peter Mussbach, die 1988 im Schauspielhaus Bochum aufgeführt und – eigens für das Fernsehen produziert – 1989 im ZDF ausgestrahlt worden ist und in dieser Arbeit näher betrachtet werden soll. Signifikant ist bei Peter Mussbachs Antigone vor allem die sehr zeitlose Gestaltung, die ihm durch seine Modernisierung gelang. Neben der Inszenierung wird deshalb auch auf ihre Adaption für das Fernsehen eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Inhalt
- 2. Einleitung
- 3. Die Inszenierung
- 3.1 Übersetzung nach Schadewaldt und Hölderlin
- 3.2 Bühnengestaltung und Licht
- 3.3 Darstellung, Einsatz und Wirkung der Figuren
- 4. Die Umsetzung für das Fernsehen
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Inszenierung von Peter Mussbachs Antigone am Schauspielhaus Bochum und deren Umsetzung für das Fernsehen (ZDF, 1989). Ziel ist es, die spezifischen Entscheidungen Mussbachs hinsichtlich Übersetzung, Bühnengestaltung und Adaption für das Medium Fernsehen zu beleuchten und deren Wirkung zu untersuchen.
- Die Wahl der Übersetzung (Schadewaldt/Hölderlin) und deren Einfluss auf die Inszenierung
- Die Bühnengestaltung und Lichtsetzung als Mittel der Dramaturgie
- Die Darstellung der Hauptfiguren und deren Interaktion
- Die Adaption der Inszenierung für das Fernsehen und die damit verbundenen Herausforderungen
- Die zeitlose Gestaltung der Inszenierung trotz des antiken Stoffes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Inhalt: Dieses Kapitel dient lediglich als Inhaltsverzeichnis und bietet keine zusammenfassende Information.
2. Einleitung: Die Einleitung gibt einen kurzen Überblick über die Geschichte der Antigone-Aufführungen, von den ersten Aufführungen in Athen bis hin zu modernen Inszenierungen. Sie hebt die verschiedenen Interpretationsansätze hervor, von originalgetreuen Wiedergaben bis hin zu modernen Adaptionen, und positioniert Mussbachs Inszenierung innerhalb dieses Kontextes als ein Beispiel für eine zeitlose Modernisierung.
3. Die Inszenierung: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Aspekte der Inszenierung. Es beginnt mit der Diskussion der Übersetzung, wobei die Wahl von Schadewaldts Übersetzung für die meisten Figuren und Hölderlins Übersetzung für Teiresias detailliert untersucht wird. Die Bedeutung der dokumentarischen Übersetzung Schadewaldts für die zeitlose Wirkung der Inszenierung wird hervorgehoben. Die Entscheidung, die Figur der Eurydike auszulassen und den Fokus auf Kreon, Antigone und Haimon zu legen, wird ebenfalls erläutert. Abschließend wird die Verwendung von Bühnengestaltung und Licht als Mittel zur Vermittlung des religiös-kultischen Gehalts der griechischen Tragödie behandelt.
Schlüsselwörter
Antigone, Sophokles, Peter Mussbach, Schauspielhaus Bochum, ZDF, Inszenierung, Übersetzung (Schadewaldt, Hölderlin), Bühnengestaltung, Licht, Fernseh-Adaption, zeitlose Gestaltung, griechische Tragödie, Geschlechterkampf.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Antigone-Inszenierung von Peter Mussbach
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Inszenierung von Peter Mussbachs Antigone am Schauspielhaus Bochum und deren Umsetzung für das Fernsehen (ZDF, 1989). Im Fokus stehen Mussbachs Entscheidungen bezüglich Übersetzung, Bühnengestaltung und Adaption für das Fernsehmedium und deren Wirkung.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit untersucht die Wahl der Übersetzung (Schadewaldt/Hölderlin) und deren Einfluss, die Bühnengestaltung und Lichtsetzung als dramaturgische Mittel, die Darstellung der Hauptfiguren und deren Interaktion, die Adaption für das Fernsehen und die damit verbundenen Herausforderungen, sowie die zeitlose Gestaltung der Inszenierung trotz des antiken Stoffes.
Welche Übersetzungen wurden verwendet und warum?
Für die meisten Figuren wurde die Übersetzung von Schadewaldt verwendet, während für Teiresias die Übersetzung von Hölderlin zum Einsatz kam. Die dokumentarische Übersetzung Schadewaldts wird als wichtig für die zeitlose Wirkung der Inszenierung hervorgehoben.
Welche Rolle spielen Bühnengestaltung und Licht?
Bühnengestaltung und Lichtsetzung werden als Mittel der Dramaturgie analysiert und ihre Bedeutung für die Vermittlung des religiös-kultischen Gehalts der griechischen Tragödie untersucht.
Wie wurde die Inszenierung für das Fernsehen adaptiert?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und spezifischen Entscheidungen bei der Adaption der Inszenierung für das Fernsehmedium. Leider werden die genauen Adaptionsmaßnahmen nicht im Detail in der Zusammenfassung beschrieben.
Welche Figuren stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf Kreon, Antigone und Haimon. Die Figur der Eurydike wurde in dieser Inszenierung ausgelassen.
Welches Kapitel bietet eine Zusammenfassung des Inhalts?
Kapitel 2 (Einleitung) bietet einen Überblick über die Geschichte der Antigone-Aufführungen und positioniert Mussbachs Inszenierung in diesem Kontext. Kapitel 3 (Die Inszenierung) analysiert detailliert die verschiedenen Aspekte der Inszenierung. Die restlichen Kapitel (Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis) bieten keine zusammenfassenden Informationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Antigone, Sophokles, Peter Mussbach, Schauspielhaus Bochum, ZDF, Inszenierung, Übersetzung (Schadewaldt, Hölderlin), Bühnengestaltung, Licht, Fernseh-Adaption, zeitlose Gestaltung, griechische Tragödie, Geschlechterkampf.
- Arbeit zitieren
- Michael Sturmberg (Autor:in), 2004, Antigone, Tragödie von Sophokles - Die Inszenierung und Umsetzung von Peter Mussbach am Schauspielhaus Bochum für das Fernsehen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32531