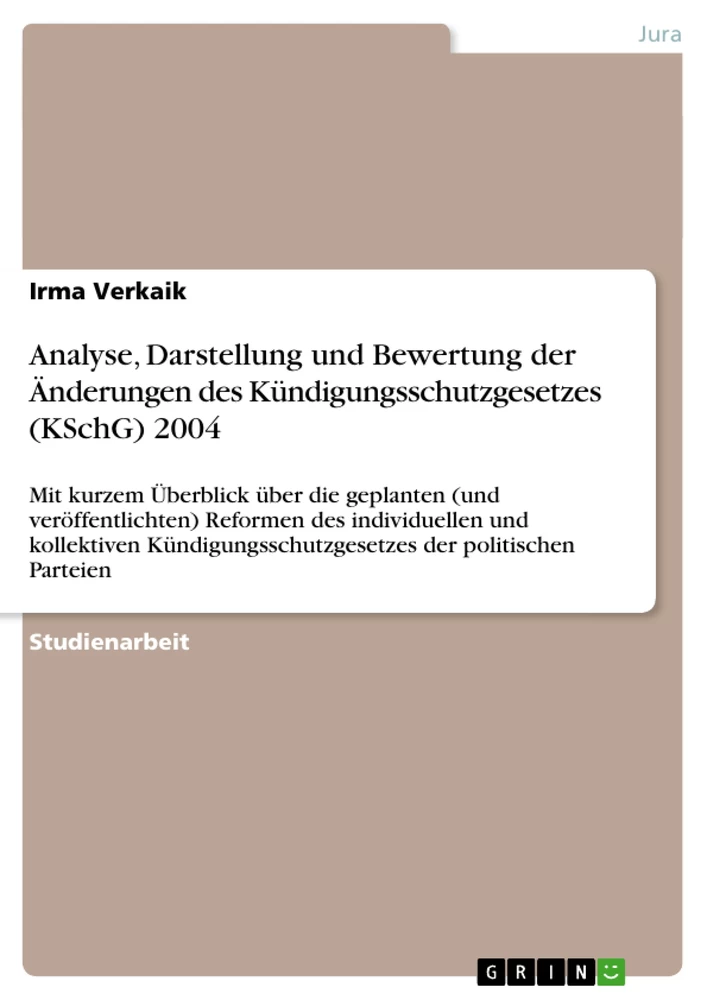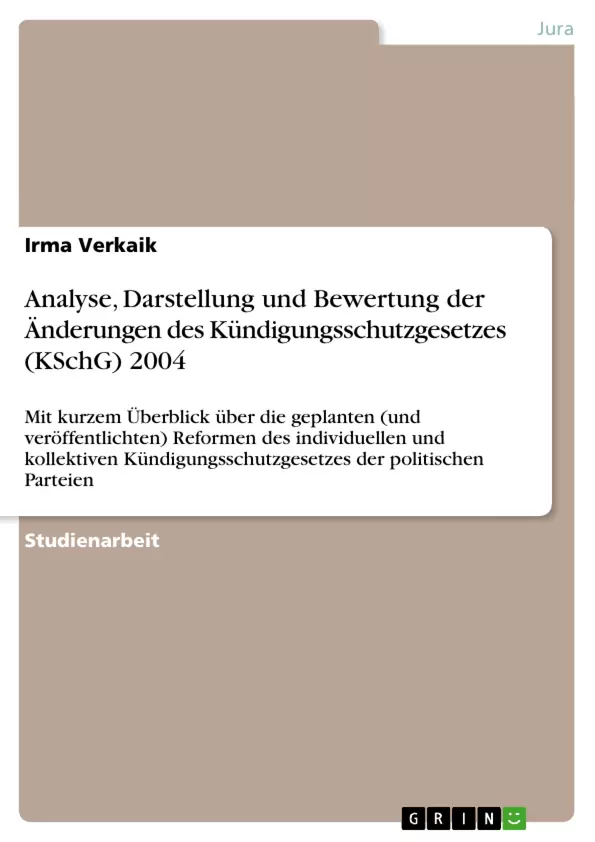Das KSchG wurde 1951 geschaffen, um ,,sozial ungerechtfertigten Kündigungen" vorzubeugen. 1951 wurde ein Kompromiss in den Hattenheimer-Gesprächen geschlossen, der im Wesentlichen den heutigen Regelungen des KSchG entspricht. Laut Frau Dr. Engelen-Kefer ist das KSchG das Ergebnis von Beratungen zwischen den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Es wurde daher nicht von den Gewerkschaften durchgesetzt. Im 19. Jahrhundert hatten Arbeitgeber völlige Handlungsfreiheit bei Entlassungen. Dies bewirkte einen harten Wettbewerb um Arbeitsplätze mit niedrigen Löhnen und Gehältern. Mit der Einführung des KSchG sollte diese absolute Handlungsfreiheit der Arbeitgeber in Zukunft eingeschränkt werden. Außerdem existierten oft keine Arbeitsverträge, so dass die Arbeitnehmer nach betriebsbedingten Entlassungen keine Abfindung erhielten. Das KSchG sollte dieses ,,soziale Defizit" gesetzlich aufheben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Grundsätze und Zielsetzung des deutschen Kündigungsschutzgesetzes (KSchG)
- 1.2 Zusammenhang zwischen KSchG und Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
- 1.3 Einfluss des Betriebsrates im Rahmen des KSchG auf die Wirksamkeit von Kündigungen
- 1.4 Daten, Fakten zur Auflösung von Kündigungsverhältnissen und Abfindungen
- 1.5 Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes
- 1.5.1 abhängig von der Betriebsgröße
- 1.5.2 abhängig von der Vertragsdauer
- 1.5.3 abhängig von der Kündigungsart
- 1.5.4 für verschiedene Personengruppen
- 1.6 Ausnahmen vom Geltungsbereich des KSchG
- 1.6.1 Ausnahmen für außerordentliche Kündigungen
- 1.6.2 Auswirkungen auf den fehlenden Kündigungsschutz in Kleinbetrieben
- 2. Gründe für die Notwendigkeit der Änderungen des KSchG ab 01.01.2004
- 2.1 Konzepte der politischen Parteien
- 2.1.1 FDP
- 2.1.2 CDU/CSU
- 2.1.3 Bundesregierung (SPD/Grüne)
- 2.2 Bewertungen und Gründe der Änderungen KSchG 2004 durch Verbände/Institutionen
- 2.2.1 Bundesvereinigung der deutschen AG-Verbände (BDA)
- 2.2.2 Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)/IG Metall
- 2.2.3 Bundesverband der deutschen Industrie (BDI)
- 2.2.4 Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln)
- 2.2.5 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung
- 2.2.6 Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
- 3. Änderungen 2004
- 3.1 Änderungen des Kündigungsschutzgesetzes (ab 01.01.20004)
- 3.2 Erläuterung der Hauptänderungsbestandteile
- 3.3 Vergleich Abwicklungsvertrag/Aufhebungsvertrag vor und nach 2004 (§ 1a KSchG)
- 3.4 Auswirkungen, Abwägung und Bewertung der Änderungen 2004 (ab 01.01.2004) des KSchG im Hinblick auf Beschäftigte, Arbeitgeber und Betriebsrat
- 4. Geplante Änderungen
- 4.1 Konzepte der politischen Parteien
- 4.1.1 FDP
- 4.1.2 CDU/CSU
- 4.1.3 Bundesregierung (SPD/Grüne)
- 4.2 Gegenüberstellung der Konzepte der politischen Parteien
- 4.3 Bewertung der Konzepte der politischen Parteien zum KSchG
- 4.4 Konzepte der Verbände/Institutionen
- 4.4.1 Bundesvereinigung der deutschen AG-Verbände (BDA)
- 4.4.2 IG Metall/Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
- 4.4.3 Forderungen und Gründe der IGM und des BDA zu weiteren Änderungen des KSchG
- 4.4.4 Bundesverband der deutschen Industrie (BDI)
- 4.4.5 Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln)
- 4.4.6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung
- 4.4.7 Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
- 4.4.8 Max-Planck-Institut (MPI)
- 4.4.9 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
- 5. Fazit
- 5.1 Auswirkungen der Änderungen 2004 und der geplanten Änderungen
- 5.1.1 auf unsere Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert und bewertet die Änderungen des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) im Jahr 2004. Dabei wird insbesondere die Entwicklung der Gesetzgebung unter Berücksichtigung der Positionen verschiedener politischer Parteien und Verbände/Institutionen beleuchtet. Die Arbeit beleuchtet auch die Auswirkungen dieser Änderungen auf Beschäftigte, Arbeitgeber und Betriebsräte. Des Weiteren werden die geplanten Reformen des KSchG, die im Fokus der politischen Debatte stehen, untersucht und bewertet.
- Entwicklung und Zielsetzung des Kündigungsschutzgesetzes
- Einfluss des KSchG auf Arbeitsbeziehungen und Arbeitsmarkt
- Positionen und Strategien politischer Parteien im Kontext des KSchG
- Bewertung der KSchG-Änderungen 2004 aus verschiedenen Perspektiven
- Analyse der geplanten Reformen und deren potenziellen Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Kündigungsschutzgesetz (KSchG), beleuchtet seine Grundsätze, Zielsetzung und den Zusammenhang mit dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Kapitel 1 behandelt außerdem den Einfluss des Betriebsrates auf die Wirksamkeit von Kündigungen und präsentiert Daten und Fakten zur Auflösung von Kündigungsverhältnissen und Abfindungen. Anschließend wird der Geltungsbereich des KSchG unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Das zweite Kapitel geht auf die Gründe für die Notwendigkeit der Änderungen des KSchG ab 01.01.2004 ein und beleuchtet die Konzepte verschiedener politischer Parteien, sowie Bewertungen und Gründe der Änderungen durch Verbände/Institutionen.
Im dritten Kapitel werden die Änderungen des KSchG ab 01.01.2004 erläutert und die Hauptänderungsbestandteile vorgestellt. Es wird ein Vergleich zwischen Abwicklungsvertrag/Aufhebungsvertrag vor und nach 2004 (§ 1a KSchG) durchgeführt und die Auswirkungen, Abwägung und Bewertung der Änderungen 2004 im Hinblick auf Beschäftigte, Arbeitgeber und Betriebsrat beleuchtet.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit den geplanten Änderungen des KSchG. Es werden die Konzepte der politischen Parteien vorgestellt, eine Gegenüberstellung der Konzepte durchgeführt und die Bewertung der Konzepte der politischen Parteien zum KSchG präsentiert. Der Abschnitt behandelt außerdem die Konzepte verschiedener Verbände/Institutionen, deren Forderungen und Gründe zu weiteren Änderungen des KSchG. Der Abschnitt endet mit einer Analyse der Perspektiven des Max-Planck-Instituts (MPI) und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Das letzte Kapitel beinhaltet das Fazit der Seminararbeit. Es werden die Auswirkungen der Änderungen 2004 und der geplanten Änderungen auf unsere Gesellschaft beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), Betriebsrat, Abfindungen, Abwicklungsvertrag, Aufhebungsvertrag, politische Parteien, Verbände, Institutionen, Beschäftigte, Arbeitgeber, Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt, Regulierung, Reform, Änderungen, Auswirkungen, Bewertung
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der KSchG-Reform 2004?
Die Reform zielte auf eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes ab, wobei insbesondere Schwellenwerte für die Betriebsgröße und Regelungen zu Abfindungen angepasst wurden.
Wie änderte sich der Geltungsbereich bezüglich der Betriebsgröße?
Die Arbeit erläutert die Grenzen, ab denen der Kündigungsschutz in Kleinbetrieben greift und welche Auswirkungen dies auf den Kündigungsschutz der Beschäftigten hat.
Was besagt der neue § 1a KSchG?
Er führt einen gesetzlichen Abfindungsanspruch bei betriebsbedingten Kündigungen ein, wenn der Arbeitnehmer auf eine Kündigungsschutzklage verzichtet.
Welche Positionen vertraten die politischen Parteien?
Die Arbeit stellt die Konzepte von FDP, CDU/CSU und der damaligen Bundesregierung (SPD/Grüne) gegenüber, die von Forderungen nach mehr Flexibilität bis zum Erhalt sozialer Standards reichten.
Welche Rolle spielt der Betriebsrat beim Kündigungsschutz?
Es wird untersucht, wie der Einfluss des Betriebsrates und das Betriebsverfassungsgesetz die Wirksamkeit von Kündigungen im Rahmen des KSchG beeinflussen.
- Arbeit zitieren
- Irma Verkaik (Autor:in), 2004, Analyse, Darstellung und Bewertung der Änderungen des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) 2004, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32618