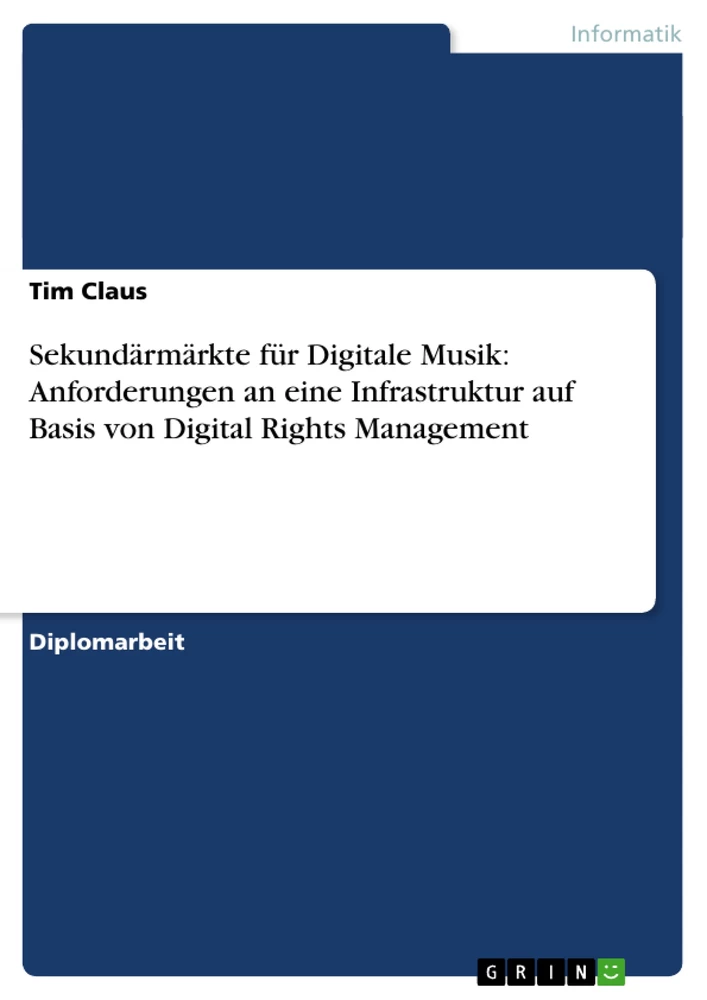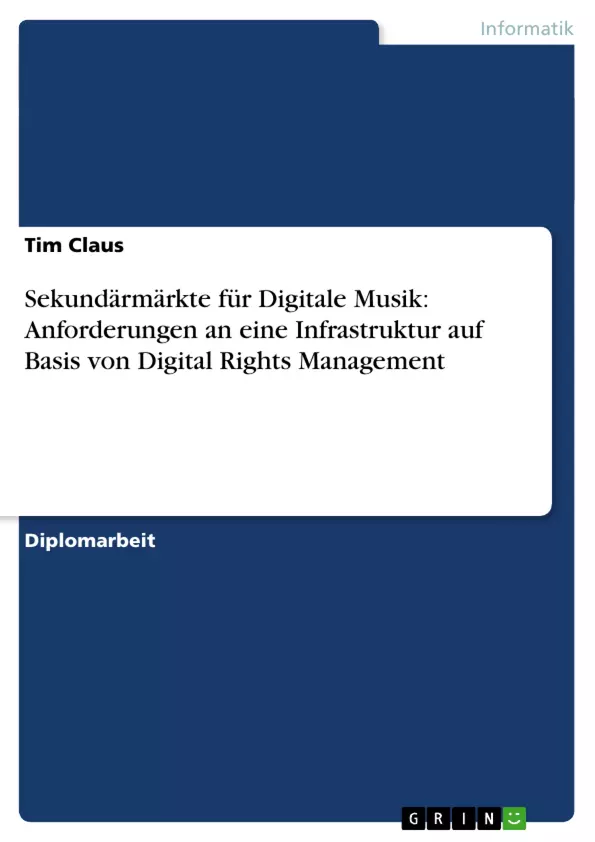Weltweit steht die Musikindustrie heute vor der vielleicht größten Herausforderung seit
ihrem Bestehen. Die seit Ende der 90er Jahre aufstrebende Popularität des Internets und
der darin operierenden Dateitauschbörsen wie Napster oder Kazaa bedrohen die traditionellen
Vertriebskanäle der Musikbranche durch den millionenfachen Tausch illegaler
Musikkopien. Der Internationale Verband der Phonographischen Industrie schätzte für
2001, dass 99% aller im Internet verfügbaren Musikstücke raubkopiert wurden.1 Während
Anfang 2003 13% aller europäischen Internetnutzer ihren Zugang dazu nutzten
illegal Musik herunterzuladen, so waren dies im vergleichbaren Zeitraum in den USA
bereits 29% aller erwachsenen Internetnutzer.2
In Reaktion auf diese alarmierenden Kennzahlen verfolgt die Musikbranche eine vielseitige
Gegenstrategie, die zum einen darauf beruht, durch Verwarnungen und Schadensersatzklagen
gegen Tauschbörsenbenutzer vorzugehen, die illegal Musik über das
Internet verbreiten.3 Zum anderen wird versucht, durch Kopierschutzverfahren das Einlesen
von Musik CDs in Computersysteme zu unterbinden und diese Schutzmaßnahmen
durch die Unterstützung eines restriktiveren Urheberrechts gesetzlich zu legitimieren
und vor Umgehung zu schützen.4 Als zukunftsträchtigste Strategie allerdings beurteilen
Marktforschungsinstitute die zunehmende Erschließung digitaler Vertriebswege durch
die Musikindustrie.5 Hierbei soll die Schaffung legaler Alternativen zum illegalen Musikdownload
in Kombination mit der bereits angesprochenen Androhung juristischer
Schritte vormals illegale Tauschbörsennutzer zu legalen Kunden machen.6 Die technische
Basis für den Musikerwerb über legale Musikplattformen wie iTunes oder Napster
2.0 bilden so genannte Digital Rights Management Systeme (DRM). Diese sollen in
erster Linie verhindern, dass in digitaler Form erworbene Musikstücke dupliziert und
weiterverbreitet werden können. Darüber hinaus regulieren sie die Nutzungsrechte des
Käufers einer geschützten Musikdatei, indem nur gewisse Nutzungsarten erlaubt bzw.
in ihrer Inanspruchnahme quantitativ oder temporär eingeschränkt werden.7 [...]
1 Vgl. IFPI (2002), S. 9.
2 Vgl. RAINE, et al. (2004), S. 4; WILKENS (2003a).
3 Vgl. KURI (2003a); KURI (2003b).
4 Vgl. HALDERMAN (2002).
5 Vgl. PETER (2002), S. 20-21; LAU (2004).
6 Vgl. RAINE, et al. (2004), S. 1.
7 Vgl. RUMP (2003), S. 3-4.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung & Zielsetzung
- Gang der Untersuchung
- Definitorische und ökonomische Einordnung von Musik als digitales Gut
- Begriffliche Abgrenzung und elementare Eigenschaften digitaler Güter
- Ökonomische Eigenschaften digitaler Güter
- Einordnung des Gutes Musik in die Klassifikation digitaler Güter
- Das deutsche Urheberrecht
- Die historische Legitimation des deutschen Urheberrechts
- Das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft
- Die EU Richtlinie 2001/29/EG
- Sekundärmärkte tangibler Gebrauchsgüter
- Die Novellierung des deutschen Urheberrechts
- Der Erschöpfungsgrundsatz im deutschen Urheberrecht
- Sekundärmärkte für digitale Gebrauchsgüter
- Definition Sekundärmarkt
- Gütertypologien und Motivationsgründe
- Markttypologien
- Sekundärmärkte intangibler Anlagegüter
- Gütertypologien und Motivationsgründe
- Die Börse als zentraler Sekundärmarkt
- Sekundärmärkte intangibler Gebrauchsgüter in Form digitaler Musik
- Digital Rights Management
- Definitorische Grundlagen und das 3-Beine Modell
- Technische Bestandteile eines DRM Systems
- Referenzarchitektur eines DRM Systems
- Sicherheitsstrukturen in einem DRM System
- Zugangs- und Nutzungskontrolle
- Metadaten
- Authentizität und Integrität
- Trusted Computing
- Kritische Würdigung
- Rechtlicher Schutz in einem DRM System
- Schutz der DRM Entwickler und Urheber
- Schutz durch Nutzungsverträge
- Schutz durch Technologie-Lizenzverträge
- Schutz durch Urheberrecht
- Schutz der Nutzer
- Schutz der Privatsphäre
- Schutz der Privatkopie
- Kritische Würdigung
- DRM Geschäftsmodelle im Musikbereich nach Protektionsgrad
- Restriktives DRM am Beispiel von Musicload
- Lockeres DRM am Beispiel von iTunes
- DRM gestützte Sekundärmarktmodelle für digitale Musik
- Zentralistisches Sekundärmarktmodell
- Aufbau
- Transaktionsprozesse und Informationsfluss
- Sicherheitsstrukturen
- Integrationsmöglichkeiten in bestehende DRM Modelle
- Verteiltes Sekundärmarktmodell
- Aufbau
- Transaktionsprozesse und Informationsfluss
- Sicherheitsstrukturen
- Integrationsmöglichkeiten in bestehende DRM Modelle
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Infrastruktur für Sekundärmärkte für digitale Musik auf Basis von Digital Rights Management (DRM). Die Arbeit analysiert die spezifischen Herausforderungen, die sich aus der digitalen Natur von Musik und den rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben.
- Definition und ökonomische Einordnung von Musik als digitales Gut
- Rechtliche Aspekte des Sekundärmarkts im Kontext des Urheberrechts
- Funktionsweise und Anforderungen von DRM-Systemen
- Entwicklung von Sekundärmarktmodellen für DRM-geschützte Musik
- Analyse der technischen und rechtlichen Machbarkeit der Modelle
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problemstellung dar und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Der Gang der Untersuchung wird skizziert.
- Kapitel 2 befasst sich mit der definitorischen und ökonomischen Einordnung von Musik als digitales Gut. Die Eigenschaften digitaler Güter werden im Vergleich zu tangiblen Gütern erläutert.
- Kapitel 3 beleuchtet das deutsche Urheberrecht und seine historische Entwicklung. Der Fokus liegt auf der Relevanz des Urheberrechts für die Informationsgesellschaft und insbesondere für digitale Inhalte.
- Kapitel 4 analysiert die Funktionsweise von Sekundärmärkten für tangibler Gebrauchsgüter und überträgt die gewonnenen Erkenntnisse auf den Bereich der digitalen Musik. Die Kapitel 4.1 und 4.2 befassen sich mit der Novellierung des deutschen Urheberrechts und dem Erschöpfungsgrundsatz.
- Kapitel 5 stellt das Konzept von Digital Rights Management (DRM) vor. Die technischen Bestandteile eines DRM-Systems und seine rechtlichen Aspekte werden erläutert. Die Kapitel 5.1 und 5.2 beleuchten die definitorischen Grundlagen und die technischen Bestandteile eines DRM-Systems. Die Kapitel 5.3 und 5.4 widmen sich dem rechtlichen Schutz in einem DRM-System und den Geschäftsmodellen im Musikbereich nach Protektionsgrad.
- Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Entwicklung von zwei verschiedenen Sekundärmarktmodellen für DRM-geschützte Musik: ein zentralistisches und ein verteiltes Modell. Die Kapitel 6.1 und 6.2 analysieren Aufbau, Transaktionsprozesse, Sicherheitsstrukturen und Integrationsmöglichkeiten der Modelle.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen Sekundärmärkte, digitale Musik, Digital Rights Management (DRM), Urheberrecht, Informationsgesellschaft, Geschäftsmodelle, technische Infrastruktur, Rechtssicherheit und Datenschutz.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Sekundärmärkte für digitale Musik?
Es handelt sich um Märkte, auf denen bereits erworbene digitale Musikdateien legal weiterverkauft werden können, ähnlich wie gebrauchte CDs.
Welche Rolle spielt Digital Rights Management (DRM) dabei?
DRM-Systeme bilden die technische Basis, um Nutzungsrechte zu regulieren und sicherzustellen, dass Dateien beim Weiterverkauf vom Verkäufer gelöscht werden.
Was ist der Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht?
Dieser Grundsatz besagt, dass sich das Verbreitungsrecht des Urhebers erschöpft, sobald ein Werkstück mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht wurde – die Arbeit prüft die Übertragbarkeit auf digitale Güter.
Welche Sekundärmarktmodelle werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen einem zentralistischen Modell (zentrale Kontrolle) und einem verteilten Sekundärmarktmodell.
Wie schützt DRM die Privatsphäre der Nutzer?
Die Arbeit unterzieht den rechtlichen Schutz in DRM-Systemen einer kritischen Würdigung, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz und die Privatkopie.
- Arbeit zitieren
- Tim Claus (Autor:in), 2004, Sekundärmärkte für Digitale Musik: Anforderungen an eine Infrastruktur auf Basis von Digital Rights Management, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32631