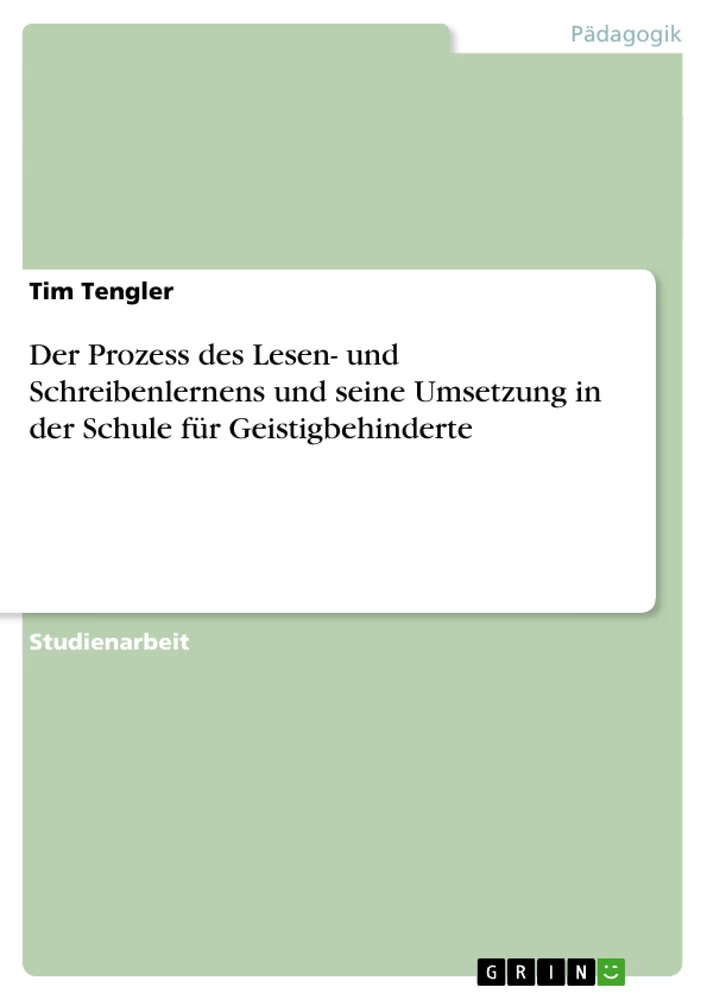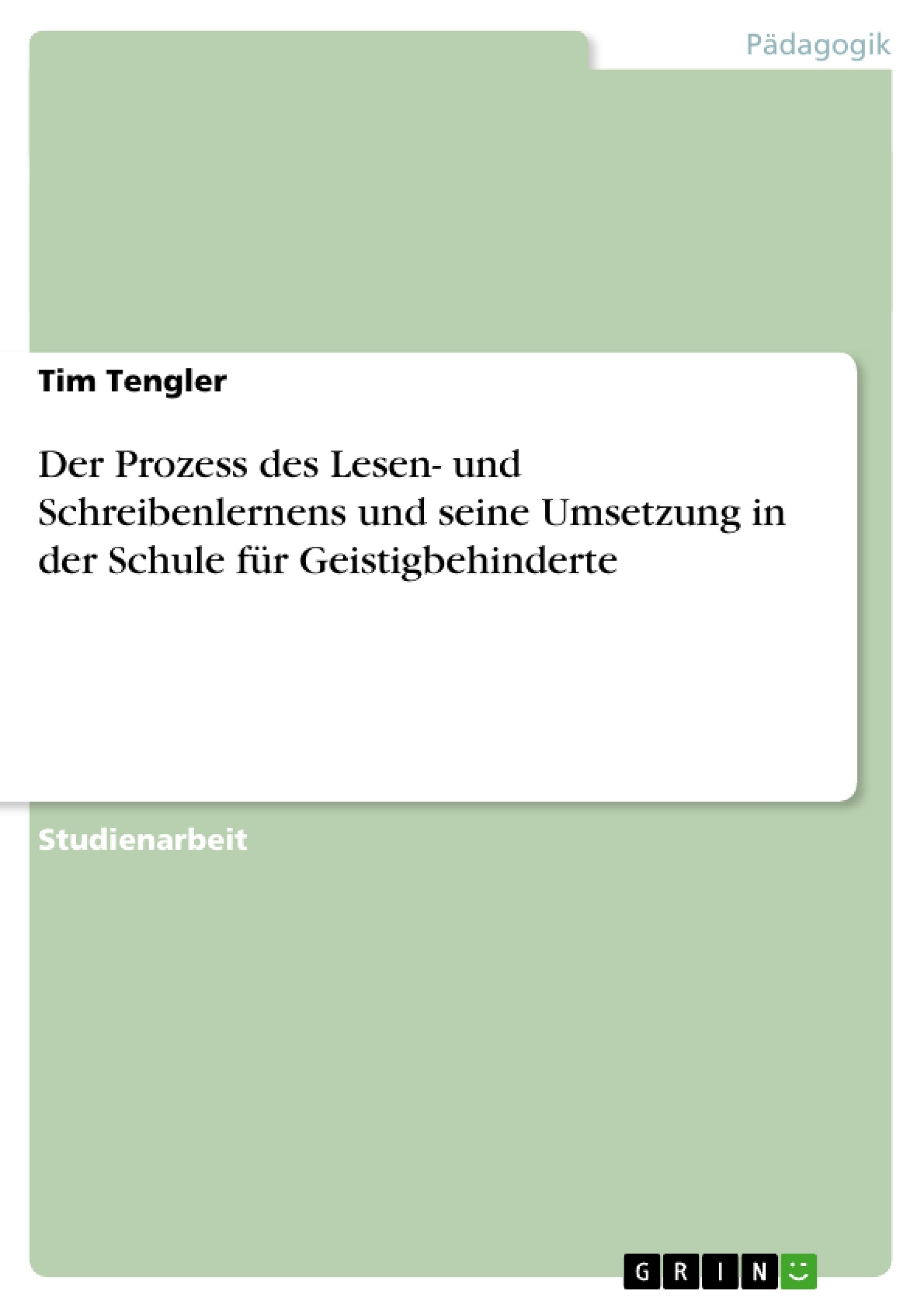Die Kommunikation durch Sprache und Schrift ist nicht nur für „normale“ Kinder und Ju-gendliche von elementarer Wichtigkeit, sondern auch für solche Menschen, die durch einen Entwicklungsrückstand behindert sind. Lesen und Schreiben hat für alle Menschen eine kommunikative Bedeutung. Ob wir ein Buch, einen Brief oder eine Seite im Internet lesen, immer teilt uns der Verfasser des Textes etwas mit, ob er uns kennt oder nicht. Wenn wir schreiben, beabsichtigen wir, anderen etwas von unseren Gedanken mitzuteilen oder unsere Gedanken „zu konservieren“, damit wir sie später wieder zur Kommunikation verwenden können. Schrift ist also gleichermaßen „gefrorenes“ Wort und „konserviertes“ Gedankengut. Diese Bedeutung der Sprache setzt nicht voraus, dass wir orthographisch einwandfrei schrei-ben, sondern es muss nur dem jeweiligen Kommunikationspartner verständlich sein. Wir müssen die gleiche soziale Sprache sprechen wie unser Gegenüber.
Der Lese- und Schreibunterricht an der Grundschule ist mittlerweile schon mehr als selbst-verständlich geworden, doch an der Schule für Geistigbehinderte haben sich jahrelang die Experten gestritten, ob es Sinn macht, diesen Schülern das Lesen- und Schreibenlernen bei-zubringen. Doch warum sollte man solchen Menschen diese Möglichkeiten der Kommunika-tion verwehren? Geistig behindert bedeutet nicht, dass dieser Mensche dümmer ist als wir. Vielmehr bedeutet es, dass er sich eben nur langsamer entwickelt hat. Er wird aber noch viele Entwicklungsstufen durchlaufen können, bis seine individuelle Persönlichkeit entstanden ist. Deshalb sollte man geistig behinderte Menschen vom Erlernen der sogenannten Kulturtech-niken (Lesen, Schreiben, Rechnen) nicht ausschließen. Allerdings sind sie aufgrund ihrer Behinderung dabei in besonderem Maße auf vielfältige, methodische Unterstützung angewie-sen.
Mit dieser Arbeit möchte ich einen kleinen Einblick in die Methodik und Didaktik des Schriftspracherwerbes mit Geistig Behinderten verschaffen und den Gegensatz zum Schrift-spracherwerb in einer „normalen“ Grundschule darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Grundlagen des Schriftspracherwerbs
- 2.1. Der Vorgang des Lesens
- 2.2. Der Vorgang des Schreibens
- 2.3. Das Entwicklungsmodell von Günther
- 3. Schriftspracherwerb in der Schule für Geistigbehinderte
- 3.1. Allgemeines
- 3.2. Umsetzung in der Praxis
- 3.3. Lesen und Schreiben in der Praxis - Überprüfung der Lese- und Schreibleistung bei geistigbehinderten Jugendlichen
- 3.4. eigene Erfahrungen
- 4. Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Prozess des Lesen- und Schreibenlernens bei geistig behinderten Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, einen Einblick in die Methodik und Didaktik des Schriftspracherwerbs in diesem Kontext zu geben und den Vergleich zum Schriftspracherwerb in einer Regelschule aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Besonderheiten, die mit dem Lehren von Lesen und Schreiben bei dieser Zielgruppe verbunden sind.
- Der Vorgang des Lesens und Schreibens bei "normal" entwickelten Kindern
- Spezifische Herausforderungen des Schriftspracherwerbs bei geistig behinderten Kindern
- Methodische Unterstützung und didaktische Ansätze im Schriftspracherwerb für geistig behinderte Schüler
- Der Vergleich zwischen dem Schriftspracherwerb in Regelschulen und Sonderschulen für Geistigbehinderte
- Praktische Umsetzung und Überprüfung des Lese- und Schreiblernens bei geistig behinderten Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die elementare Bedeutung von Lesen und Schreiben für alle Menschen, inklusive geistig behinderter Personen. Sie hinterfragt die lange bestehende Diskussion über den Sinn des Lese- und Schreibunterrichts an Schulen für Geistigbehinderte und argumentiert für die Notwendigkeit, geistig behinderten Menschen diese Kommunikationsmöglichkeiten nicht vorzuenthalten. Die Arbeit wird als ein Beitrag zur Erläuterung der Methodik und Didaktik des Schriftspracherwerbs bei Geistigbehinderten vorgestellt, mit dem Ziel, einen Vergleich zum Schriftspracherwerb in Regelschulen aufzuzeigen. Die Autorin hebt hervor, dass geistig behindert sein nicht mit Dummheit gleichzusetzen ist, sondern eine verlangsamte Entwicklung bedeutet.
2. Die Grundlagen des Schriftspracherwerbs: Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen des Lesens und Schreibens getrennt. Im Abschnitt zum Lesen wird der Prozess als komplex und vielschichtig beschrieben, der über das bloße Zusammenlauten von Buchstaben hinausgeht und sinnerfassendes Verständnis erfordert. Es werden verschiedene Erklärungsansätze für den Leseprozess zitiert, die die Wichtigkeit des Zusammenspiels von geistiger Motivation, sprachlichem Wissen und optischem Zeichenerkennen betonen. Der Abschnitt zum Schreiben erklärt den Prozess als das Aneinanderreihen von Buchstabenformen unter Beachtung der Rechtschreibregeln, wobei auch das Verständnis des Geschriebenen eine entscheidende Rolle spielt. Das Kapitel schließt mit einer Darstellung des Entwicklungsmodells von Günther ab, welches verschiedene Phasen des Schriftspracherwerbs beschreibt.
3. Schriftspracherwerb in der Schule für Geistigbehinderte: Dieses Kapitel widmet sich dem Schriftspracherwerb in der Schule für Geistigbehinderte. Es beschreibt allgemeine Herausforderungen und geht auf die praktische Umsetzung und die Überprüfung der Lese- und Schreibleistungen bei geistig behinderten Jugendlichen ein. Der Abschnitt beinhaltet persönliche Erfahrungen der Autorin, die aber in diesem Vorschau nicht weiter detailliert werden.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Geistigbehinderte, Lesen, Schreiben, Didaktik, Methodik, Entwicklungsmodell, Kommunikation, Sonderschule, Lese- und Schreibförderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Schriftspracherwerb bei geistig behinderten Kindern und Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Prozess des Lesen- und Schreibenlernens bei geistig behinderten Kindern und Jugendlichen. Sie beleuchtet die Methodik und Didaktik des Schriftspracherwerbs in diesem Kontext und vergleicht ihn mit dem Schriftspracherwerb in Regelschulen. Die Arbeit behandelt die Herausforderungen und Besonderheiten des Lehrens von Lesen und Schreiben für diese Zielgruppe.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Der Vorgang des Lesens und Schreibens bei normal entwickelten Kindern, spezifische Herausforderungen des Schriftspracherwerbs bei geistig behinderten Kindern, methodische Unterstützung und didaktische Ansätze im Schriftspracherwerb für geistig behinderte Schüler, der Vergleich zwischen dem Schriftspracherwerb in Regelschulen und Sonderschulen für Geistigbehinderte sowie die praktische Umsetzung und Überprüfung des Lese- und Schreiblernens bei geistig behinderten Jugendlichen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, die die Bedeutung von Lesen und Schreiben für alle Menschen betont, ein Kapitel zu den Grundlagen des Schriftspracherwerbs (inkl. des Lesens, Schreibens und des Entwicklungsmodells von Günther), ein Kapitel zum Schriftspracherwerb in der Schule für Geistigbehinderte (mit allgemeinen Herausforderungen, praktischer Umsetzung und persönlichen Erfahrungen der Autorin) und abschließende Schlussgedanken.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Seminararbeit (laut Vorschau)?
Die Vorschau betont die Notwendigkeit, geistig behinderten Menschen die Kommunikationsmöglichkeiten Lesen und Schreiben zu ermöglichen. Sie zeigt die Komplexität des Lese- und Schreibprozesses auf und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und didaktischen Ansätze im Umgang mit geistig behinderten Schülern. Ein detaillierter Vergleich zum Schriftspracherwerb in Regelschulen sowie die persönlichen Erfahrungen der Autorin werden in der vollständigen Arbeit näher erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Schriftspracherwerb, Geistigbehinderte, Lesen, Schreiben, Didaktik, Methodik, Entwicklungsmodell, Kommunikation, Sonderschule, Lese- und Schreibförderung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Autorin mit ihrer Arbeit?
Die Autorin möchte einen Einblick in die Methodik und Didaktik des Schriftspracherwerbs bei geistig behinderten Kindern und Jugendlichen geben und diesen mit dem Schriftspracherwerb in Regelschulen vergleichen. Sie möchte die Herausforderungen und Besonderheiten des Lehrens von Lesen und Schreiben in diesem Kontext aufzeigen.
- Arbeit zitieren
- Tim Tengler (Autor:in), 2003, Der Prozess des Lesen- und Schreibenlernens und seine Umsetzung in der Schule für Geistigbehinderte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32671