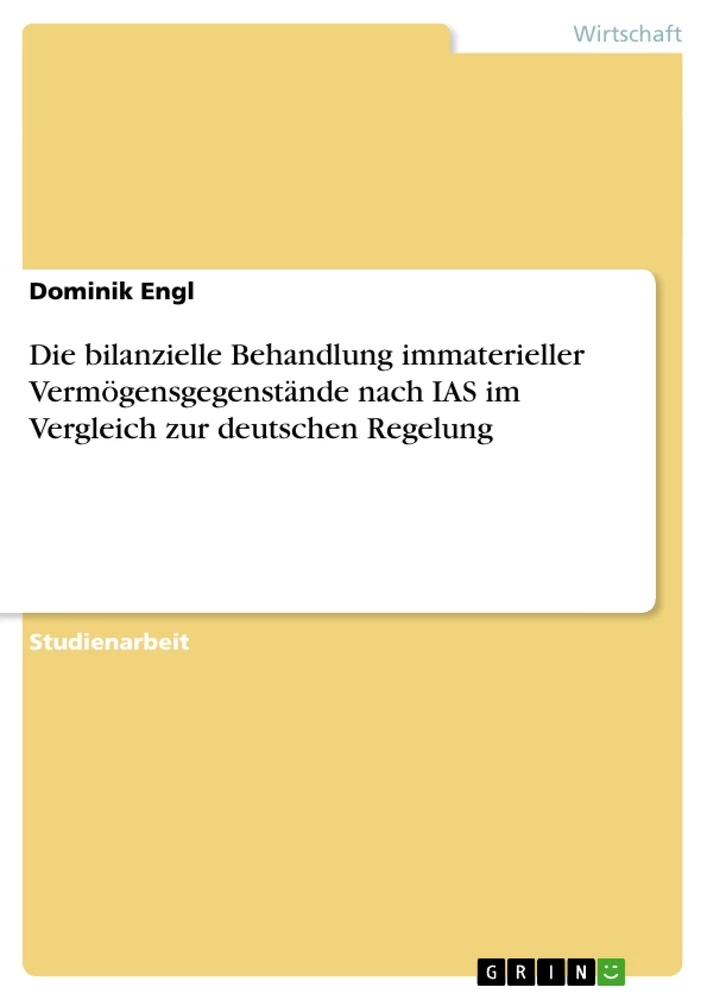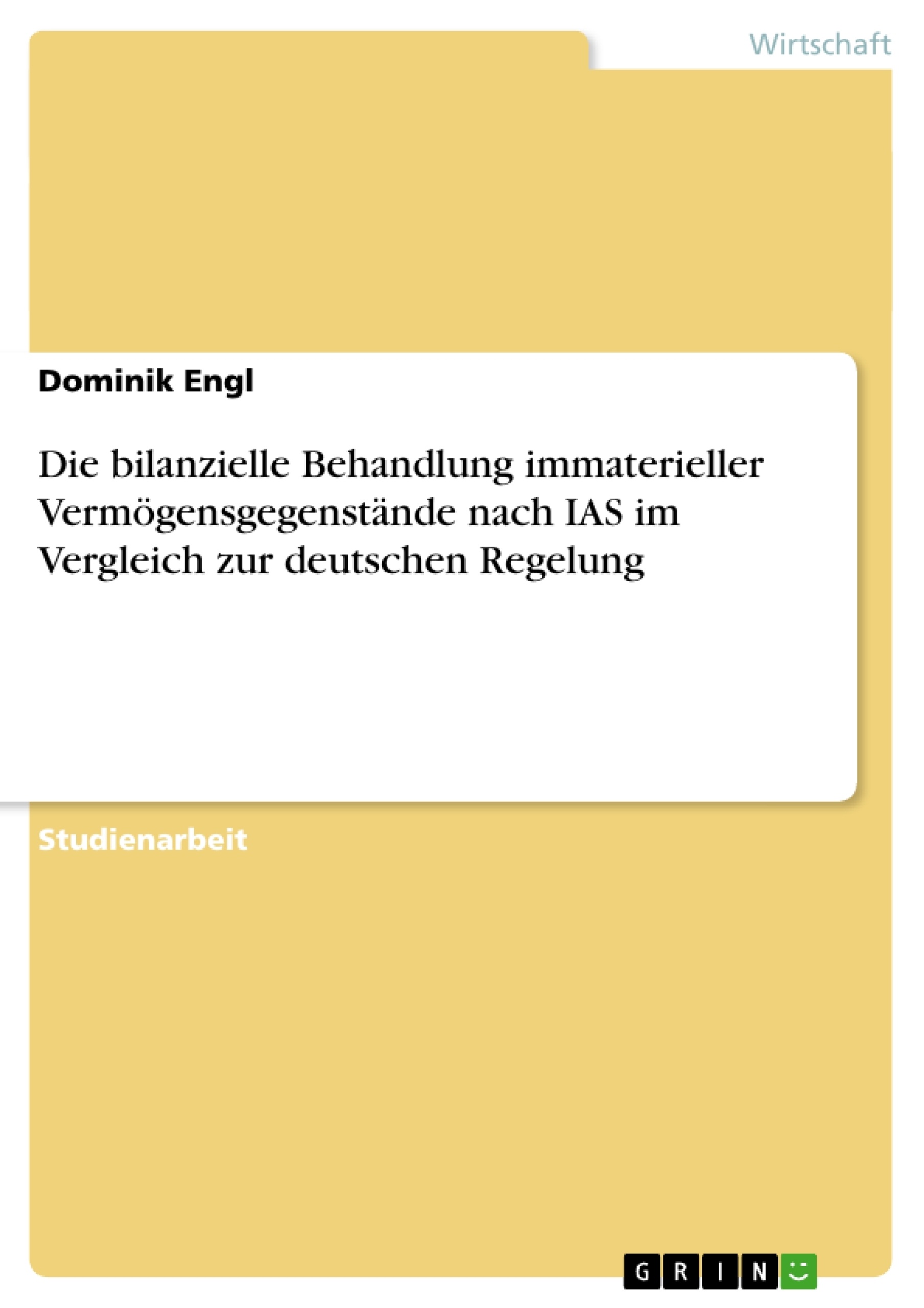Die Einführung des § 292a HGB im Jahre 1999 und die Verpflichtung zur Erstellung
eines Abschlusses nach IAS (bzw. IFRS) für börsennotierte Gesellschaften1,
führen zu einer wachsenden Bedeutung der IAS.2 Da aber viele deutsche
Unternehmen neben dem IAS-Abschluss immer noch einen Einzelabschluss
nach HGB erstellen müssen, stellt sich die Frage nach unterschiedlichen
Ansatzmöglichkeiten in den Abschlüssen.
Unterschiede in der bilanziellen Behandlung ergeben sich u.a. auch für immaterielle
Vermögenswerte. Diese gewinnen mit der Entwicklung weg von einer
Industriegesellschaft hin zu einer Dienstleistungs- und Technologiegesellschaft,
immer mehr an Bedeutung. 3 Eine Zunahme der Bedeutung kann in der
Realität gut anhand der zunehmenden Spreizung zwischen dem Kaufpreis, der
den Wert des Unternehmens darstellt, bzw. der Marktkapitalisierung und dem
bilanziellen Eigenkapital beobachtet werden. 4 Solch ein Unterschiedsbetrag
deutet nicht nur auf die Existenz von stillen Reserven, sondern auch und insbesondere
auf nicht bilanzierte immaterielle Werte hin. 5 Diese stellen in zune hmendem
Maße einen Anteil der wirtschaftlichen Ressourcen und damit wichtige
Determinanten des Unternehmenserfolges dar.6 Deshalb wird in dieser Arbeit
die bilanzielle Behandlung von immateriellen Vermögensgegenständen
("intangible assets") nach IAS im Vergleich zur deutschen Regelung erläutert.
Um die Unterschiede in der bilanziellen Behandlung der immateriellen Vermögenswerte
aufzuzeigen, wird in dieser Arbeit zunächst allgemein auf die
Problematik der immateriellen Vermögensgegenstände eingegangen und die
Begriffsdefinitionen nach den beiden Rechnungslegungssystemen dargestellt.
[...]
1 Vgl. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des europäischen Parlament und des Rates v.
19.07.2002; Brücks, M. (2002), S. 165 ff.; Kirsch, H. (2002), S. 645.
2 Vgl. Wehrheim, M. (2000), S. 86; Küting, K./Ulrich, A. (2001b), S. 1004.
3 Vgl. Hayn, S. (1996), S. 354; Küting, K./Ulrich, A. (2001a), S. 953; Schmidbauer, R. (2004),
S. 1442.
4 Vgl. Küting, K./Ulrich, A. (2001a), S. 953; Schmidbauer, R. (2004), S. 1442.
5 Vgl. Pellens, B./Fülbier, R. U. (2000), S. 123; Küting, K./Ulrich, A. (2001a), S. 953.
6 Vgl. zur Bedeutung von "Intangibles" die Tabellen 1 und 2; Küting, K./Dürr, U. (2003), S. 1;
Davis, M. K. (2002), S. 697;Küting, K./Ulrich, A. (2001a), S. 953; Schmidbauer, R. (2004),
S. 1442.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Problematik der immateriellen Vermögenswerte
- 3. Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen
- 31. Begriff des immateriellen Vermögensgegenstandes
- 311. Begriff des immateriellen Vermögensgegenstandes in der deutschen Rechnungslegung nach HGB
- 312. Begriff des immateriellen Vermögenswertes ("intangible asset") in der Rechnungslegung nach IAS
- 313. Unterschiede in den Begriffsdefinitionen
- 32. Bilanzierung dem Grunde nach
- 321. Aktivierungsfähigkeit nach der deutschen Rechnungslegung
- 322. Aktivierungsfähigkeit nach IAS
- 323. Vergleich der Aktivierungsfähigkeit
- 33. Bilanzierung der Höhe nach
- 331. Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände in der deutschen Rechnungslegung
- 332. Bewertung immaterieller Vermögenswerte nach IAS
- 333. Vergleich der Bewertungsvorschriften
- 34. Zusätzliche Angaben außerhalb der Bilanz
- 31. Begriff des immateriellen Vermögensgegenstandes
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der bilanziellen Behandlung von immateriellen Vermögensgegenständen nach IAS im Vergleich zur deutschen Regelung. Die Arbeit untersucht die Unterschiede in den Begriffsdefinitionen, den Aktivierungs- und Bewertungsvorschriften sowie den zusätzlichen Angaben außerhalb der Bilanz. Ziel ist es, ein klares Verständnis der verschiedenen Behandlungsweisen immaterieller Vermögenswerte in beiden Rechnungslegungssystemen zu vermitteln.
- Begriffsdefinitionen von immateriellen Vermögenswerten in der deutschen Rechnungslegung nach HGB und nach IAS
- Aktivierungsfähigkeit von immateriellen Vermögenswerten nach HGB und IAS
- Bewertung von immateriellen Vermögenswerten nach HGB und IAS
- Zusätzliche Angaben zu immateriellen Vermögenswerten in der Bilanz
- Vergleich der bilanziellen Behandlung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IAS
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung der IAS im Vergleich zur deutschen Rechnungslegung dar und führt in die Problematik der immateriellen Vermögenswerte ein. Kapitel 2 beleuchtet die allgemeine Problematik immaterieller Vermögenswerte und zeigt die Bedeutung dieser Vermögenswerte in einer modernen Wirtschaft auf. Kapitel 3 widmet sich der Bilanzierung von immateriellen Vermögensgegenständen. Es behandelt die Begriffsdefinitionen, Aktivierungsfähigkeit und Bewertung von immateriellen Vermögenswerten nach HGB und IAS und vergleicht die Vorschriften beider Rechnungslegungssysteme. Kapitel 4 bietet eine Schlussbetrachtung und fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögenswerte, Rechnungslegung, IAS, HGB, Aktivierung, Bewertung, Bilanzierung, Unternehmenswert, "intangible assets".
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede bei immateriellen Vermögenswerten zwischen HGB und IAS?
Die Unterschiede liegen vor allem in den Begriffsdefinitionen, den Kriterien für die Aktivierungsfähigkeit (z. B. selbst erstellte Werte) und den Bewertungsvorschriften (Anschaffungskosten vs. Fair Value).
Wann darf ein immaterieller Vermögenswert nach IAS aktiviert werden?
Nach IAS (IAS 38) muss ein immaterieller Wert identifizierbar sein, die Verfügungsmacht des Unternehmens unterliegen und einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erwarten lassen, dessen Kosten verlässlich bewertbar sind.
Warum gewinnen immaterielle Vermögenswerte heute an Bedeutung?
Durch den Wandel zur Dienstleistungs- und Technologiegesellschaft stellen Patente, Software und Markenrechte oft den Hauptteil des Unternehmenswerts dar, was sich in der Spreizung zwischen Marktkapitalisierung und Buchwert zeigt.
Was versteht man unter „intangible assets“?
Dies ist der englische Fachbegriff für immaterielle Vermögenswerte. Es handelt sich um nicht-monetäre Vermögenswerte ohne physische Substanz, wie Lizenzen, Patente oder Kundenlisten.
Gibt es Unterschiede in der Bewertung nach der Erstaktivierung?
Ja, während das HGB streng dem Anschaffungskostenprinzip folgt, erlaubt IAS unter bestimmten Voraussetzungen auch das Neubewertungsmodell, um den aktuellen beizulegenden Zeitwert abzubilden.
- Quote paper
- Dominik Engl (Author), 2004, Die bilanzielle Behandlung immaterieller Vermögensgegenstände nach IAS im Vergleich zur deutschen Regelung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32723