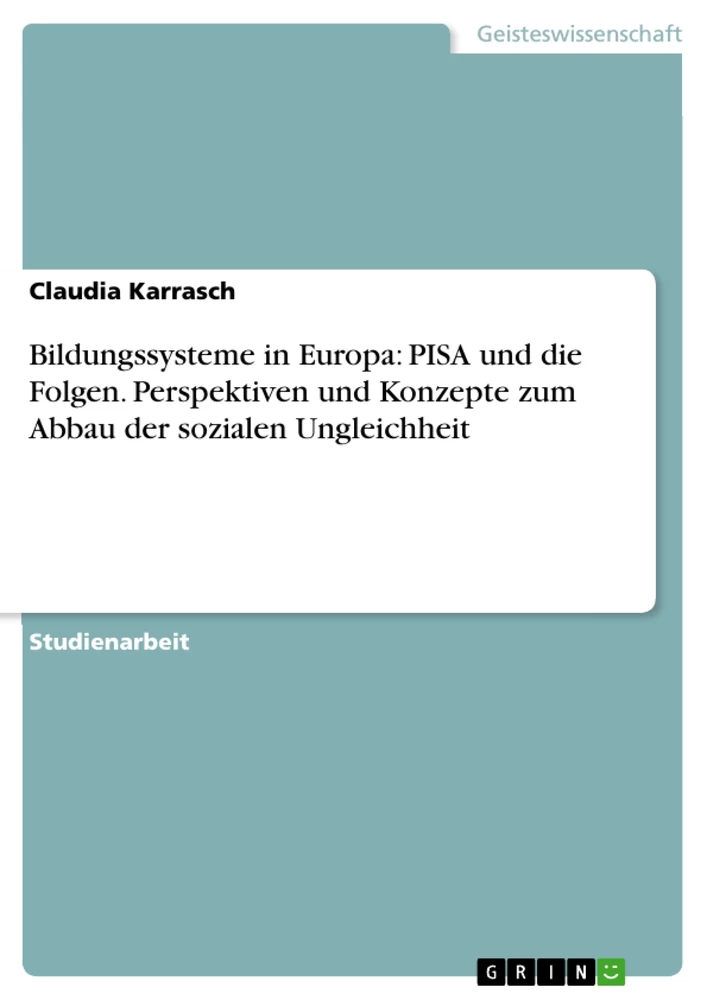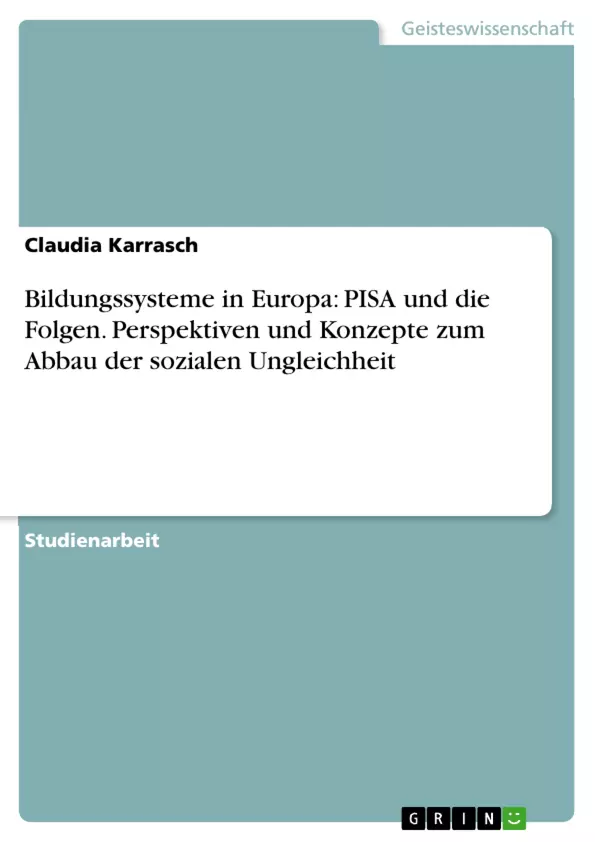[...] Sätestens dann, wenn man sich noch die
PISA-E Ergebnisse anschaut, fragt man sich welche Gründe für ein solches Abschneiden
vorliegen und welche Konsequenzen dies für das deutsche Bildungssystem hat.
Mitte 1960 wurde das deutsche Bildungssystem reformiert in der Hoffnung, mehr soziale
Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu erzeugen. Die Hochschulen wurden ausgebaut,
der Zugang zum sekundären Bildungssystem vereinfacht und das dreigliedrige
Schulsystem, mit Haupt-, Realschule und Gymnasium eingeführt. Jedoch musste die
aktuelle Sozialstrukturanalyse feststellen, dass die, durch die Bildungsreform ausgelöste
Bildungsexpansion nicht, wie erwartet, zu mehr Chancengleichheit und einer Öffnung des
Bildungssystems für sozial unterprivilegierte Schichten geführt hat. Allerdings sind
Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit in der modernen u. demokratischen
Gesellschaft wie der BRD allgemein wichtige und akzeptierte Werte. Die aktuellen
Gegebenheiten zeigen aber deutlich, dass das deutsche Bildungssystem, als
Verteilungsinstanz formaler Bildungsabschlüsse, noch weit von seinem Anspruch auf
Chancengleichheit entfernt ist. Da aber Erfolg in Bildungssystem und das Erlangen
formaler Bildungsabschlüsse direkte Auswirkungen auf den sozialen Status der Individuen
haben, bedeutet eine ungleiche Verteilung von Bildungschancen eine Reproduktion
sozialer Ungleichheit.
Um ein besseres Verständnis für den Sachverhalt zu erzielen wird anfangs näher auf die
PISA-Studie und auf deren Ergebnisse eingegangen. Darauf basierend wird dann im
Folgenden auf den Begriff der Chancengleichheit und der damit verbundenen Problematik
bzgl. der Strukturen der sozialen Ungleichheit im Bildungssystem eingegange n. Auf
Grundlage dieser Erkenntnis werden die Perspektiven eines sozial gerechten
Bildungssystem, also ein Bildungssystem, das die Problematik der sozialen Ungleichheit
im Bildungssystem als solche erkennt und aktiv bemüht ist sie zu bekämpfen, diskutiert.
Dabei soll die Konzeption der Gesamtschule hervorgehoben werden, die zwar oftmals
kritisiert wird, aber gerade im Kontext der PISA-Studie wieder in den Mittelpunkt der
Diskussion gerückt ist, da der europäische Spitzenreiter Finnland mit seinen staatlichen
Gesamtschulsystem sehr gute Ergebnisse, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt des
Abbaus herkunftsspezifischer Chancenungleichheit, erzielt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anliegen von Pisa
- Wer nimmt an Pisa teil?
- Bereichsspezifische Konkretisierung der Untersuchungen
- Basiskompetenzen und Lebensführung
- Kompetenzerwerb in der Schule: Ein allgemeines Erklärungsmodell
- Ergebnisse der PISA - Studie
- PISA-E Allgemein
- Was und wie wurde untersucht?
- Ergebnisse der PISA-E Studie
- Ergebnisse hinsichtlich der Geschlechterunterschiede
- Ergebnisse hinsichtlich der sozialen Herkunft
- Ergebnisse hinsichtlich der Lebens- und Lernbedingungen
- Das deutsche Bildungssystem
- Das deutsche Schulsystem
- Elementarbereich
- Sekundarbereich I
- Sekundarbereich II
- Die Bedeutung formaler Bildungsabschlüsse
- Chancengleichheit im Bildungssystem
- Soziale Ungleichheit trotz Bildungsexpansion
- Soziale Ungleichheit durch Habitus und Lebensstiel
- Perspektiven eines sozial integrierenden Schul- und Bildungssystem
- Ökonomische Benachteiligung
- Benachteiligung durch das dreigliedrige Schulsystem
- Soziokulturell bedingte Benachteiligung
- Die Gesamtschule – Versuch einer Chancengleichheit abbauenden Konzeption
- Konzept der Gesamtschulen
- Die Gesamtschule und Chancengleichheit
- Probleme der Gesamtschule
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Ergebnisse der PISA-Studie im Kontext der sozialen Ungleichheit im deutschen Schul- und Bildungssystem. Sie analysiert die Ursachen für die in der PISA-Studie festgestellten Leistungsunterschiede und beleuchtet die Rolle des dreigliedrigen Schulsystems in der Reproduktion sozialer Ungleichheit. Des Weiteren werden verschiedene Perspektiven und Konzepte zum Abbau herkunftsspezifischer Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem diskutiert, wobei die Konzeption der Gesamtschule als möglicher Ansatz zur Verbesserung der Chancengleichheit im Fokus steht.
- Analyse der Ergebnisse der PISA-Studie
- Bedeutung des dreigliedrigen Schulsystems für die soziale Ungleichheit
- Konzepte zum Abbau herkunftsspezifischer Chancenungleichheit
- Die Gesamtschule als Lösungsansatz
- Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz der PISA-Studie und stellt die Problematik der sozialen Ungleichheit im deutschen Bildungssystem dar. Anschließend wird das Anliegen der PISA-Studie vorgestellt, wobei insbesondere die Bereiche der Untersuchung, die Erfassung von Basiskompetenzen und die Methodologie der Studie erläutert werden. Das dritte Kapitel widmet sich den Ergebnissen der PISA-E Studie, die die Leistungsunterschiede hinsichtlich der Geschlechter, der sozialen Herkunft und der Lebens- und Lernbedingungen beleuchtet. Die Kapitel 4 und 5 fokussieren auf das deutsche Bildungssystem, wobei insbesondere die Strukturen des Schulsystems, die Bedeutung formaler Bildungsabschlüsse und die Herausforderungen der Chancengleichheit in diesem Kontext analysiert werden. Im sechsten Kapitel wird die Konzeption der Gesamtschule als möglicher Ansatz zur Verbesserung der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem vorgestellt und kritisch diskutiert.
Schlüsselwörter
PISA-Studie, soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Schulsystem, Chancengleichheit, Gesamtschule, herkunftsspezifische Chancenungleichheit, Bildungsexpansion, dreigliedriges Schulsystem, Lebens- und Lernbedingungen, Basiskompetenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptgründe für das schlechte Abschneiden Deutschlands in PISA?
Die Studie identifiziert vor allem die starke Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg sowie die mangelnde Chancengleichheit innerhalb des gegliederten Schulsystems.
Warum reproduziert das dreigliedrige Schulsystem soziale Ungleichheit?
Das System aus Hauptschule, Realschule und Gymnasium fungiert als Verteilungsinstanz, die Kinder oft frühzeitig aufgrund ihres soziokulturellen Hintergrunds statt rein nach Leistung selektiert.
Was hat die Bildungsexpansion der 1960er Jahre bewirkt?
Obwohl Hochschulen ausgebaut und Zugänge erleichtert wurden, führte die Expansion nicht im erwarteten Maße zu mehr Chancengleichheit für sozial unterprivilegierte Schichten.
Warum wird Finnland als Vorbild in der PISA-Diskussion genannt?
Finnland erzielt mit seinem staatlichen Gesamtschulsystem Spitzenwerte und schafft es besonders gut, herkunftsspezifische Chancenungleichheit abzubauen.
Welche Rolle spielt die Gesamtschule als Lösungsansatz?
Die Gesamtschule wird als Konzept diskutiert, das durch längeres gemeinsames Lernen soziale Unterschiede ausgleichen und die Selektion verzögern kann.
Was untersucht die PISA-E Studie speziell?
PISA-E betrachtet die Ergebnisse auf nationaler Ebene in Deutschland und analysiert Unterschiede zwischen den Bundesländern sowie hinsichtlich Geschlecht und Lebensbedingungen.
- Arbeit zitieren
- Claudia Karrasch (Autor:in), 2003, Bildungssysteme in Europa: PISA und die Folgen. Perspektiven und Konzepte zum Abbau der sozialen Ungleichheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32745