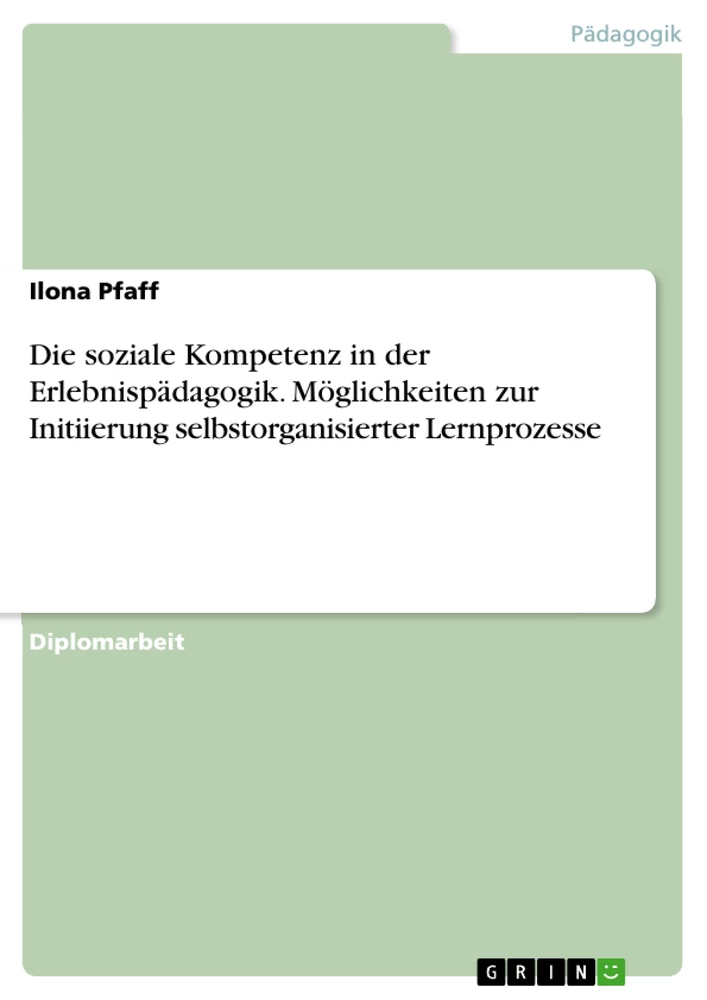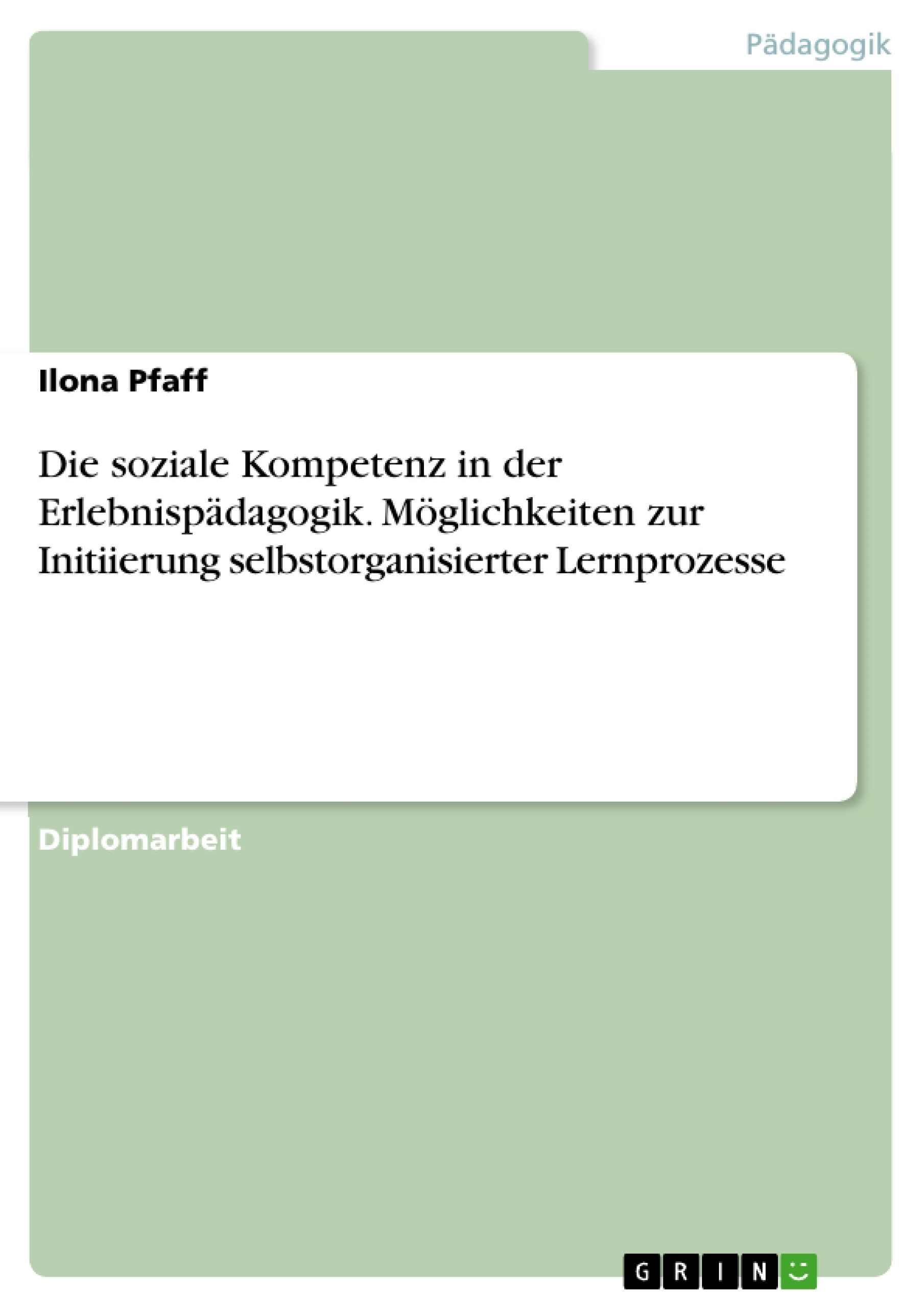In der wissenschaftlichen Hausarbeit soll der Frage nachgegangen werden, unter welchen theoretischen Aspekten die Entwicklung Sozialer Kompetenz mit Hilfe der Erlebnispädagogik gewährleistet werden kann. Die Schwierigkeit dabei ist die sinnvolle Verknüpfung zweier an sich komplexer Themenschwerpunkte, die Sozialkompetenz auf der einen, und die Erlebnispädagogik auf der anderen Seite. Zu Anfang ist es wichtig anzumerken, dass es genauso, wie es nicht „die“ Pädagogik (Vgl. Gudjons, 1995, S. 19), auch nicht „die“ Erlebnispädagogik gibt. „Es charakterisiert „die“ Erlebnispädagogik, dass es eine solche als klar definierte oder definiertes oder definierbares Gebilde (im Sinne etwa einer Theorie oder einer relativ eindeutig umreißbaren Form von Praxis) weder gegeben hat noch gibt“ (Bauer, 1993, S. 7).
Die Definitionsvielfalt stellt eine Erschwernis für die theoretische Beschäftigung mit der Erlebnispädagogik dar. Sinn und Zweck dieser wissenschaftlichen Hausarbeit ist dabei, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man der Einzigartigkeit eines Menschen gerecht werden und sie persönlichkeitsspezifisch in ihrem stetigen Werden innerhalb eines klar definierten erlebnispädagogischen Rahmens unterstützen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Klärung des Bedarfs an Sozialer Kompetenz in unserer Gesellschaft
- 2 Wissenschaftstheorie - Klärung der theoretischen Herangehensweise und wissenschaftstheoretischen Position
- 2.1 Phänomenologie und Hermeneutik - Zwei mögliche Wissenschaftstheorien und ihre methodischen Vorgehensweisen im Vergleich
- 2.1.1 Mit welcher Einschränkung sind die geisteswissenschaftlichen Forschungsmethoden der Phänomenologie und der Hermeneutik zu betrachten?
- 2.2 Annäherung an den Konstruktivismus - Eine Einführung
- 2.2.1 Das Prinzip der Autopoiese - Grundlage der Konstruktivistischen Denkweise und Anthropologie lebender Systeme
- 2.3 Resümee aus den dargestellten Wissenschaftstheorien
- 2.4 Das Menschenbild der Humanistischen Psychologie & Pädagogik
- 3 Didaktisches Selbstverständnis
- 3.1 Erklärungsprinzipien der konstruktivistischen Betrachtungsweise des Gegenstandsfeldes auf der Grundlage der Theorie autopoietischer Systeme nach Maturana & Varela
- 3.1.1 Selbstreferentialität
- 3.1.2 Strukturdeterminiertheit
- 3.1.3 Operationale Geschlossenheit
- 3.1.4 Strukturelle Koppelung
- 3.2 Extrapolation der Prinzipien der Autopoiese auf die Lernprinzipien des Individuums
- 3.2.1 Wahrnehmung
- 3.2.2 Lernen
- 3.2.3 Bewußtsein
- 3.2.4 Erleben
- 3.2.5 Fazit
- 3.3 Subjektive Didaktik
- 3.3.1 Chreoden und Morpheme
- 3.3.2 Didaktische Landschaft
- 4 Soziale Kompetenz. Versuch einer Begriffsbestimmung und Eingrenzung - Was genau soll erlernt bzw. erarbeitet werden?
- 4.1 Begriffsklärung
- 4.2 Kritische Betrachtung herkömmlicher Definitionen Sozialer Kompetenz am Beispiel der Definitionen der Komponenten Sozialer Kompetenz nach Schuler & Barthelme (1995)
- 5 Erlebnispädagogik - Versuch einer Bestandsaufnahme
- 5.1 Ursprünge der Erlebnispädagogik
- 5.2 Erlebnispädagogik auf lerntheoretischer Grundlage der Theorie lebender Systeme nach Maturana & Varela - In Anlehnung an die Diplomarbeit von Brischar & Saur (1996)
- 5.2.1 Anreiz
- 5.2.2 Erlebnis
- 5.2.3 Reflexion
- 5.2.4 Anschluss
- 5.2.5 Fazit
- 6 Die Bedeutung der Erlebnispädagogik für die Entwicklung Sozialer Kompetenz
- 6.1 Momente des Anreizes in der Erlebnispädagogik
- 6.1.1 Grenzerfahrung
- 6.1.1.1 Grenzerfahrung in der Gruppe
- 6.1.1.2 Grenzerfahrung in Auseinandersetzung mit der nicht personellen Umwelt
- 6.1.1.3 Grenzerfahrung in Auseinandersetzung mit sich selbst
- 6.1.2 Anreiz - Vertrauen & Zutrauen
- 6.2 Reflexion - Erarbeitungsmöglichkeiten sozialer Fähigkeiten innerhalb der Erlebnispädagogik
- 6.2.1 Reflexion innerhalb der sozialen Gruppe
- 6.2.2 Reflexion des Individuums
- 6.2.3 Methoden sozialen Lernens
- 6.2.3.1 Das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun - Kommunikation erlernen
- 6.2.3.2 Das Kommunikationsmodell der Transaktionsanalyse
- 6.2.3.3 Konflikte lösen durch Verbalisierung und Bewußtmachung versteckter Gefühle
- 6.2.4 Die biographische Selbstreflexion des erlebnispädagogischen Leiters
- 6.2.4.1 Wie schafft man ein entwicklungsförderndes pädagogisches Milieu?
- 6.2.4.2 Vermeidung von Projektionen durch „Aussöhnung mit dem eigenen Teufel“
- 6.2.4.3 Entlarvung der individuellen Spielneigung und Kommunikationsstruktur
- 6.2.4.4 Sebstverantwortliches Denken & Handeln - Soziale Kompetenz vorleben, anregen und anleiten am Beispiel des NLP
- 6.3 Erlebnispädagogik als Angstbewältigungsmethode
- 6.3.1 Freisein von Sozialer Angst als Soziale Kompetenz
- 6.3.2 Angst allgemein
- 6.3.3 Soziale Angst
- 6.3.4 Angst und Selbstdarstellung
- 6.3.5 Emotionsbewältigung durch Selbstdarstellung zum Schutze des Selbstwertes - Eine Bewältigungsmethode der Angst
- 6.3.6 ,,Unmittelbares Erleben“ als Chance, sich von sozialer Angst zu lösen - Selbstakzeptanz zur Unterstützung des Selbstwertgefühls
- 6.3.7 Die Entdeckung des wahren Selbst, um die Angst auf „vernünftige“ Weise zu bewältigen
- 6.3.8 Möglichkeiten der Angstbewältigung innerhalb der Erlebnispädagogik
- 7 Möglichkeiten der Evaluation
- 7.1 Kritik an der Evaluation
- 7.2 Alternative Selbstevaluation
- 8 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit untersucht, unter welchen theoretischen Aspekten die Entwicklung Sozialer Kompetenz mit Hilfe der Erlebnispädagogik gewährleistet werden kann. Sie verbindet die komplexen Themen Sozialkompetenz und Erlebnispädagogik und beleuchtet die Möglichkeiten, diese beiden Bereiche sinnvoll miteinander zu verknüpfen.
- Klärung des Bedarfs an Sozialer Kompetenz in der Gesellschaft
- Wissenschaftstheoretische Fundierung und Methodenwahl
- Didaktisches Selbstverständnis und die Rolle des Konstruktivismus
- Begriffliche Analyse von Sozialer Kompetenz und ihrer Entwicklung
- Bedeutung der Erlebnispädagogik für die Förderung Sozialer Kompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand und die Zielsetzung der Untersuchung einführt. Anschließend werden die zentralen wissenschaftstheoretischen Ansätze beleuchtet, die für die Analyse relevant sind. Insbesondere der Konstruktivismus und die Theorie autopoietischer Systeme bilden die Grundlage für das didaktische Selbstverständnis der Arbeit. Kapitel 4 befasst sich mit der Begriffsklärung von Sozialer Kompetenz, bevor Kapitel 5 die Erlebnispädagogik als Methode zur Entwicklung Sozialer Kompetenz vorstellt. Kapitel 6 analysiert die Bedeutung der Erlebnispädagogik für die Förderung sozialer Fähigkeiten, insbesondere in Bezug auf Grenzerfahrungen, Reflexion und Angstbewältigung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Sozialer Kompetenz, Erlebnispädagogik, Konstruktivismus, Autopoiese, Grenzerfahrung, Reflexion, Angstbewältigung und didaktischem Selbstverständnis.
Häufig gestellte Fragen zu Sozialer Kompetenz und Erlebnispädagogik
Wie fördert Erlebnispädagogik soziale Kompetenzen?
Durch Grenzerfahrungen in der Gruppe und die anschließende Reflexion lernen Teilnehmer, Vertrauen zu entwickeln, Konflikte zu lösen und Verantwortung zu übernehmen.
Was bedeutet Autopoiese in diesem Zusammenhang?
Nach Maturana & Varela sind lebende Systeme (Menschen) selbstreferentiell und operativ geschlossen. Lernen kann daher nicht "instruiert" werden, sondern muss vom Individuum selbst organisiert werden.
Warum ist Reflexion nach einem Erlebnis so wichtig?
Nur durch die bewusste Aufarbeitung des Erlebten können die gewonnenen Erfahrungen in den Alltag transferiert und als soziale Fähigkeiten verankert werden.
Kann Erlebnispädagogik bei sozialen Ängsten helfen?
Ja, das "unmittelbare Erleben" bietet die Chance, sich von sozialen Ängsten zu lösen und durch Erfolgserlebnisse das Selbstwertgefühl zu stärken.
Was ist die Aufgabe eines erlebnispädagogischen Leiters?
Der Leiter schafft ein entwicklungsförderndes Milieu, lebt soziale Kompetenz vor und regt durch gezielte Anreize selbstorganisierte Lernprozesse an.
- Citation du texte
- Ilona Pfaff (Auteur), 2002, Die soziale Kompetenz in der Erlebnispädagogik. Möglichkeiten zur Initiierung selbstorganisierter Lernprozesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32749