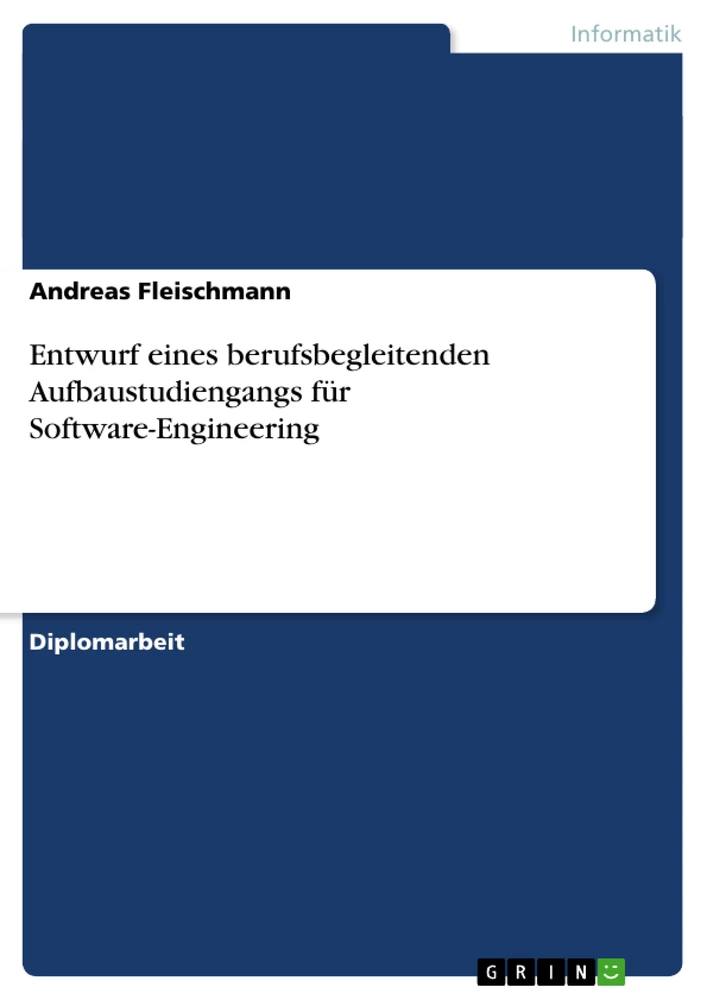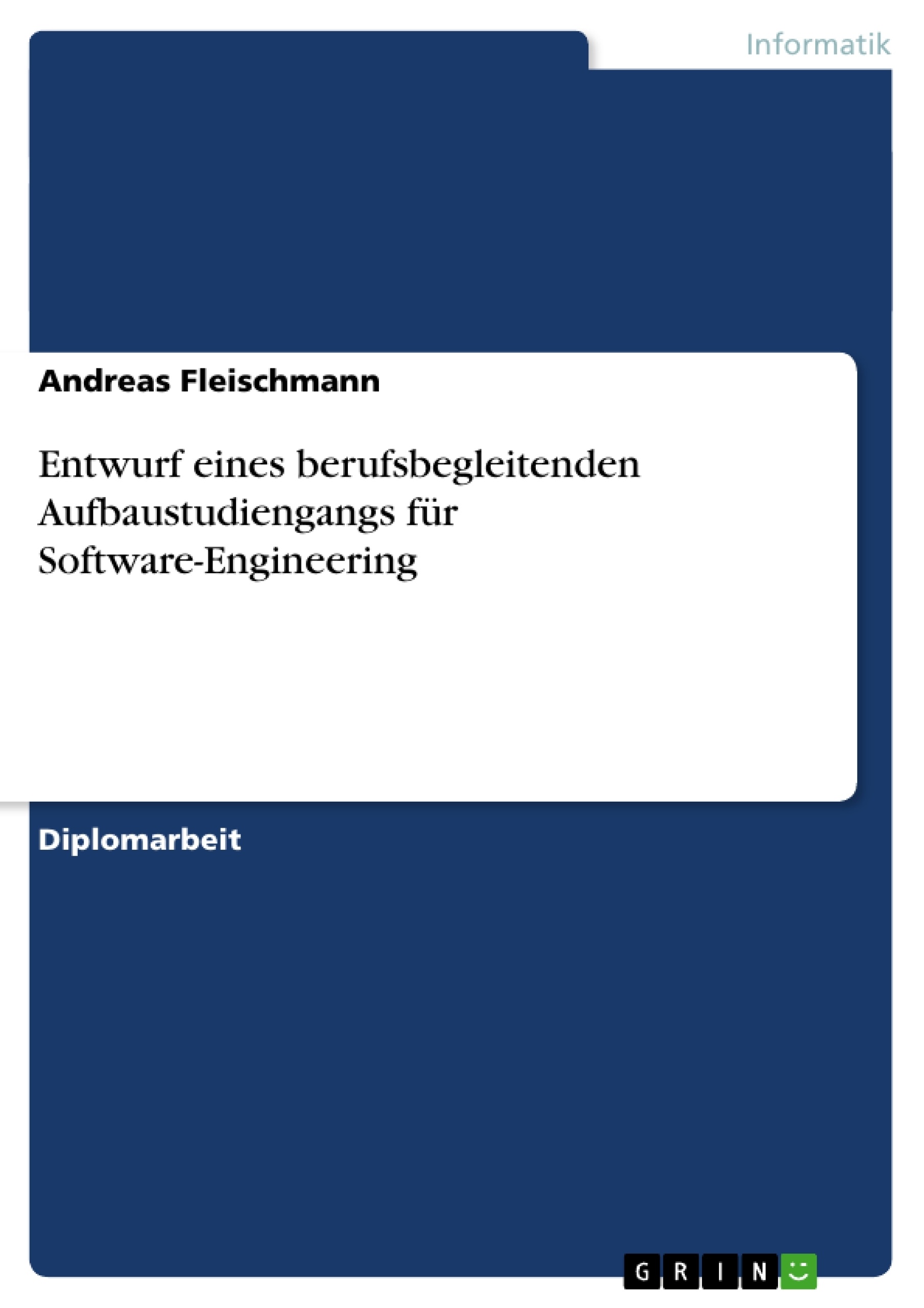Die Technische Universität Darmstadt möchte ihr Angebot für die berufliche Weiterbildung neu strukturieren und intensivieren. In dieser Arbeit wird am Beispiel des Themenfelds "Software-Engineering" geprüft, welcher Bedarf seitens der Industrie an universitärer Weiterbildung besteht und welche Möglichkeiten der Fachbereich Informatik hat, diesen Bedarf zu decken. Im Brennpunkt stehen dabei Einzelangebote, mehrsemestrige Studienpakete mit Zertifikatsabschluss und komplette berufsbegleitende Aufbaustudiengänge.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich in den folgenden Punkten zusammenfassen: Es besteht Bedarf an Weiterbildung auf anspruchsvollem Niveau, wie sie Hochschulen anbieten können.
Wenn eine Universität in den professionellen Weiterbildungsmarkt einsteigen möchte, muss sie den dortigen Standards entsprechend über die Inhalte hinaus zusätzlichen Service für die Teilnehmer anbieten. Für ein berufsbegleitendes Angebot im größeren Stil (etwa einem komplette Studiengang) müsste sich der Fachbereich über einen erheblichen Zeitraum hinweg für einen beträchtlichen Zusatzaufwand verpflichten; in Anbetracht der bereits bestehenden hohen Belastung des Fachbereichs (durch die hohen Studierendenzahlen) muss ein solcher Zusatzaufwand kritisch abgewogen werden. In dieser Arbeit wird ein normaler Studiengang "Software Construction" entworfen, und beschrieben, wie er als Ausgangsbasis dienen kann, um gezielt einzelne Lehrveranstaltungen und Zertifikate für Software-Ingenieure auf die berufliche Weiterbildung zu übertragen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
- Einleitung
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung dieser Arbeit
- 1.2 Zum Aufbau dieser Arbeit
- 2. Warum überhaupt Weiterbildung an der Hochschule?
- 2.1 Gesetzlicher Auftrag
- 2.2 Gesellschaftlicher Auftrag
- 2.3 Weiterbildung als Einnahmequelle
- 2.4 Industriekooperation
- 2.5 Gegenargumente
- Teil I: Marktanalyse
- 3. Bedarfsanalyse
- 3.1 Auswahl der Gesprächspartner
- 3.2 Gesprächsführung
- 3.3 Ergebnisse der Interviews
- 3.3.1 Bundeskriminalamt
- 3.3.2 danet
- 3.3.3 Debis Systemhaus
- 3.3.4 Dregis
- 3.3.5 Dresdner Bank
- 3.3.6 Lufthansa Systems Airline Services
- 3.3.7 Robert Bosch
- 3.3.8 sd&m
- 3.4 Ergebnisse anderer Studien
- 3.4.1 Studie zum IT-Fachkräftebedarf in der Rhein-Main-Region
- 3.4.2 Empfehlung der Gesellschaft für Informatik
- 3.4.3 Lünendonk Marktanalyse
- 4. Konkurrenzanalyse
- 4.1 Professionelle Weiterbildungsanbieter
- 4.2 Ausbildungsberufe
- 4.3 Hochschulangebote
- 4.3.1 Studiengänge
- 4.3.2 Einzelangebote
- 5. Ergebnisse der Marktanalyse
- 5.1 Zielgruppe
- 5.2 Inhalte
- 5.3 Organisatorisches
- Teil II: Möglichkeiten universitärer Weiterbildung
- 6. Rahmenbedingungen
- 6.1 Zugangsvoraussetzungen
- 6.1.1 Rechtliche Mindestvoraussetzungen
- 6.1.2 Fachliche Zugangsvoraussetzungen
- 6.2 Service
- 6.3 Lehrformate für Berufstätige
- 6.4 Didaktik für Berufstätige
- 6.5 Kostenmodelle
- 6.5.1 Teilnahmegebühren
- 6.5.2 Angebotsmodelle
- 6.5.3 Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben
- 6.6 Platzierung und Arrangement der Lehrangebote
- 6.7 Umfang
- 6.8 Auslastung des Fachbereichs
- 7. Möglichkeiten und Perspektiven
- 7.1 Berufsbegleitender Studiengang
- 7.2 Anbieten einzelner Veranstaltungen
- 7.3 Anbieten überschaubarer Zertifikate
- 7.4 Projektbegleitung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines berufsbegleitenden Aufbaustudiengangs für Software-Engineering an der Technischen Universität Darmstadt. Ziel der Arbeit ist es, den Bedarf der Industrie an universitärer Weiterbildung im Bereich Software-Engineering zu analysieren und Möglichkeiten für den Fachbereich Informatik aufzuzeigen, diesen Bedarf zu decken.
- Analyse des Bedarfs an Weiterbildung im Bereich Software-Engineering durch Befragung von Unternehmen und Studien anderer Institute
- Bewertung der Wettbewerbslandschaft im Bereich der Software-Engineering-Weiterbildung
- Definition von Rahmenbedingungen für ein berufsbegleitendes Studienangebot an der TU Darmstadt
- Entwicklung eines Konzepts für einen berufsbegleitenden Aufbaustudiengang für Software-Engineering
- Bewertung der Machbarkeit und Implementierungsmöglichkeiten eines solchen Studiengangs
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt eine Einführung in die Thematik der Arbeit und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau des Dokuments. Im zweiten Kapitel wird die Notwendigkeit der Weiterbildung an Hochschulen im Allgemeinen und die Bedeutung der Weiterbildung als Einnahmequelle für Hochschulen beleuchtet.
Die Kapitel 3 und 4 widmen sich der Analyse des Bedarfs und der Wettbewerbslandschaft im Bereich der Software-Engineering-Weiterbildung. Es werden Unternehmen und Institutionen befragt und andere Studien ausgewertet, um einen Überblick über die aktuellen Anforderungen der Industrie und die bereits bestehenden Angebote zu gewinnen.
Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Marktanalyse zusammen und beschreibt die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich der Zielgruppe, der Inhalte und der organisatorischen Anforderungen an ein erfolgreiches Weiterbildungsangebot.
Im sechsten Kapitel werden die Rahmenbedingungen für ein berufsbegleitendes Studienangebot an der TU Darmstadt analysiert. Hierbei geht es um Zugangsvoraussetzungen, Serviceangebote, Lehrformate, Didaktik, Kostenmodelle, Platzierung der Lehrangebote und den Umfang des Angebots.
Das siebte Kapitel schließlich beleuchtet verschiedene Möglichkeiten und Perspektiven für die Implementierung eines berufsbegleitenden Studienangebots im Bereich Software-Engineering an der TU Darmstadt.
Schlüsselwörter
Software-Engineering, Berufsbegleitendes Studium, Weiterbildung, Marktanalyse, Bedarfsanalyse, Konkurrenzanalyse, Rahmenbedingungen, TU Darmstadt, Fachbereich Informatik.
Häufig gestellte Fragen
Besteht in der Industrie Bedarf an universitärer Weiterbildung im Software-Engineering?
Ja, die Marktanalyse zeigt einen deutlichen Bedarf an anspruchsvoller Weiterbildung, sofern diese den professionellen Standards der Industrie entspricht.
Was ist das Konzept „Software Construction“?
Es ist ein entworfener Studiengang, der als Basis dient, um Lehrveranstaltungen und Zertifikate gezielt auf die berufliche Weiterbildung zu übertragen.
Welche Hürden gibt es für Universitäten im Weiterbildungsmarkt?
Herausforderungen sind die hohe Auslastung der Fachbereiche durch reguläre Studierende sowie der notwendige zusätzliche Service für Berufstätige.
Welche Lehrformate eignen sich für Berufstätige?
Diskutiert werden berufsbegleitende Aufbaustudiengänge, mehrsemestrige Zertifikatskurse und einzelne, modular aufgebaute Lehrveranstaltungen.
Warum sollten Hochschulen Weiterbildung anbieten?
Gründe sind der gesetzliche Auftrag, die engere Kooperation mit der Industrie und die Erschließung neuer Einnahmequellen.
- Quote paper
- Andreas Fleischmann (Author), 2002, Entwurf eines berufsbegleitenden Aufbaustudiengangs für Software-Engineering, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32952