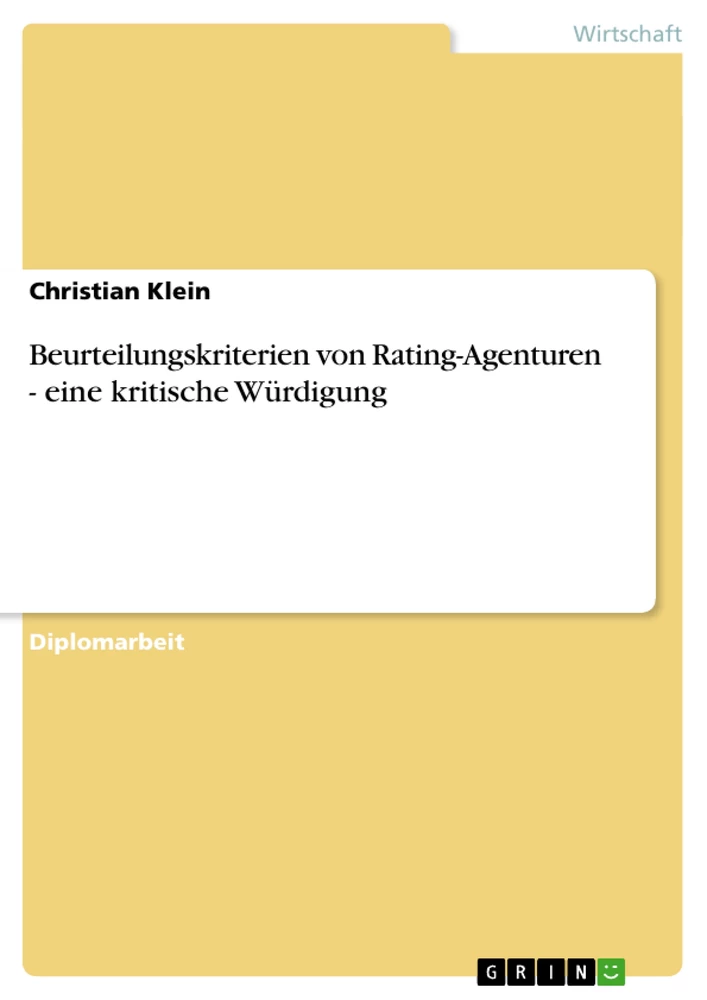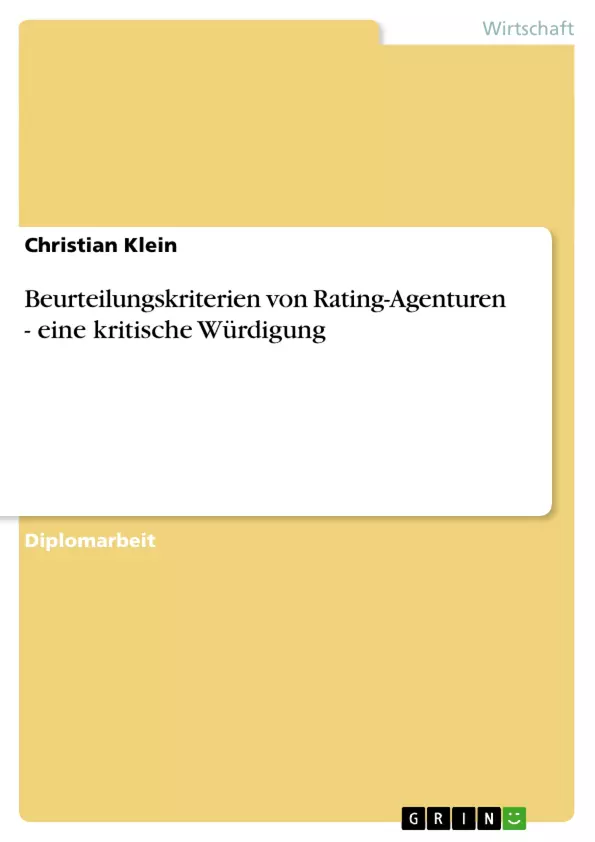Im amerikanischen Raum sind Ratings durch Rating-Agenturen bereits weit verbreitet und haben immense Auswirkungen auf Unternehmen und Volkswirtschaften. Eine Zunahme der Bedeutung auch in Europa, insbesondere eine Ausstrahlung auf den Mittelstand, dürfte aufgrund von Basel II2 und steigender Insolvenzen3 zu erwarten sein.
Ratings im Sinne dieser Arbeit beurteilen die Fähigkeit einzelner Unternehmen, ihre Schulden (Zins und Tilgung) zukünftig zu begleichen. Die Frage der Prognosequalität des Ratings ist selbst im amerikanischen Schrifttum kaum dezidiert diskutiert worden. Da Ratings aber letztlich nur das Produkt bewerteter zu Grunde gelegter Kriterien sind, müssen ohnehin eben diese näher beleuchtet werden.
Beurteilungskriterien müssen an ihrem Ziel, der zutreffenden Prognose über Ausfallwahrscheinlichkeiten, gemessen werden. Dabei sind drei Aspekte von Bedeutung. Die Kriterien müssen prognosefähig sein, also eine potenzielle Korrelation mit dem Ausfallrisiko aufweisen. Darüber hinaus müssen sie eine hohe Prognosequalität aufweisen, d.h. eine hohe tatsächliche Korrelation. Schließlich sollten sie objektiv und damit überprüfbar sein, um Missbrauch zu verhindern, die Vergleichbarkeit zu erhöhen und letztlich zu steigender Prognosequalität beizutragen.
Die konstitutive Unterscheidung in die noch zu definierenden quantitativen und qualitativen Kriterien zeigt, dass dabei die o.g. Aspekte mitunter diametral ausgeprägt sind. Die vorliegende Arbeit geht daher folgenden Fragen nach: Welche Kriterien gibt es? Welche Kriterien sind prognosefähig? Welche Kriterien verfügen über hohe Prognosequalität und welche regulierenden Maßnahmen existieren bzw. müssen ergriffen werden, um hohe Prognosequalität und - soweit nötig - Objektivität sicherzustellen?
Diese Arbeit beschränkt sich auf Ratings des unternehmerischen Emittenten. Zwar werden vor allem in den USA Ratings einzelner Emissionen bevorzugt, da unter-schiedliche Emissionen einzelner Emittenten erheblich divergieren können, jedoch kann grundsätzlich keine Emission höher beurteilt werden als ihr Emittent. Außerdem ist die Sicherheit einzelner Emissionen durch Vertragsbedingungen und Besicherungsrangfolge weitgehend objektiv zu unterscheiden. Bisher wurden durch Rating-Agenturen nur größere Unternehmen beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Rating-Agenturen
- 2.1 Hintergrund und Entwicklung
- 2.2 Nutzen von Rating-Agenturen
- 2.2.1 Grundsätzliches
- 2.2.2 Vorteile durch Arbeitsteilung
- 2.2.3 Reduzierung von Fehlinvestitionen
- 2.3 Schädigung durch Rating-Agenturen
- 2.3.1 Grundsätzliches
- 2.3.2 Oligopol-Preise und Auftragszwang
- 2.3.3 Missbrauch
- 3 Beurteilungskriterien als Essenz des Ratings
- 3.1 Grundsätzliches
- 3.2 Ablauf eines Ratings
- 3.3 Auswahl zielgerechter Beurteilungskriterien
- 3.3.1 Grundsätzliches
- 3.3.2 Quantitative Kriterien
- 3.3.2.1 Definition
- 3.3.2.2 Auswahlverfahren
- 3.3.2.3 Identifizierte Kriterien
- 3.3.3 Qualitative Kriterien
- 3.3.3.1 Definition
- 3.3.3.2 Auswahlverfahren
- 3.3.3.3 Identifizierte Kriterien
- 3.4 Beschaffung und Bewertung der notwendigen Informationen
- 3.5 Gewichtung und Aggregation der Rating-Kriterien
- 3.5.1 Grundsätzliches
- 3.5.2 Quantitative Kriterien
- 3.5.3 Qualitative Kriterien
- 3.6 Würdigung
- 3.6.1 Grundsätzliches
- 3.6.2 Quantitative Kriterien
- 3.6.2.1 Vorteile quantitativer Kriterien
- 3.6.2.2 Nachteile quantitativer Kriterien
- 3.6.3 Qualitative Kriterien
- 3.6.3.1 Grundsätzliches
- 3.6.3.2 Vorteile qualitativer Kriterien
- 3.6.3.3 Nachteile qualitativer Kriterien
- 3.6.4 Fazit
- 4 Reduzierung der Nachteile von qualitativen Kriterien
- 4.1 Grundsätzliches
- 4.2 Status quo
- 4.2.1 Geltendes Recht und Rechtsprechung
- 4.2.2 Reputation
- 4.2.3 Würdigung des Status quo
- 4.4 Diskussion weiterer Maßnahmen
- 4.4.1 Grundsätzliches
- 4.4.2 Mögliche Maßnahmen im Einzelnen
- 5 Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der kritischen Würdigung der Beurteilungskriterien von Rating-Agenturen. Ziel ist es, die Funktionsweise und die Bedeutung von Rating-Agenturen im Finanzmarkt zu analysieren, die verwendeten Kriterien zu bewerten und potenzielle Schwächen und Nachteile aufzuzeigen. Dabei soll insbesondere die Relevanz und die Auswirkungen der qualitativen Kriterien in den Fokus gerückt werden.
- Analyse der Rolle und Funktionsweise von Rating-Agenturen
- Bewertung der verwendeten Beurteilungskriterien
- Kritik und Analyse der Schwächen von Rating-Agenturen
- Fokus auf die Bedeutung qualitativer Kriterien
- Suche nach Lösungen zur Reduzierung der Nachteile von qualitativen Kriterien
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Problemstellung der Arbeit vor. In Kapitel 2 wird die Bedeutung und Entwicklung von Rating-Agenturen im Finanzmarkt beleuchtet. Dabei werden sowohl die Vorteile als auch die potenziellen Nachteile dieser Institutionen aufgezeigt. Kapitel 3 befasst sich mit den Beurteilungskriterien, die von Rating-Agenturen verwendet werden, um Unternehmen und Finanzinstrumente zu bewerten. Es wird die Auswahl, Gewichtung und Aggregation dieser Kriterien analysiert und die Relevanz sowohl quantitativer als auch qualitativer Kriterien erörtert. In Kapitel 4 werden die Schwächen und Nachteile von qualitativen Kriterien diskutiert, die durch die Subjektivität und die Möglichkeit von Fehlinterpretationen entstehen können. Es werden mögliche Lösungsansätze präsentiert, um diese Nachteile zu reduzieren. Kapitel 5 fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit in Form von Thesen zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Rating-Agenturen und fokussiert auf die Analyse der Beurteilungskriterien, die von diesen Institutionen verwendet werden. Die Schlüsselbegriffe beinhalten: Rating-Agenturen, Beurteilungskriterien, qualitative Kriterien, quantitative Kriterien, Finanzmarkt, Risikomanagement, Transparenz, Objektivität, Subjektivität, Fehlinvestitionen, Fehlbewertungen, Regulierung, Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen
Was beurteilen Rating-Agenturen genau?
Ratings beurteilen die Fähigkeit von Unternehmen oder Emittenten, ihre Schulden (Zinsen und Tilgung) in der Zukunft vertragsgemäß zu begleichen.
Was ist der Unterschied zwischen quantitativen und qualitativen Kriterien?
Quantitative Kriterien basieren auf harten Zahlen und Bilanzen (objektiv), während qualitative Kriterien weiche Faktoren wie Managementqualität oder Marktstellung (subjektiv) bewerten.
Warum stehen qualitative Kriterien in der Kritik?
Sie sind schwerer überprüfbar, hängen von der Einschätzung des Analysten ab und bergen daher ein höheres Risiko für Fehlinterpretationen oder Missbrauch.
Welche Bedeutung hat „Basel II“ für Ratings?
Basel II hat die Bedeutung von Ratings massiv erhöht, da die Kreditvergabe der Banken nun stärker von der Bonitätsbewertung der Unternehmen abhängt.
Wie kann die Prognosequalität von Ratings verbessert werden?
Durch höhere Objektivität, strengere Regulierungsmaßnahmen und eine bessere Gewichtung und Aggregation der verschiedenen Beurteilungskriterien.
- Arbeit zitieren
- Christian Klein (Autor:in), 2004, Beurteilungskriterien von Rating-Agenturen - eine kritische Würdigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32976