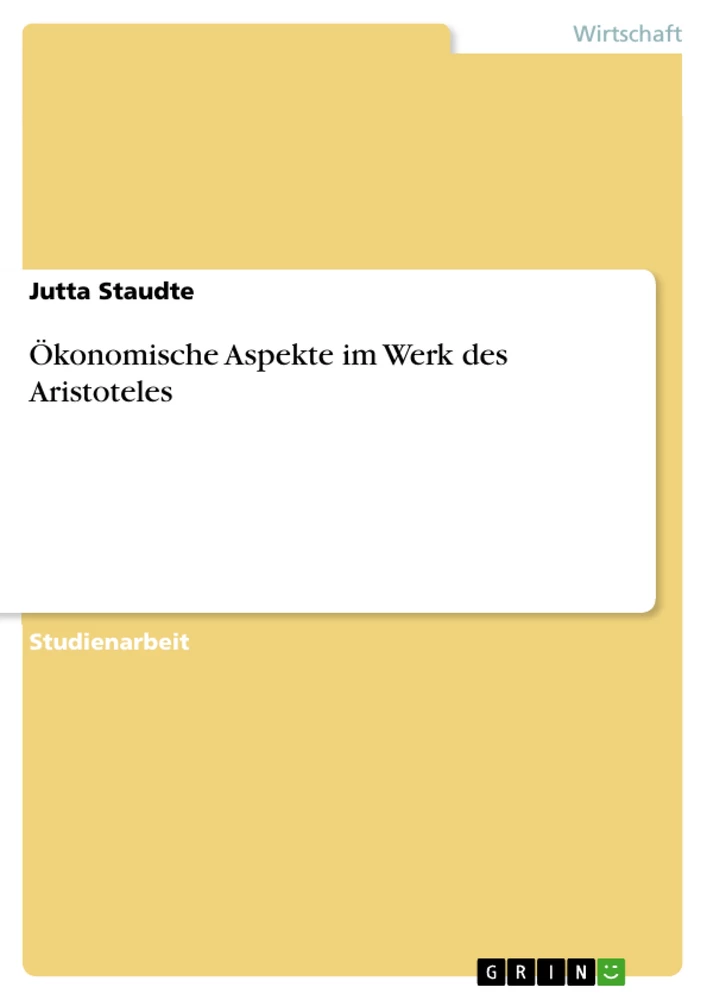Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Betrachtung der Ökonomie als Teil der praktischen Philosophie bei Aristoteles, basierend auf dem Buch I der Politik.
Um die Ausführungen Aristoteles‘ über die Wirtschaft nachvollziehen zu kön-nen, behandele ich zunächst dessen Weltbild und stelle seine ethischen Grundgedanken vor. Den Schwerpunkt lege ich dabei auf die Tugenden und die Staatslehre. Im zweiten Teil werde ich die Eigenschaften des Hauswesens (‚oikonomia‘) bei Aristoteles näher beleuchten und die Begründung des Sklaventums erörtern sowie den Unterschied zwischen Ökonomie und Chrematistik (‚Kunst des Gelderwerbs‘) herausarbeiten. Abschließend gehe ich noch einmal auf einige zentrale Punkte des aristotelischen Werkes kritisch ein.
Der 322 v.Chr. in Makedonien geborene Aristoteles gilt, im Gegensatz zu sei-nem Lehrer Platon, der einen Idealstaat mit literarischer Qualität beschreibt, als kühler Analytiker. Aristoteles ist der erste Philosoph, der wie ein Professor schreibt; seine Abhandlungen sind systematisch in Kapitel eingeteilt. Ein echter Lehrer ist er auch während seiner zwölfjährigen Wanderzeit - sogar der Alexanders des Großen. Da ihn die Leiden der Menschheit scheinbar unberührt lassen, wird ihm Nüchternheit und Gefühlsarmut vorgeworfen.
Aristoteles ist in erster Linie Universalwissenschaftler, der die Vielfalt der Welt ergründen möchte. Neben der umfangreichen empirischen Forschung - im rein deskriptiven Teil seines Gesamtwerkes untersucht er 158 Verfassungen - er-kennt er auch im philosophischen Denken, dass sich alles Bestehende unter einheitliche Prinzipien ordnet. Anstoß für Aristoteles' philosophische Überlegungen ist die Frage nach dem ‚Warum‘ der Dinge und des menschlichen Verhaltens.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ethik als Lehre von der Glückseligkeit (,eudaimonia‘)
- 1.1 Theoretischer Teil der Ethik: Die Tugenden
- 1.2 Praktischer Teil der Ethik: Die Staatslehre
- 2 Die Wirtschaftssphäre bei Aristoteles
- 2.1 Ökonomie als Lehre vom ganzen Haus
- 2.1.1 Begründung des Sklavenwesens
- 2.2 Die Unterscheidung von Ökonomie und Chrematistik
- 3 Kritische Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ökonomischen Aspekte im Werk des Aristoteles, insbesondere im ersten Buch seiner „Politik“. Zunächst wird Aristoteles' Weltbild und seine ethischen Grundgedanken, mit Fokus auf Tugenden und Staatslehre, dargestellt. Anschließend wird die „Ökonomie“ bei Aristoteles beleuchtet, inklusive der Begründung des Sklavenwesens und der Unterscheidung zwischen Ökonomie und Chrematistik. Abschließend erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit zentralen Punkten.
- Aristoteles' ethische Grundprinzipien und die Bedeutung der Tugenden
- Die Konzeption der „Ökonomie“ als Lehre vom Hauswesen bei Aristoteles
- Die Rechtfertigung des Sklavenwesens in der aristotelischen Philosophie
- Der Unterschied zwischen Ökonomie und Chrematistik
- Kritische Betrachtung zentraler Aspekte der aristotelischen Wirtschaftsphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Ethik als Lehre von der Glückseligkeit (,eudaimonia‘): Dieses Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis von Aristoteles' Wirtschaftsphilosophie, indem es sein Weltbild und seine ethischen Grundgedanken erläutert. Aristoteles positioniert den Menschen zwischen Tier und Gott, unterworfen materiellen Bedingungen, aber durch Vernunft und Sprache vom Tierischen unterschieden. Das höchste Ziel des Menschen ist die Glückseligkeit (eudaimonia), erreichbar durch die Ausübung der wertvollsten Anlagen und die Entwicklung von Tugenden. Die Ethik wird sowohl theoretisch (Tugenden) als auch praktisch (Staatslehre) betrachtet. Das Streben nach Glückseligkeit ist dabei kein hinterfragtes, sondern ein grundlegendes menschliches Bestreben.
2 Die Wirtschaftssphäre bei Aristoteles: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Aristoteles' Verständnis von Ökonomie. Die „Ökonomie“ wird als Lehre vom gesamten Hauswesen definiert, wobei die Begründung des Sklavenwesens im Kontext der natürlichen Ordnung der Gesellschaft erörtert wird. Der zentrale Unterschied zwischen Ökonomie (natürlicher Erwerb) und Chrematistik (reiner Gelderwerb) wird herausgestellt, wobei letztere als unnatürlich und ethisch bedenklich bewertet wird. Dieses Kapitel beleuchtet somit den ethischen Rahmen, innerhalb dessen Aristoteles wirtschaftliche Aktivitäten betrachtet.
Schlüsselwörter
Aristoteles, Ethik, Eudaimonia, Ökonomie, Chrematistik, Tugenden, Staatslehre, Sklavenwesen, praktische Philosophie, Glückseligkeit, Goldene Mitte.
Häufig gestellte Fragen zu: Aristoteles' Wirtschaftsphilosophie
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die ökonomischen Aspekte im Werk des Aristoteles, insbesondere in seinem Werk „Politik“. Sie untersucht Aristoteles' ethische Grundprinzipien, seine Konzeption der „Ökonomie“ als Lehre vom Hauswesen, die Rechtfertigung des Sklavenwesens in seiner Philosophie, den Unterschied zwischen Ökonomie und Chrematistik und bietet abschließend eine kritische Betrachtung seiner Wirtschaftsphilosophie.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Aristoteles' ethische Grundprinzipien und die Bedeutung der Tugenden; die Konzeption der „Ökonomie“ bei Aristoteles; die Rechtfertigung des Sklavenwesens in der aristotelischen Philosophie; der Unterschied zwischen Ökonomie und Chrematistik; und eine kritische Betrachtung zentraler Aspekte der aristotelischen Wirtschaftsphilosophie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 behandelt die Ethik bei Aristoteles als Lehre von der Glückseligkeit (Eudaimonia), inklusive des theoretischen (Tugenden) und praktischen Teils (Staatslehre). Kapitel 2 konzentriert sich auf die Wirtschaftssphäre bei Aristoteles, definiert Ökonomie als Lehre vom ganzen Haus, erörtert die Begründung des Sklavenwesens und den Unterschied zwischen Ökonomie und Chrematistik. Kapitel 3 beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit den zentralen Punkten der vorherigen Kapitel.
Was versteht Aristoteles unter „Ökonomie“?
Aristoteles versteht „Ökonomie“ als die Lehre vom gesamten Hauswesen (oikos). Im Gegensatz zur Chrematistik, die er als reinen Gelderwerb und somit als unnatürlich und ethisch bedenklich betrachtet, sieht er die Ökonomie als natürlichen Erwerb an, der im Kontext der natürlichen Ordnung der Gesellschaft eingebettet ist.
Wie rechtfertigt Aristoteles das Sklavenwesen?
Aristoteles rechtfertigt das Sklavenwesen innerhalb seines Verständnisses der natürlichen Ordnung der Gesellschaft. Diese Rechtfertigung findet sich im Kontext seiner „Ökonomie“ und wird im Zusammenhang mit der natürlichen Hierarchie der Menschen erklärt, wobei Sklaven als Menschen betrachtet werden, denen die Fähigkeit zur Selbstverwaltung fehlt.
Was ist der Unterschied zwischen Ökonomie und Chrematistik?
Aristoteles unterscheidet klar zwischen Ökonomie (natürlicher Erwerb, Haushaltung) und Chrematistik (reiner Gelderwerb, Geldvermehrung). Während er die Ökonomie als ethisch unbedenklich betrachtet, sieht er die Chrematistik als unnatürlich und ethisch problematisch an, da sie nicht dem natürlichen Bedürfnis nach Versorgung dient, sondern dem unersättlichen Streben nach Reichtum.
Welche Bedeutung hat die Eudaimonia in Aristoteles' Wirtschaftsphilosophie?
Die Eudaimonia (Glückseligkeit) ist das höchste Ziel des Menschen nach Aristoteles. Seine Wirtschaftsphilosophie ist in dieses ethische Gesamtkonzept eingebettet. Der natürliche Erwerb (Ökonomie) trägt zur Erreichung der Eudaimonia bei, während der reine Gelderwerb (Chrematistik) im Widerspruch dazu steht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aristoteles, Ethik, Eudaimonia, Ökonomie, Chrematistik, Tugenden, Staatslehre, Sklavenwesen, praktische Philosophie, Glückseligkeit, Goldene Mitte.
- Arbeit zitieren
- Jutta Staudte (Autor:in), 2001, Ökonomische Aspekte im Werk des Aristoteles, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3310