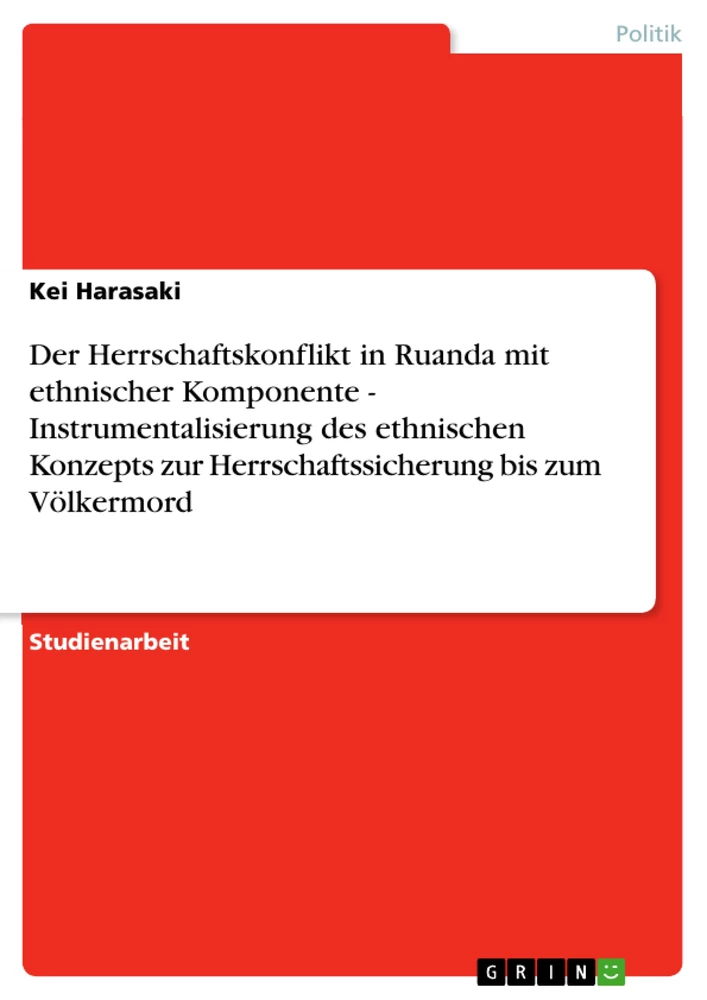1. Einleitung
Im April 1994 begann in einem kleinen Land in Zentralafrika das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit dem Holocaust des zweiten Weltkriegs. Von den Medien nur anfänglich und oberflächlich wahrgenommen, wurden in weniger als 100 Tagen fast eine Millionen Menschen mit, zum Teil, primitivsten Mitteln massakriert. Und obwohl schon frühe Anzeichen einer sich abzeichnenden Krise von der Weltgemeinschaft wahrgenommen worden waren, so wurde die Möglichkeit einer internationalen Hilfe heraus gezögert und verhindert, bis sich der Konflikt selbst gelöst hatte. Was war geschehen? Die bei weitem größere Volksgruppe der Hutu hatte zur kollektiven Hatz auf die Minderheit der Tutsi aufgerufen, mit dem Ergebnis, daß rechnerisch jeder dritte Hutu mindestens einen Mord begangen haben mußte, um in der Kürze der Zeit ein solches Fanal der Grausamkeit zu ermöglichen! Das landesweite Morden hatte erst ein Ende, als die von Norden eindringenden RPF (Rwandan Patriotic Front) – Rebellen, welche Abkömmlinge von vertriebenen Tutsi waren, unaufhaltsam ins Landesinnere vordringen konnten, da der Großteil der regulären Armee und der Milizen mit den Pogromen beschäftigt waren. In Folge dessen begannen große Flüchtlingswellen von Hutus das Land zu verlassen und brachten den Konflikt somit wieder ins Blickfeld der Weltöffentlichkeit.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hypothesen
- Die Bevölkerung Ruandas
- Die Hutu
- Die Tutsi
- Die Twa
- Das präkoloniale Ruanda
- Das präkoloniale Herrschaftssystem
- Das „Ubuhake“-System der Klientele
- Sozialer Status oder Ethnische Identität?
- Das präkoloniale Herrschaftssystem
- Ruanda in der Kolonialzeit
- Einfluß der Kolonialmächte
- Der „hamitische Mythos“
- Die „great chain of being“-Theorie
- Manifestation des ethnischen Konzepts
- Einfluß der Kolonialmächte
- Die postkolonialen Regime
- Die „soziale Revolution“ und das Kayibanda-Regime
- Das Regime von J. Habyarimana
- Vorbereitungen zum Genozid
- Versuch der Schematisierung der Konfliktbearbeitungsmethodik in Ruanda
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Herrschaftskonflikt in Ruanda mit Fokus auf die Instrumentalisierung ethnischer Kategorien zur Herrschaftssicherung, die letztendlich zum Völkermord von 1994 führte. Das Hauptziel ist es, die Entstehung und Eskalation dieses Konflikts zu analysieren und aufzuzeigen, wie die Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi konstruiert und missbraucht wurde.
- Die soziale und politische Organisation Ruandas vor der Kolonialzeit
- Der Einfluss der Kolonialmacht auf die Ethnisierung der Gesellschaft
- Die Rolle der postkolonialen Regime bei der Verschärfung des Konflikts
- Die Konstruktion und Instrumentalisierung ethnischer Identität als Mittel der Herrschaftssicherung
- Die Eskalation des Konflikts zum Völkermord
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Völkermord in Ruanda 1994 und stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen des Konflikts. Sie argumentiert gegen eine zu einfache Erklärung des Konflikts als "Stammeskonflikt" und betont die Bedeutung der postkolonialen Instrumentalisierung ethnischer Kategorien. Das Erkenntnisinteresse liegt auf der Untersuchung, wie Unterschiede zwischen den Volksgruppen konstruiert und verstärkt wurden und wie diese zur Grundlage des Genozids wurden. Der Fokus liegt auf den Akteuren, die die Ethnisierung als Herrschaftsinstrument nutzten.
Hypothesen: Dieses Kapitel präsentiert fünf zentrale Hypothesen. Es postuliert, dass Hutu und Tutsi keine eigenständigen Ethnien sind, sondern die Unterscheidung von außen gelenkt wurde, um die Herrschaft zu sichern. Die fortwährende Instrumentalisierung dieser Unterscheidung führte zur Manifestation und schließlich zur Eskalation des Konflikts, der im Genozid gipfelte.
Die Bevölkerung Ruandas: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die drei Hauptgruppen in Ruanda – Hutu, Tutsi und Twa – und legt den Grundstein für das Verständnis der komplexen sozialen Dynamiken, die den Konflikt prägten. Es legt die Grundlage für die spätere Analyse, wie diese Gruppen in der kolonialen und postkolonialen Periode instrumentalisiert wurden.
Das präkoloniale Ruanda: Dieses Kapitel beschreibt das soziale und politische System Ruandas vor der Kolonialisierung, inklusive des „Ubuhake“-Systems. Es analysiert die Frage, ob soziale Hierarchien auf ethnischen oder anderen Faktoren beruhten, und legt damit die Basis für das Verständnis, wie die Kolonialisierung diese Strukturen veränderte und ethnische Kategorien schärfte.
Ruanda in der Kolonialzeit: Hier wird der Einfluss der Kolonialmächte auf die Entwicklung ethnischer Kategorien untersucht. Konzepte wie der „hamitische Mythos“ und die „great chain of being“-Theorie werden analysiert, um aufzuzeigen, wie diese zur Konstruktion und Verstärkung der Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi beitrugen. Das Kapitel zeigt die Manifestation des ethnischen Konzepts als Werkzeug der kolonialen Herrschaft auf.
Die postkolonialen Regime: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der postkolonialen Regime von Kayibanda und Habyarimana bei der Verschärfung des Konflikts. Es analysiert die „soziale Revolution“ und die Politik von Habyarimana, die zu einer verstärkten Ethnisierung der Gesellschaft beitrugen und den Boden für den Genozid bereiteten. Die Zusammenfassung der einzelnen Unterkapitel wird hier in eine kohärente Darstellung des Einflusses beider Regime auf den Konflikt integriert.
Vorbereitungen zum Genozid: Dieses Kapitel beschreibt die Ereignisse und Entwicklungen, die unmittelbar zum Völkermord führten. Es analysiert die Strategien und Mechanismen, mit denen der Hass geschürt und die Grundlage für den Genozid gelegt wurde. Dies beinhaltet die Analyse politischer Rhetorik und Mobilisierung.
Schlüsselwörter
Ruanda, Völkermord, Hutu, Tutsi, Ethnizität, Kolonialismus, Postkolonialismus, Herrschaftskonflikt, Herrschaftssicherung, Instrumentalisierung, Genozidvorbereitung, „Ubuhake“-System, „hamitischer Mythos“, Konfliktbearbeitung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Herrschaftskonflikt und Völkermord in Ruanda
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Herrschaftskonflikt in Ruanda, der im Völkermord von 1994 gipfelte. Der Fokus liegt auf der Instrumentalisierung ethnischer Kategorien (Hutu und Tutsi) zur Herrschaftssicherung und der Entstehung und Eskalation dieses Konflikts.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die soziale und politische Organisation Ruandas vor der Kolonialzeit, den Einfluss der Kolonialmacht auf die Ethnisierung der Gesellschaft, die Rolle der postkolonialen Regime bei der Konfliktverschärfung, die Konstruktion und Instrumentalisierung ethnischer Identität als Herrschaftsmittel und die Eskalation des Konflikts zum Völkermord.
Welche Hypothesen werden aufgestellt?
Die Arbeit stellt die Hypothese auf, dass Hutu und Tutsi keine eigenständigen Ethnien sind, sondern die Unterscheidung von außen gelenkt wurde, um die Herrschaft zu sichern. Die fortwährende Instrumentalisierung dieser Unterscheidung führte zur Manifestation und Eskalation des Konflikts bis zum Genozid.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Einleitung, Hypothesen, der Bevölkerung Ruandas (Hutu, Tutsi, Twa), dem präkolonialen Ruanda (inkl. dem „Ubuhake“-System), Ruanda in der Kolonialzeit (inkl. „hamitischer Mythos“ und „great chain of being“-Theorie), den postkolonialen Regimen (Kayibanda und Habyarimana), den Vorbereitungen zum Genozid und einem Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Rolle spielte die Kolonialzeit?
Die Kolonialzeit wird als entscheidend für die Konstruktion und Verstärkung der Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi dargestellt. Konzepte wie der „hamitische Mythos“ und die „great chain of being“-Theorie wurden von den Kolonialmächten instrumentalisiert, um die Gesellschaft zu ethnisieren und die Herrschaft zu sichern.
Welche Rolle spielten die postkolonialen Regime?
Die postkolonialen Regime von Kayibanda und Habyarimana werden als maßgeblich für die Verschärfung des Konflikts verantwortlich gemacht. Ihre Politik trug zu einer verstärkten Ethnisierung der Gesellschaft bei und bereitete den Boden für den Genozid.
Wie wird der Konflikt erklärt?
Der Konflikt wird nicht als einfacher „Stammeskonflikt“ erklärt, sondern als Ergebnis einer langjährigen Instrumentalisierung ethnischer Kategorien zur Herrschaftssicherung, beginnend in der Kolonialzeit und fortgesetzt in der postkolonialen Periode. Die Arbeit betont die konstruierte Natur der ethnischen Unterschiede und deren Missbrauch als Mittel der Macht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Ruanda, Völkermord, Hutu, Tutsi, Ethnizität, Kolonialismus, Postkolonialismus, Herrschaftskonflikt, Herrschaftssicherung, Instrumentalisierung, Genozidvorbereitung, „Ubuhake“-System, „hamitischer Mythos“, Konfliktbearbeitung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, die Entstehung und Eskalation des Konflikts in Ruanda zu analysieren und aufzuzeigen, wie die Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi konstruiert und missbraucht wurde, um die Herrschaft zu sichern und letztendlich zum Völkermord führte.
- Arbeit zitieren
- Kei Harasaki (Autor:in), 2001, Der Herrschaftskonflikt in Ruanda mit ethnischer Komponente - Instrumentalisierung des ethnischen Konzepts zur Herrschaftssicherung bis zum Völkermord, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3317