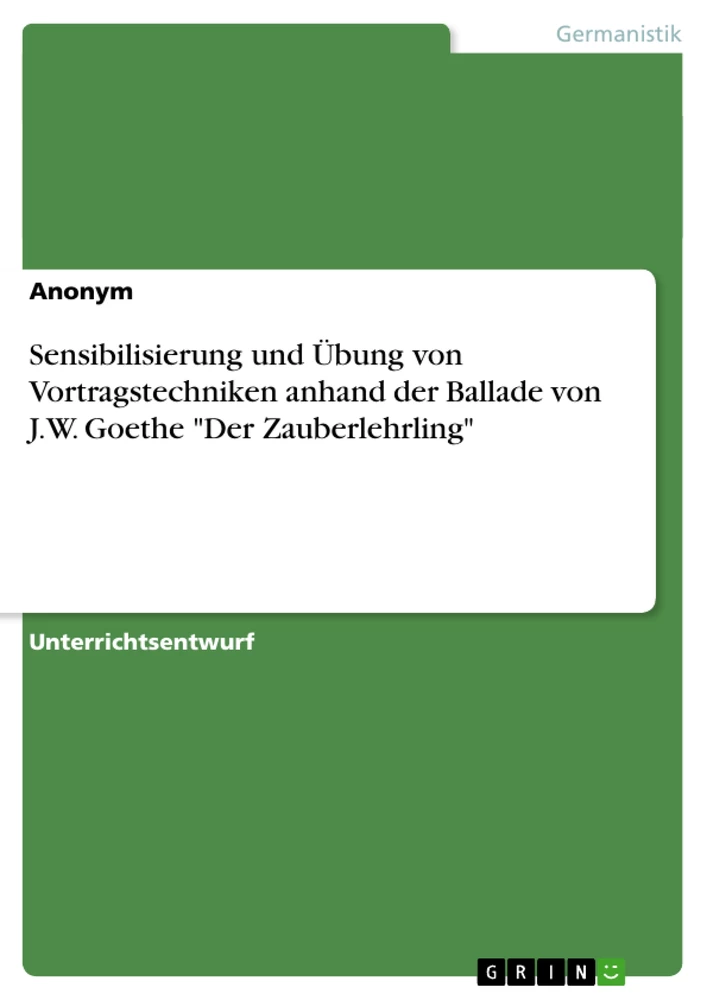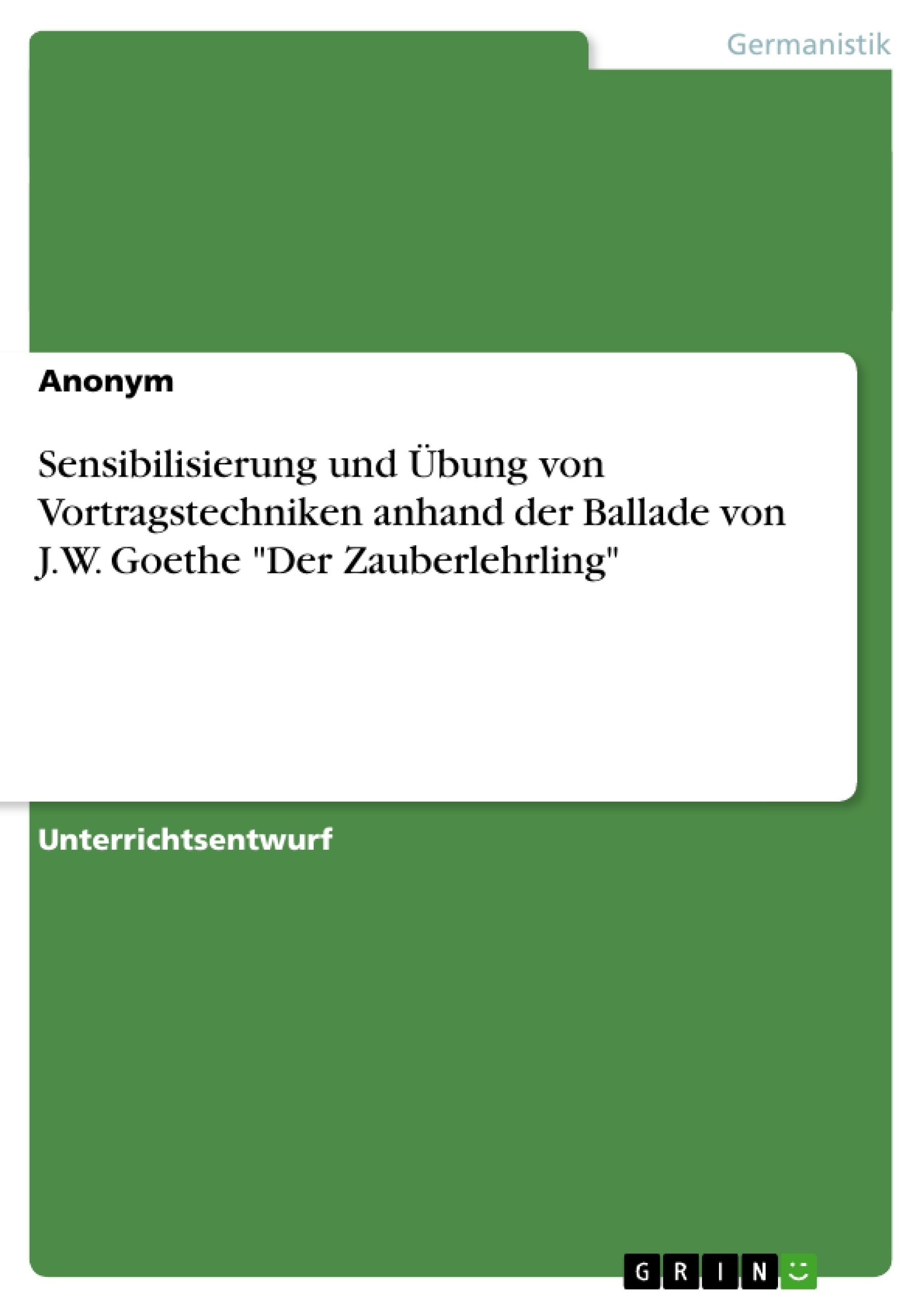Die Klasse 7 setzt sich aus 29 Schülerinnen und Schülern zusammen.
Ich kenne die Lerngruppe seit Beginn dieses Halbjahres und eine längere Hospitationszeit machte es mir möglich, die Klasse und ihre Stärken und Schwächen vor Beginn des Unterrichtsvorhabens bereits näher kennen zu lernen. Es handelt sich bei dieser Klasse um eine große heterogene Lerngruppe.
Die Lerngruppe zeigt dem Alter entsprechend pubertäre Verhaltensweisen; diese beeinflussen nicht nur den Umgang mit Themen und Texten, sondern zeigen sich auch insbesondere im Sozialverhalten der Klasse (z. B. Akzeptanz zwischen Jungen und Mädchen), aufgrund dessen Gruppenarbeitsphasen nur bedingt möglich sind. Die Klassengröße erfordert regelmäßige Stillarbeitsphasen, in denen die Aufmerksamkeit und die Konzentration der SuS gebündelt wird.
Im Hinblick auf Präsentationsphasen vor der Klasse zeigen die SuS großes Interesse und Kreativität, jedoch sind solche Phase nur dann konstruktiv, wenn die Aufmerksamkeit der Mitschüler durch Hörverstehensaufträge gelenkt wird. Erstaunlichweise zeigt die Klasse in solchen Phasen der Präsentation eine deutliche höher Akzeptanz im Sozialverhalten als zu erwarten wäre.
Im Hinblick auf die Heterogenität der Lerngruppe lassen sich folgende Feststellung zusammenfassen: Insbesondere Mädchen fallen durch leistungsstarkes und engagiertes Verhalten im Unterricht auf, während es eine Reihe von leistungsschwachen Schülern in der Klasse gibt (z. B. die Jungengruppe in der letzten Reihe), die durch störendes Verhalten den Unterrichtsverlauf stellenweise stark beeinflussen.
Aufgrund des motivierenden Einstiegs in das Unterrichtsvorhaben durch die gemeinsame Erarbeitung eines Balladenlexikons und der Auswahl der Balladen unter dem thematischen Schwerpunkt „Märchen, Geister und Gespenster“ sind die Unterrichtsstörungen deutlich zurückgegangen, so dass insgesamt die Arbeithaltung der Klasse bisher sehr positiv ist. Das aktuelle Unterrichtsvorhaben habe ich nach den Herbstferien begonnen und vor der heutigen Stunde liegen 8 Unterrichtsstunden. Insgesamt ist eine Dauer von maximal 24 Unterrichtsstunden geplant in deren Mitte eine einstündige Klassenarbeit steht.
Inhaltsverzeichnis
- I. Anmerkungen zur Lerngruppe und zur Lernsituation
- II. Einordnung der Stunde in den Kontext
- III. Ziele und Intentionen der Unterrichtsstunde
- a) Stundenziel
- b) Teilziele
- IV. Didaktischer Schwerpunkt und methodische Reflexion
- V. Verlaufsplan
- VI. Anhang: Arbeitsblätter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Unterrichtsplanung beschreibt eine einzelne Stunde im Rahmen eines größeren Unterrichtsvorhabens zum Thema Balladen. Das übergeordnete Ziel ist die produktionsorientierte Auseinandersetzung mit der Textsorte Ballade, speziell mit Goethes "Der Zauberlehrling". Die Stunde konzentriert sich auf die Sensibilisierung der Schüler für Gestaltungselemente eines Vortrags im Kontext der emotionalen Entwicklung des Zauberlehrlings.
- Gestaltungselemente eines Vortrags
- Interpretation von Texten durch Sprechen
- Textverständnis durch gestaltendes Lesen
- Analyse der Gemütsverfassung des Zauberlehrlings
- Zusammenhang zwischen Text und Vortrag
Zusammenfassung der Kapitel
I. Anmerkungen zur Lerngruppe und zur Lernsituation: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Einblick in die Zusammensetzung und die Charakteristika der siebten Klasse. Es beschreibt die Heterogenität der Lerngruppe, mit leistungsstarken Mädchen und leistungsschwächeren Jungen, die durch störendes Verhalten den Unterricht beeinflussen können. Trotz der Herausforderungen wird die positive Arbeitshaltung der Klasse im Kontext des aktuellen Unterrichtsvorhabens hervorgehoben, welches mit einem Balladenlexikon und der thematischen Fokussierung auf "Märchen, Geister und Gespenster" begonnen wurde. Die bisherigen positiven Entwicklungen und die geplanten weiteren Schritte werden erläutert.
II. Einordnung der Stunde in den Kontext: Dieses Kapitel beschreibt den gesamten Kontext des Unterrichtsvorhabens, das sich mit Balladen auseinandersetzt. Die produktionsorientierte Ausrichtung, in Abstimmung mit der Ausbildungslehrerin und im Einklang mit den Richtlinien und Lehrplänen, wird betont. Die Auswahl der Balladen unter dem Thema "Märchen, Geister und Gespenster" wird begründet, und die didaktischen Entscheidungen werden durch die motivierende Handlungsstruktur der Balladen und den Fokus auf kreative Aufgabenstellungen erklärt. Der bisherige Verlauf des Vorhabens, inklusive der Einführung der Begriffe Lyrik, Epik und Dramatik mittels eines Balladenlexikons und spielerischer Vortragspräsentationen, wird detailliert beschrieben. Der zweite Teil des Vorhabens konzentriert sich auf den Aspekt des Sprechens und die Vorbereitung auf ein Hörspiel.
III. Ziele und Intentionen der Unterrichtsstunde: Dieses Kapitel definiert das Stundenziel und die Teilziele der Unterrichtseinheit. Das Stundenziel besteht darin, dass die Schüler ein erstes Textverständnis von Goethes "Der Zauberlehrling" entwickeln, Erfahrungen mit einem Vortrag sammeln und für differenzierte Gestaltungselemente sensibilisiert werden. Die Teilziele umfassen das Erproben von gestaltendem Lesen und Vortrag, die Entwicklung des Hörverständnisses durch Höraufträge, die Übung der Kritikfähigkeit, das Erkennen von Kriterien für einen guten Vortrag und die Erfassung der Entwicklung der Gemütsverfassung des Zauberlehrlings.
IV. Didaktischer Schwerpunkt und methodische Reflexion: Dieses Kapitel erläutert die didaktischen Entscheidungen und die methodische Vorgehensweise. Die Auswahl von Goethes "Der Zauberlehrling" wird durch den Bezug zu aktuellen Schülerinteressen (Harry Potter) und die didaktische Schwerpunktsetzung auf die Sensibilisierung für Gestaltungselemente des Vortrags gerechtfertigt. Die Methode beinhaltet vorbereitende Hausaufgaben, Präsentationsphasen mit Hörverstehensaufträgen, Auswertungsphasen und eine abschließende Diskussion über die Veränderung der Gemütsverfassung des Zauberlehrlings. Die Bedeutung der impliziten und expliziten Interpretation und die methodische Gestaltung der Auswertungsphasen werden detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Balladen, Goethe, Der Zauberlehrling, gestaltendes Sprechen, Vortragsgestaltung, Textinterpretation, Gemütsverfassung, Hörverständnis, Schülerpräsentation, produktionsorientierte Didaktik, Lyrik, Epik, Dramatik.
FAQ: Unterrichtsplanung zu Goethes "Der Zauberlehrling"
Was ist der allgemeine Gegenstand dieser Unterrichtsplanung?
Die Unterrichtsplanung beschreibt eine einzelne Stunde im Rahmen eines größeren Unterrichtsvorhabens zum Thema Balladen, speziell zu Goethes "Der Zauberlehrling". Der Fokus liegt auf der produktionsorientierten Auseinandersetzung mit der Textsorte Ballade und der Sensibilisierung der Schüler für Gestaltungselemente eines Vortrags im Kontext der emotionalen Entwicklung des Zauberlehrlings.
Welche Themen werden in der Stunde behandelt?
Die Stunde behandelt Gestaltungselemente eines Vortrags, die Interpretation von Texten durch Sprechen, Textverständnis durch gestaltendes Lesen, die Analyse der Gemütsverfassung des Zauberlehrlings und den Zusammenhang zwischen Text und Vortrag.
Welche Kapitel umfasst die Unterrichtsplanung?
Die Planung gliedert sich in sechs Kapitel: Anmerkungen zur Lerngruppe und zur Lernsituation; Einordnung der Stunde in den Kontext; Ziele und Intentionen der Unterrichtsstunde; Didaktischer Schwerpunkt und methodische Reflexion; Verlaufsplan; und Anhang: Arbeitsblätter.
Wie ist die Lerngruppe charakterisiert?
Die Lerngruppe ist eine siebte Klasse mit einer heterogenen Zusammensetzung. Es gibt leistungsstarke Mädchen und leistungsschwächere Jungen, die durch störendes Verhalten den Unterricht beeinflussen können. Trotz dieser Herausforderungen wird eine positive Arbeitshaltung im Kontext des aktuellen Unterrichtsvorhabens hervorgehoben.
Wie wird die Stunde in den Kontext des größeren Unterrichtsvorhabens eingeordnet?
Das Unterrichtsvorhaben befasst sich mit Balladen unter dem Thema "Märchen, Geister und Gespenster". Die Stunde ist produktionsorientiert angelegt und zielt auf die Vorbereitung auf ein Hörspiel ab. Der bisherige Verlauf umfasste die Einführung von Lyrik, Epik und Dramatik mittels eines Balladenlexikons und spielerischer Vortragspräsentationen.
Was sind die Ziele und Intentionen der Unterrichtsstunde?
Das Stundenziel ist die Entwicklung eines ersten Textverständnisses von Goethes "Der Zauberlehrling", das Sammeln von Vortragserfahrungen und die Sensibilisierung für differenzierte Gestaltungselemente. Teilziele umfassen gestaltendes Lesen und Vortragen, Entwicklung des Hörverständnisses, Übung der Kritikfähigkeit, Erkennen von Kriterien für einen guten Vortrag und die Erfassung der Entwicklung der Gemütsverfassung des Zauberlehrlings.
Welche didaktischen Schwerpunkte und Methoden werden eingesetzt?
Der didaktische Schwerpunkt liegt auf der Sensibilisierung für Gestaltungselemente des Vortrags. Die Methode beinhaltet vorbereitende Hausaufgaben, Präsentationen mit Hörverstehensaufträgen, Auswertungsphasen und eine abschließende Diskussion. Die Bedeutung der impliziten und expliziten Interpretation wird betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Unterrichtsplanung?
Schlüsselwörter sind Balladen, Goethe, Der Zauberlehrling, gestaltendes Sprechen, Vortragsgestaltung, Textinterpretation, Gemütsverfassung, Hörverständnis, Schülerpräsentation, produktionsorientierte Didaktik, Lyrik, Epik und Dramatik.
Wie ist der Bezug zu "Harry Potter"?
Die Auswahl von Goethes "Der Zauberlehrling" wird durch den Bezug zu aktuellen Schülerinteressen (Harry Potter) gerechtfertigt, um die Motivation zu steigern.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2004, Sensibilisierung und Übung von Vortragstechniken anhand der Ballade von J.W. Goethe "Der Zauberlehrling", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33347