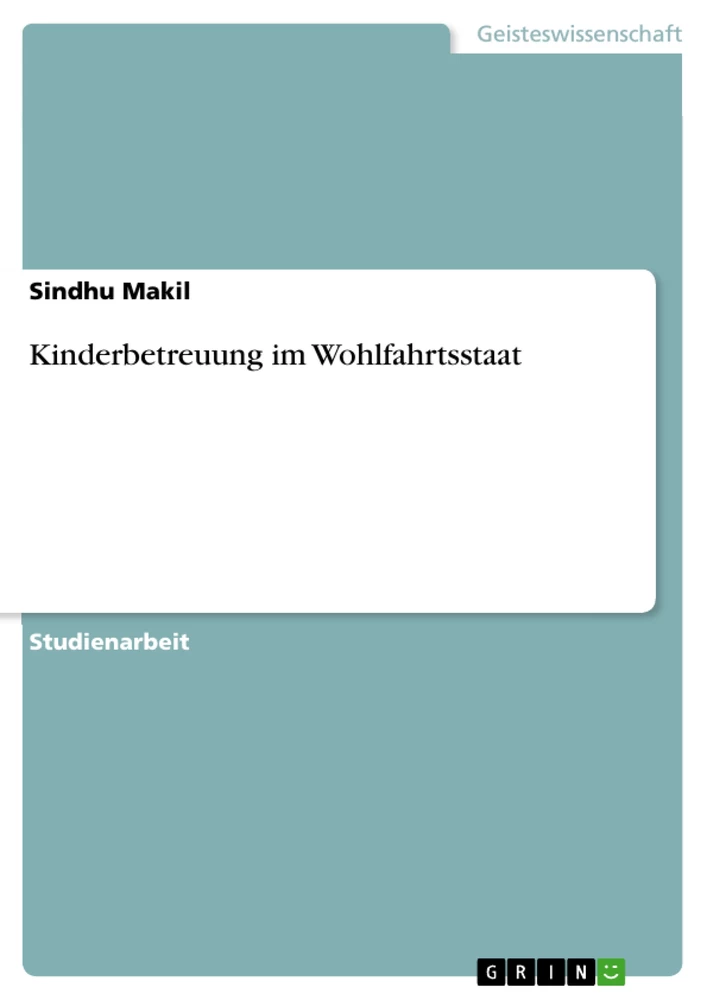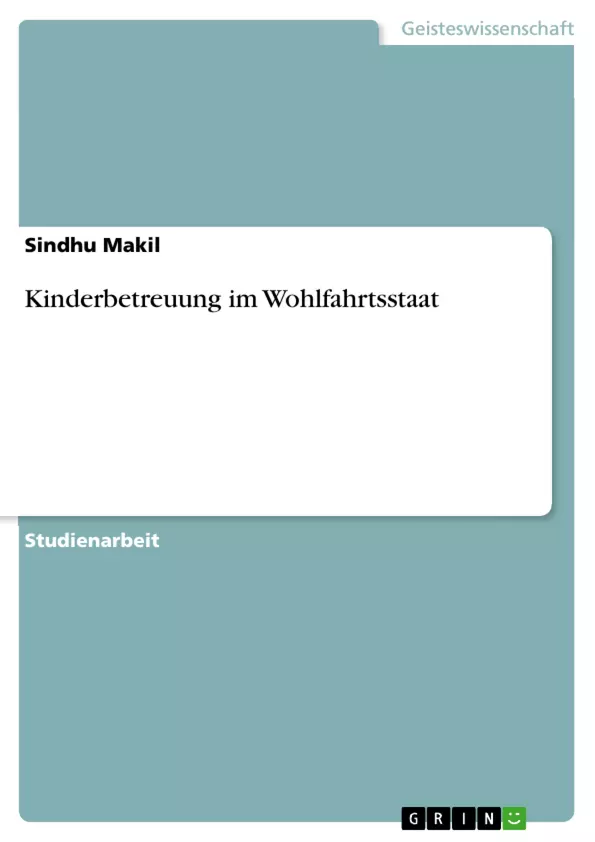Unsere Arbeit ‚Wohlfahrtsstaat und Kinderbetreuung’ beginnt mit einer allgemeinen theoretischen Grundlage zum Wohlfahrtsstaat nach Gøsta Esping-Andersens Ausführungen und Birgit Pfau-Effingers Geschlechtskultureller Theorie. Danach wollen wir in einem Ländervergleich das Erwerbsverhalten von Frauen in den USA und der BRD untersuchen, um zu überprüfen inwiefern unterschiedliche kulturelle Hintergründe zu unterschiedlichen Zielsetzungen in der Familienpolitik führen.
Anschließend wollen wir uns auf die Situation der außerhäusigen Kinderbetreuung in Deutschland konzentrieren, indem wir den Status quo bezüglich dieses Themas darstellen. Unserer Meinung nach ist es auch wichtig, die positiven Effekte der Kinderbetreuung - sowohl auf die Entwicklung des Kindes als auch auf die Allgemeinheit – herauszustellen.
Was bewirkt die öffentliche Kinderbetreuung auf die Kinder?
Was bedeutet die außerhäusige Kinderbetreuung für Mütter, Väter und die Gesellschaft?
Es ist allgemein bekannt, dass das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen zu gering ist und dass es nicht den Bedürfnissen der Eltern entspricht. Wir werden also versuchen, verschiedenen Reformmodelle dem aktuellen System in Deutschland gegenüberzustellen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Modelle der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung (von Sindhu Makil)
- Die drei Wohlfahrtsregime nach Gøsta Esping-Andersen
- Operationalisierung des Modells anhand von drei Kategorien
- Die drei Wohlfahrtsregime in Detail
- Das Geschlechterkulturelle Modell nach Birgit Pfau-Effinger
- Die Grundbegriffe der geschlechterkulturellen Theorien
- Die Geschlechter-Arrangements in West-Europa
- Die drei Wohlfahrtsregime nach Gøsta Esping-Andersen
- Das Erwerbsverhalten von Frauen im internationalen Vergleich – (West-) Deutschland - USA (von Annette Lohny)
- Die historischen Veränderungen im Erwerbsverhalten und Erwerbsverläufen
- Familienpolitik – Transferzahlungen – Steuergesetze
- Mutterschutzgesetzgebung und Erziehungsurlaub
- Außerhäusige Kinderbetreuung im Vergleich
- Diskriminierung von Frauen?
- Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Vergleichs
- Daten zur öffentlichen Kinderbetreuung (von Sindhu Makil)
- Außerhäusige Kinderbetreuung in der DDR
- Gegenwärtige Situationsbeschreibung der außerhäusigen Kinderbetreuung in der BRD
- Warum ist eine außerhäusige Kinderbetreuung sinnvoll? (von Elisabeth Chrobok)
- Ziele
- Zukünftige Bedeutung der außerhäusigen Kinderbetreuung
- Das aktuelle System in Detail und Reformvorschläge (von Elisabeth Chrobok)
- Aktuelles System
- Begriffsbestimmungen und Aufträge
- Das gegenwärtige Kinderbetreuungs- und Finanzierungssystem
- Demonstration zweier Modelle für eine Verbesserung in der Kinderbetreuung
- Modell: Gutscheinsystem
- Modell: Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung
- Vorteile einer betrieblich unterstützten Kinderbetreuung
- Verschiedenen Vorschläge für betrieblich unterstützte Kinderbetreuung
- Aktuelles System
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Kinderbetreuung im Wohlfahrtsstaat. Sie analysiert die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung anhand von Gøsta Esping-Andersens Wohlfahrtsregime-Modell und Birgit Pfau-Effingers Geschlechtskulturellem Modell. Anschließend wird ein Ländervergleich zwischen den USA und der BRD durchgeführt, um Unterschiede im Erwerbsverhalten von Frauen und in der Familienpolitik zu untersuchen. Der Fokus liegt dann auf der Situation der außerhäusigen Kinderbetreuung in Deutschland, einschließlich der Darstellung des Status quo und der Herausarbeitung positiver Effekte der Kinderbetreuung. Die Arbeit analysiert schließlich das aktuelle System der Kinderbetreuung in Deutschland und stellt verschiedene Reformmodelle vor.
- Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Kontext des Wohlfahrtsstaates
- Der Vergleich der Erwerbsbedingungen von Frauen in den USA und der BRD
- Die Situation der außerhäusigen Kinderbetreuung in Deutschland
- Die positiven Auswirkungen der Kinderbetreuung auf Kinder, Eltern und Gesellschaft
- Die Analyse und Bewertung des aktuellen Kinderbetreuungssystems in Deutschland und die Präsentation von Reformmodellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Vorwort
Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die Thematik der Arbeit und stellt die wichtigsten Ziele und Fragestellungen vor.
- Kapitel 2: Modelle der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
Dieses Kapitel analysiert verschiedene Modelle der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, insbesondere die drei Wohlfahrtsregime nach Gøsta Esping-Andersen und das Geschlechterkulturelle Modell nach Birgit Pfau-Effinger.
- Kapitel 3: Das Erwerbsverhalten von Frauen im internationalen Vergleich
Dieses Kapitel vergleicht das Erwerbsverhalten von Frauen in den USA und der BRD und analysiert die Unterschiede in Bezug auf die historische Entwicklung, die Familienpolitik, den Mutterschutz, die außerhäusige Kinderbetreuung und die Diskriminierung von Frauen.
- Kapitel 4: Daten zur öffentlichen Kinderbetreuung
Dieses Kapitel präsentiert Daten zur außerhäusigen Kinderbetreuung in der DDR und der BRD und beleuchtet die gegenwärtige Situation der Kinderbetreuung in Deutschland.
- Kapitel 5: Warum ist eine außerhäusige Kinderbetreuung sinnvoll?
Dieses Kapitel argumentiert für die Bedeutung und die positiven Effekte der außerhäusigen Kinderbetreuung für Kinder, Eltern und Gesellschaft.
- Kapitel 6: Das aktuelle System in Detail und Reformvorschläge
Dieses Kapitel beschreibt das aktuelle Kinderbetreuungssystem in Deutschland und analysiert seine Stärken und Schwächen. Es stellt außerdem verschiedene Reformmodelle vor, die das bestehende System verbessern könnten.
Schlüsselwörter
Kinderbetreuung, Wohlfahrtsstaat, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, Erwerbsverhalten, Familienpolitik, internationaler Vergleich, USA, Deutschland, außerhäusige Kinderbetreuung, Reformmodelle, Gøsta Esping-Andersen, Birgit Pfau-Effinger, Dekommodifizierung.
Häufig gestellte Fragen
Welche theoretischen Grundlagen werden in der Arbeit zur Kinderbetreuung verwendet?
Die Arbeit basiert auf den Wohlfahrtsregime-Modellen von Gøsta Esping-Andersen und der geschlechtskulturellen Theorie von Birgit Pfau-Effinger.
Welche Länder werden im Hinblick auf das Erwerbsverhalten von Frauen verglichen?
Es wird ein internationaler Vergleich zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland (BRD) durchgeführt.
Welche positiven Effekte hat die außerhäusige Kinderbetreuung?
Die Kinderbetreuung hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes, die Erwerbsmöglichkeiten der Eltern sowie auf die gesamte Gesellschaft.
Welche Reformmodelle für das deutsche Kinderbetreuungssystem werden vorgestellt?
Die Arbeit analysiert insbesondere das Gutscheinsystem sowie Modelle für eine betrieblich unterstützte Kinderbetreuung.
Was wird unter dem Begriff Dekommodifizierung verstanden?
Im Kontext der Wohlfahrtsstaatstheorie nach Esping-Andersen beschreibt Dekommodifizierung den Grad, in dem soziale Dienstleistungen unabhängig vom Markt erbracht werden.
- Quote paper
- Sindhu Makil (Author), 2001, Kinderbetreuung im Wohlfahrtsstaat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3335