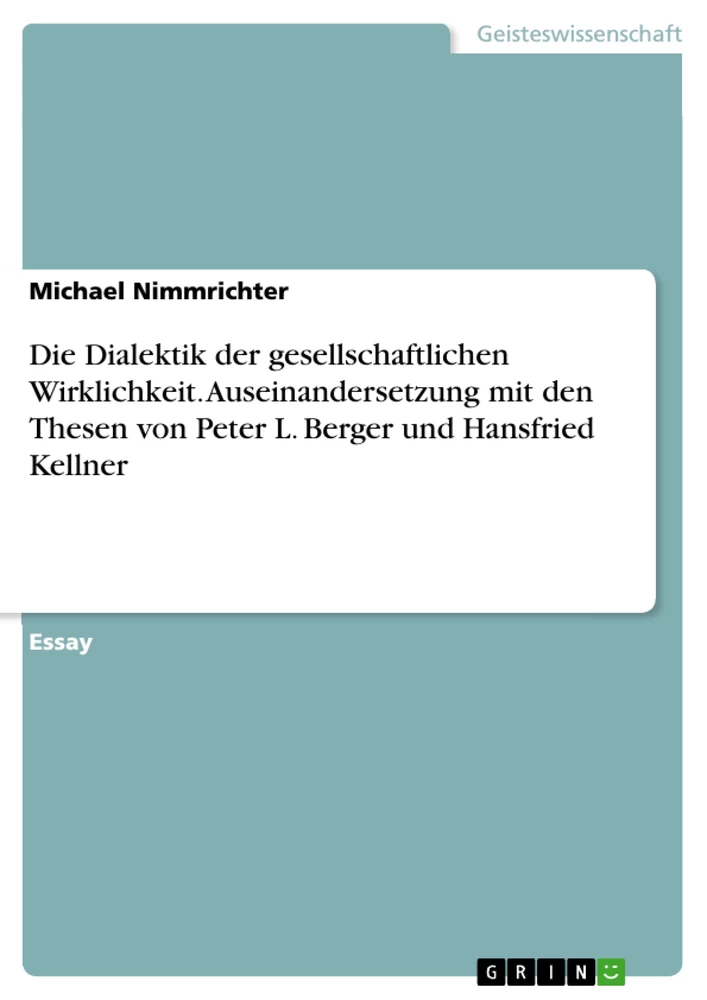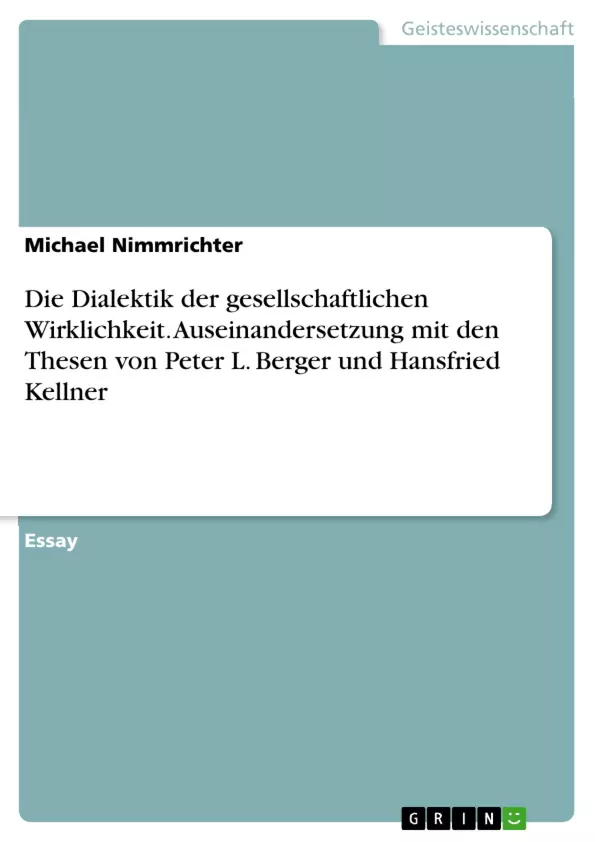Das vorliegende Essay setzt sich inhaltlich mit einem speziellen Aspekt der von Peter L. Berger und Hansfried Kellner 1965 in der Zeitschrift „Soziale Welt“ publizierten Abhandlung „Die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit: Eine Abhandlung zur Mikrosoziologie des Wissens“ auseinander. Dieser Aspekt ist das darin postulierte Phänomen der „[…] Kristallisation der sogenannten privaten Sphäre, die sich mehr und mehr der Kontrolle durch die öffentlichen Institutionen […] entzieht und die doch als entscheidender gesellschaftlicher Bereich, in dem der einzelne seine Selbstverwirklichung erreichen kann, definiert und verwendet wird“ (Berger & Kellner, 1965, p. 223).
Die expliziten Ursachen dieses Phänomens werden in der Abhandlung von Berger und Kellner nicht näher erläutert. Es wird lediglich behauptet, dass es „[…] mehr oder weniger zufällig als Nebenprodukt der gesellschaftlichen Metamorphose durch die Industrialisierung entstand“ (ebd., p. 224). Diesbezüglich wird im Rahmen dieses Essays der Versuch unternommen, der von Berger und Kellner formulierten Begründung des Phänomens, als zufällige Folge einer gesellschaftshistorischen Entwicklung, die folgende Gegenthese zur Diskussion zu stellen.
Das Phänomen der Kristallisation der privaten Sphäre lässt sich als notwendige Konsequenz einer Dialektik ableiten, die bereits dem Prinzip der Identitätsbildung inhärent ist, welches Berger und Kellner als integralen Bestandteil des nomischen Prozesses beschreiben, dessen Funktionsweise ihrer Theorie zugrunde liegt!
Inhaltsverzeichnis
- Die Dialektik der gesellschaftlichen Wirklichkeit
- Der nomische Prozess
- Objektivierung und Subjektivierung
- Die private Sphäre und die Identitätsbildung
- George Herbert Meads Theorie der Identität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Textdiskussion befasst sich mit der von Peter L. Berger und Hansfried Kellner postulierten Kristallisation der privaten Sphäre. Sie stellt die von den Autoren vorgebrachte Begründung als zufällige Folge einer gesellschaftlichen Entwicklung in Frage und argumentiert, dass das Phänomen als notwendige Konsequenz einer Dialektik verstanden werden kann, die dem Prinzip der Identitätsbildung inhärent ist.
- Die Dialektik zwischen Objektivierung und Subjektivierung
- Das Realitätsbedürfnis und die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit
- Das Identitätsbedürfnis und die Bedeutung der privaten Sphäre
- Der nomische Prozess und seine Rolle in der Identitätsbildung
- Die Rolle von George Herbert Meads Theorie der Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beleuchtet zunächst die von Berger und Kellner beschriebene Kristallisation der privaten Sphäre und stellt deren Begründung als zufällige Folge einer gesellschaftlichen Entwicklung in Frage. Es wird argumentiert, dass das Phänomen als notwendige Konsequenz einer Dialektik verstanden werden kann, die dem Prinzip der Identitätsbildung inhärent ist.
Im weiteren Verlauf wird der von Berger und Kellner postulierte nomische Prozess detailliert dargestellt. Dieser Prozess, der eine bestehende Wirklichkeit schafft, erhält und modifiziert, basiert auf zwei antagonistischen Prinzipien: Objektivierung und Subjektivierung. Die Objektivierung ermöglicht dem Individuum, die Welt als objektiv verständlich zu erfahren, während die Subjektivierung es ihm erlaubt, sich eine Welt zu schaffen, in der es sich zu Hause fühlt.
Der Text argumentiert, dass die Kristallisation der privaten Sphäre das menschliche Bedürfnis nach Identität und einer als subjektiv sinnhaft erfahrbaren Stellung in der Welt bedient. Es wird jedoch kritisiert, dass Berger und Kellner den Prozess der Identitätsbildung innerhalb der Gesellschaft nur unzureichend explizieren.
Um dieses Defizit zu kompensieren, wird im letzten Kapitel die Theorie der Identität von George Herbert Mead vorgestellt. Meads Theorie basiert auf dem Konzept des self, das sich aus zwei Komponenten zusammensetzt: dem I und dem me. Das I repräsentiert den individuellen und kreativen Teil der Identität, während das me die Vorstellung des Einzelnen von dem Bild ist, welches ein signifikanter Anderer von ihm hat.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen des Textes sind: gesellschaftliche Wirklichkeit, nomischer Prozess, Objektivierung, Subjektivierung, private Sphäre, Identitätsbildung, George Herbert Mead, self, I, me, signifikanter Anderer, Interaktion.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentralen Thesen von Berger und Kellner werden in diesem Essay diskutiert?
Der Essay setzt sich mit der Abhandlung „Die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit“ auseinander, insbesondere mit dem Phänomen der „Kristallisation der privaten Sphäre“.
Welche Gegenthese stellt der Autor zu Berger und Kellner auf?
Der Autor argumentiert, dass die private Sphäre nicht zufällig durch die Industrialisierung entstand, sondern eine notwendige Konsequenz der Dialektik der Identitätsbildung ist.
Was wird unter dem "nomischen Prozess" verstanden?
Der nomische Prozess ist ein Mechanismus, der gesellschaftliche Wirklichkeit schafft, erhält und modifiziert. Er basiert auf den Prinzipien der Objektivierung und Subjektivierung.
Welche Rolle spielt George Herbert Mead in dieser Arbeit?
Meads Theorie der Identität (I und Me) wird herangezogen, um das Defizit bei Berger und Kellner hinsichtlich der Explikation von Identitätsbildungsprozessen auszugleichen.
Was ist der Unterschied zwischen Objektivierung und Subjektivierung?
Objektivierung lässt das Individuum die Welt als objektiv verständlich erfahren, während Subjektivierung es erlaubt, eine Welt zu schaffen, in der man sich subjektiv zu Hause fühlt.
- Quote paper
- Michael Nimmrichter (Author), 2016, Die Dialektik der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Auseinandersetzung mit den Thesen von Peter L. Berger und Hansfried Kellner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/333855