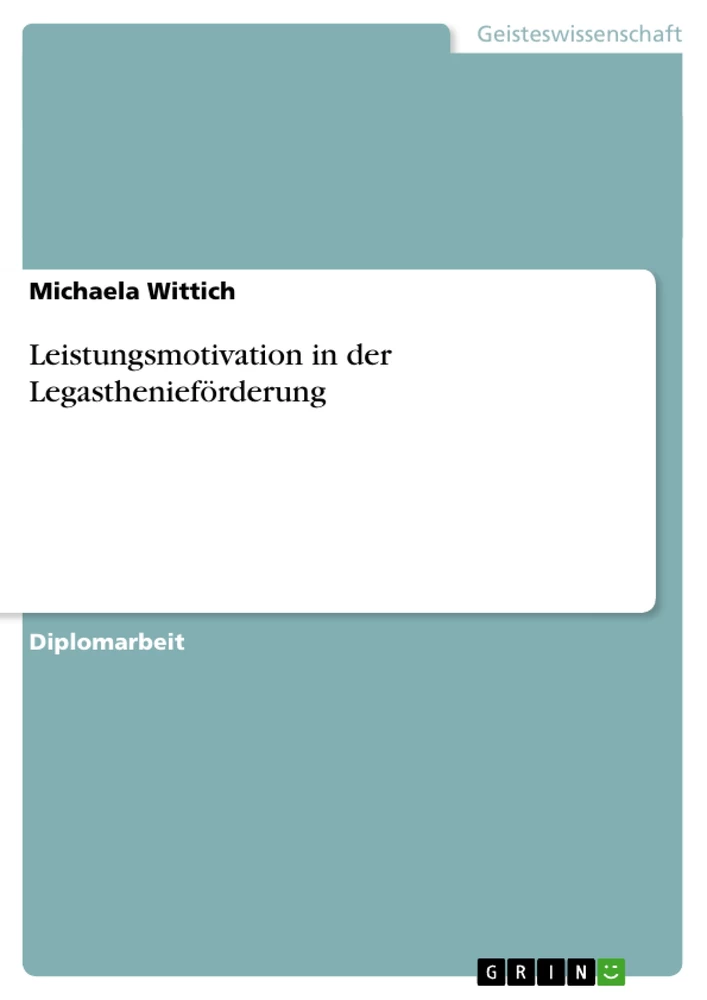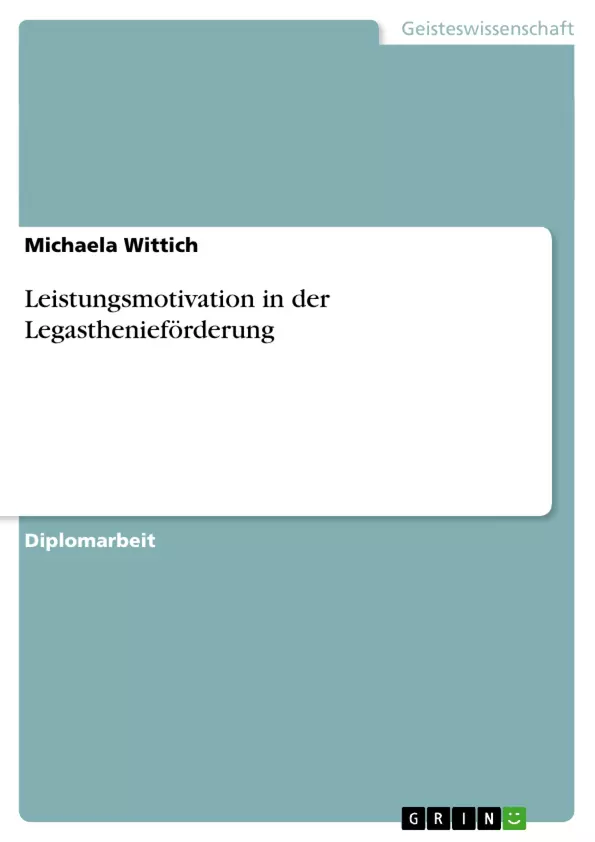[...] Diese Theorien sind natürlich kritisierbar, dennoch
wird sich in der von mir verwendeten Literatur immer wieder auf diese Ansätze bezogen, was
ihre Bedeutsamkeit bestätigt. Da es nicht Ziel dieser Arbeit ist, die Ansätze auf ihre
Wahrhaftigkeit zu überprüfen, sondern sie für die Verstehbarkeit von Motivation zu nutzen,
werde ich auf ihre Kritisierbarkeit nicht weiter eingehen.
Im weiteren Verlauf werde ich dann auf die Definition und Aspekte der Leistungsmotivation
eingehen und auch diese durch einen theoretischen Ansatz begründen. Da ich die Erläuterungen zur Motivation im Allgemeinen und speziell zur
Leistungsmotivation für grundlegend halte, werde ich erst im Anschluss an diese das Thema
der Legasthenie konkretisieren. Dabei greife ich auf die Definition nach dem ICD-10 (s.
III.1.) zurück, dessen Anwendung ebenfalls kritisierbar ist, jedoch international stattfindet und
für meine Arbeit grundlegend ist, wenn beispielsweise die Förderung aufgrund dieser
Diagnose durch das Jugendamt nach §35a SGB VIII finanziert wird. Um sich ein Bild von
den Auswirkungen der Legasthenie machen zu können, werde ich ihre Symptomatik in einer
kurzen Übersicht darstellen (Kap.III).
Im weiteren Verlauf werde ich dann auf die Entstehung, Grundprinzipien und
Rahmenbedingungen des Förderkonzeptes eingehen. Dabei verzichte ich auf die Darstellung
des sprachsystematischen Aufbaus, da sich dieser nicht direkt auf die Leistungsmotivation
auswirkt und das Ausmaß dieser Arbeit übersteigen würde (Kap. IV).
Sowohl für die Entstehung, als auch für den Verlauf einer Lese-Rechtschreib-Schwäche sind
verschiedene Einflussfaktoren verantwortlich. So unterliegt auch die Leistungsmotivation
unterschiedlichen Einflüssen. Wie in Abb.7 ersichtlich gehören dazu u.a. die Einflüsse durch
die Familie, die individuellen Lernvoraussetzungen, die ich hier hinsichtlich des emotionalen
Bereiches und dem damit eng zusammenhängenden Thema der Pubertät fokussieren werde,
und die Motivation durch den Lehrer und den Einfluss der Schülermotivation auf die des
Lehrers. Mir ist es wichtig, diese bedeutenden Einflussfaktoren der Leistungsmotivation in
der Legasthenieförderung anzusprechen, wenn dies auch nur in einem begrenzten Rahmen
möglich ist, denn jeder dieser Faktoren wäre es wert, in einer eigenen Arbeit behandelt zu
werden.
Zuletzt möchte ich die beschriebenen theoretischen Grundlagen anhand eines Fallbeispiels
aus meiner Berufspraxis verdeutlichen (Kap.VI).
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung.
- II. Motivation
- 1. Definition..
- 2. Determinanten und ihre theoretischen Bezüge..
- a) Motive und die Maslowsche Bedürfnispyramide..
- b) Anreize und die Feldtheorie Lewins....
- c) Kognitive Prozesse und Weiners Attributionstheorie..
- 3. Intrinsische und extrinsische Motivation
- a) Intrinsische Motivation....
- b) Extrinsische Motivation...
- 4. Leistungsmotiv und Leistungsmotivation
- a) Definitionen...
- b) Gütemaßstab und Anspruchsniveau..
- c) Atkinsons Theorie der Leistungsmotivation..
- III. Legasthenie
- 1. Definition....
- 2. Symptome..
- a) Lesestörungen...
- b) Rechtschreibstörungen..
- c) Vorausgehende oder begleitende Schwierigkeiten...
- IV. Förderkonzept nach C. Reuter-Liehr
- 1. Das Forschungsprojekt..
- 2. Grundprinzipien.…………………….
- 3. Rahmenbedingungen.
- V. Einflussflaktoren
- 1. Pubertät.
- 2. Familie..
- 3. Selbstwertgefühl und Emotionen....
- 4. Motivation der Förderlehrer..
- VI. Fallbeispiel....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Leistungsmotivation von Schülern in der Legasthenieförderung. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte der Motivation und Leistungsmotivation zu beleuchten, die Entstehung, Grundprinzipien und Rahmenbedingungen eines Förderkonzepts für Legasthenie zu erklären und die Einflussfaktoren auf die Leistungsmotivation der Schüler in diesem Kontext zu analysieren.
- Definition und Determinanten der Motivation
- Theorien der Motivation (Maslow, Lewin, Weiner)
- Intrinsische und extrinsische Motivation
- Leistungsmotivation und deren Einflussfaktoren
- Das Förderkonzept nach C. Reuter-Liehr und dessen Anwendung in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Relevanz des Themas Leistungsmotivation in der Legasthenieförderung beleuchtet. Anschließend wird der Begriff der Motivation definiert und mit verschiedenen Theorien in Verbindung gebracht, wie z.B. der Maslowschen Bedürfnispyramide, der Feldtheorie Lewins und der Attributionstheorie Weiners.
Das dritte Kapitel behandelt die Legasthenie, ihre Definition und Symptomatik. Kapitel IV beleuchtet das Förderkonzept nach C. Reuter-Liehr, seine Entstehung, Grundprinzipien und Rahmenbedingungen.
Kapitel V widmet sich den Einflussfaktoren auf die Leistungsmotivation in der Legasthenieförderung, darunter die Pubertät, die familiäre Umgebung, das Selbstwertgefühl und die Motivation der Förderlehrer.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Leistungsmotivation, Legasthenieförderung, Motivationstheorien, Förderkonzepte, Einflussfaktoren, Legasthenie-Symptome, Pubertät, Familie, Selbstwertgefühl und Lehrermotivation.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Legasthenie die Leistungsmotivation?
Schüler mit Legasthenie erleben oft Misserfolge, was zu einer sinkenden Erfolgserwartung und damit zu einer geringeren Leistungsmotivation führen kann.
Welche Motivationstheorien sind in der Förderung relevant?
Wichtige Ansätze sind Maslows Bedürfnispyramide, Lewins Feldtheorie und Weiners Attributionstheorie, die erklären, wie Anreize und Erfolgserlebnisse wirken.
Was ist das Förderkonzept nach C. Reuter-Liehr?
Es handelt sich um ein strukturiertes Programm zur Behandlung von Lese-Rechtschreib-Störungen, das auf sprachsystematischen Grundlagen und motivationsfördernden Rahmenbedingungen basiert.
Welchen Einfluss hat die Pubertät auf die Förderung?
In der Pubertät verändern sich emotionale Bedürfnisse und das Selbstwertgefühl, was die Lernbereitschaft und die Motivation in der Legasthenieförderung stark beeinflussen kann.
Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation?
Intrinsische Motivation kommt aus dem inneren Interesse an der Sache selbst, während extrinsische Motivation durch äußere Anreize wie Noten oder Belohnungen gesteuert wird.
- Arbeit zitieren
- Michaela Wittich (Autor:in), 2004, Leistungsmotivation in der Legasthenieförderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33400