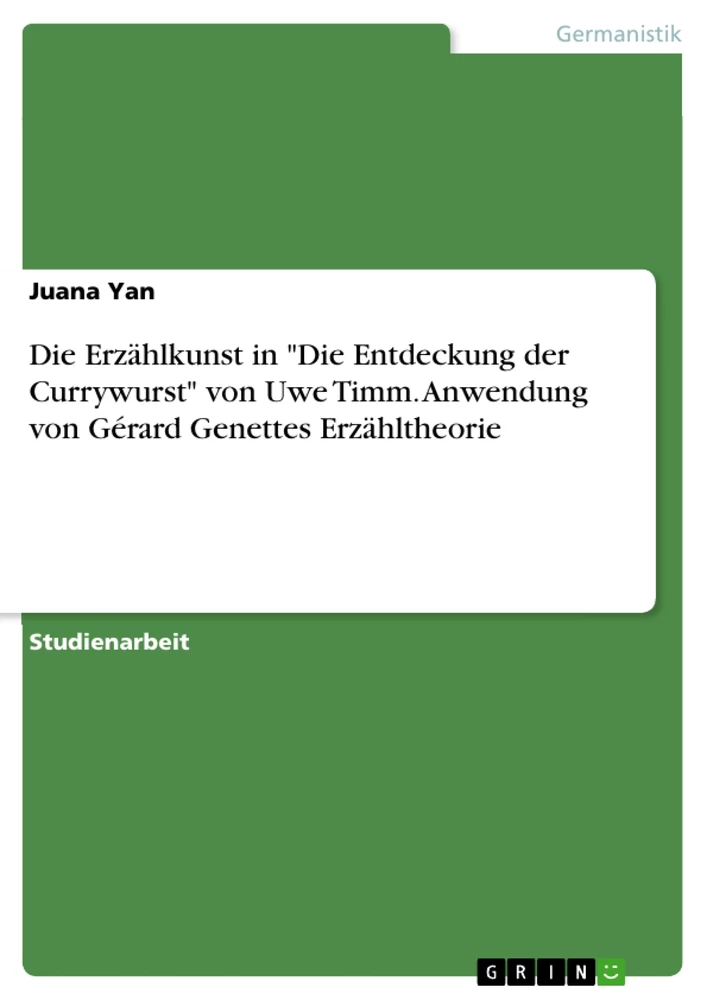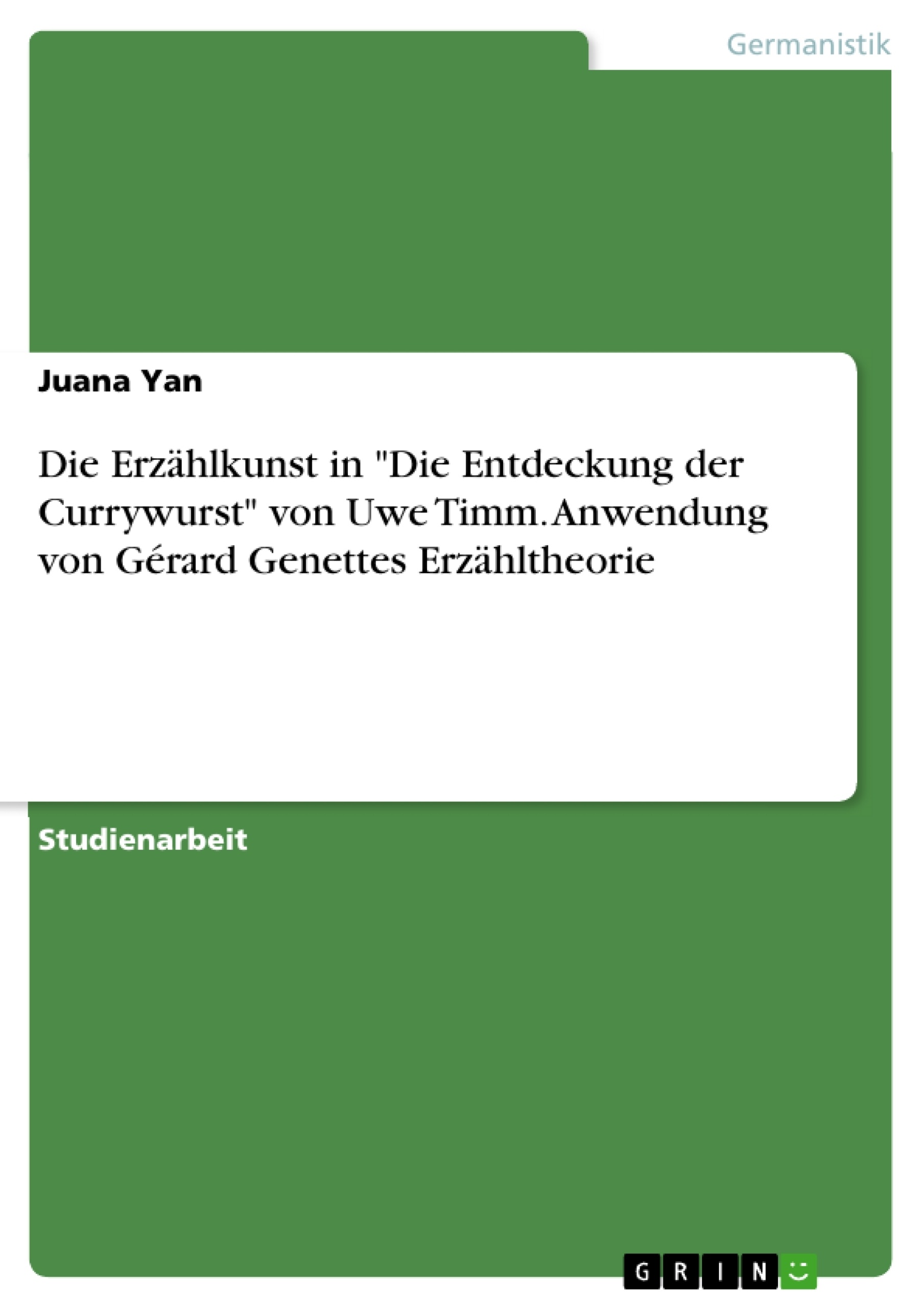Die vorliegende Arbeit entstand aus dem erzähltheoretischen Interesse an dieser deutschen Novelle. Meine Wahl fiel auf die Novelle „Die Entdeckung der Currywurst“, weil sie einen relativ geringeren Bekanntheitsgrad in China aufweist und nicht bereits einer ausführlichen Behandlung unterzogen wurde.
Es handelt sich um eine literaturwissenschaftliche Analyse. Als theoretische Grundlage stütze ich mich auf die Literatur „Die Erzählung“ von dem französischen Theoretiker der Narratologie Gérard Genette, deren Untersuchung sich im Wesentlichen auf den narrativen Diskurs beziehen. In der vorliegenden Arbeit wird versucht herauszufinden, wie die vom Autor Uwe Timm gewählte Erzähltechnik mit dem Thema der Novelle „Die Entdeckung der Currywurst“ im Zusammenhang steht sowie welche Wirkung durch die Wahl bestimmter Erzähltechniken erzielt wird.
Bevor ich zu dem Hauptteil meiner Arbeit komme, wird zunächst der Aufbau meiner Arbeit vorgestellt:
Nach der Einleitung möchte ich in Kapital zwei Uwe Timm, sowie die Erzählung „Die Entdeckung der Currywurst“ kurz vorstellen. In Kapitel drei geht es um die theoretische Grundlage, nämlich die Erzähltheorie nach Gérard Genette. Anschließend widmet das vierte Kapitel sich dem Hauptteil der vorliegenden Arbeit: der erzähltheoretischen Interpretation der Kurzgeschichte, die gemäß Genette mit der Analyse in der Zeit, im Modus und in der Stimme vorgenommen wird. Danach folgt in Kapitel fünf eine Schlussfolgerung, die die Ergebnisse noch einmal zusammenfasst.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Hintergrund und Überblick
- Inhaltsangabe zur Novelle Die Entdeckung der Currywurst
- Uwe Timm
- Theoretische Grundlage: Genettes Erzähltheorie
- Analyse der Novelle anhand der Theorie zur Erzähltechnik nach Genette
- Analyse unter dem Aspekt der Zeit
- Ordnung
- Dauer
- Frequenz
- Analyse unter dem Aspekt des Modus
- Distanz
- Fokalisierung
- Analyse unter dem Aspekt der Stimme
- Zeit der Narration
- Narrative Ebenen
- Person
- Analyse unter dem Aspekt der Zeit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert Uwe Timms Novelle "Die Entdeckung der Currywurst" mit dem Fokus auf Gérard Genettes Erzähltheorie. Ziel ist es, die gewählte Erzähltechnik im Zusammenhang mit dem Thema der Novelle zu betrachten und die Wirkung bestimmter Techniken zu untersuchen. Die Arbeit untersucht, wie Genettes Theorie zur Analyse von Zeit, Modus und Stimme verwendet werden kann, um die narrative Struktur und die Bedeutung der Novelle zu enthüllen.
- Die Verwendung von Genettes Erzähltheorie zur Analyse der Novelle "Die Entdeckung der Currywurst"
- Die Beziehung zwischen Erzähltechnik und Thema der Novelle
- Die Wirkung verschiedener Erzähltechniken auf den Leser
- Die Rolle von Zeit, Modus und Stimme in der Konstruktion der Geschichte
- Die Analyse der verschiedenen Erzählebenen in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Novelle "Die Entdeckung der Currywurst" sowie Genettes Erzähltheorie vor. Kapitel zwei bietet einen Überblick über die Novelle und den Autor Uwe Timm. Kapitel drei stellt Genettes Theorie zur Erzähltechnik vor. Kapitel vier analysiert die Novelle mit Hilfe von Genettes Theorie, wobei die drei Kategorien Zeit, Modus und Stimme im Detail betrachtet werden. Die Analyse der Zeit untersucht die chronologische Ordnung der Ereignisse, die Dauer der erzählten Zeit und die Frequenz der Ereignisse. Die Analyse des Modus behandelt die Distanz zwischen Erzähler und Leser sowie die Perspektivierung des Erzählten. Schließlich beleuchtet die Analyse der Stimme die erzählende Person, die narrative Ebene und die Beziehung zwischen Erzähler und Adressaten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Schlüsselwörter der Arbeit umfassen: "Die Entdeckung der Currywurst", Uwe Timm, Gérard Genette, Erzähltheorie, Zeit, Modus, Stimme, Erzähltechnik, Anachronie, Fokalisierung, Homodiegetischer Erzähler, Heterodiegetischer Erzähler, Rahmenhandlung, Binnenerzählung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Uwe Timms Novelle „Die Entdeckung der Currywurst“?
Die Novelle verknüpft die fiktive Entstehungsgeschichte der Currywurst mit einer Liebesgeschichte am Ende des Zweiten Weltkriegs in Hamburg.
Wie wird Gérard Genettes Erzähltheorie in der Analyse angewandt?
Die Analyse untersucht den Text systematisch nach den Kategorien Zeit (Ordnung, Dauer, Frequenz), Modus (Fokalisierung) und Stimme (Erzählebene).
Welche Rolle spielt die „Zeit“ in der Erzähltechnik der Novelle?
Die Arbeit analysiert Anachronien (Rückblenden und Vorausdeutungen), die den Zusammenhang zwischen der Rahmenhandlung und der Binnenerzählung verdeutlichen.
Was bedeutet „Fokalisierung“ in diesem literarischen Kontext?
Es beschreibt die Perspektive, aus der die Geschichte erzählt wird, und wie die Wahrnehmung des Erzählers die Wirkung des Themas auf den Leser beeinflusst.
Was ist der Unterschied zwischen Rahmen- und Binnenerzählung in diesem Werk?
Die Rahmenhandlung zeigt den Erzähler auf der Suche nach der Geschichte, während die Binnenerzählung die Erlebnisse von Lena Brückner im Jahr 1945 schildert.
- Arbeit zitieren
- Juana Yan (Autor:in), 2015, Die Erzählkunst in "Die Entdeckung der Currywurst" von Uwe Timm. Anwendung von Gérard Genettes Erzähltheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334216