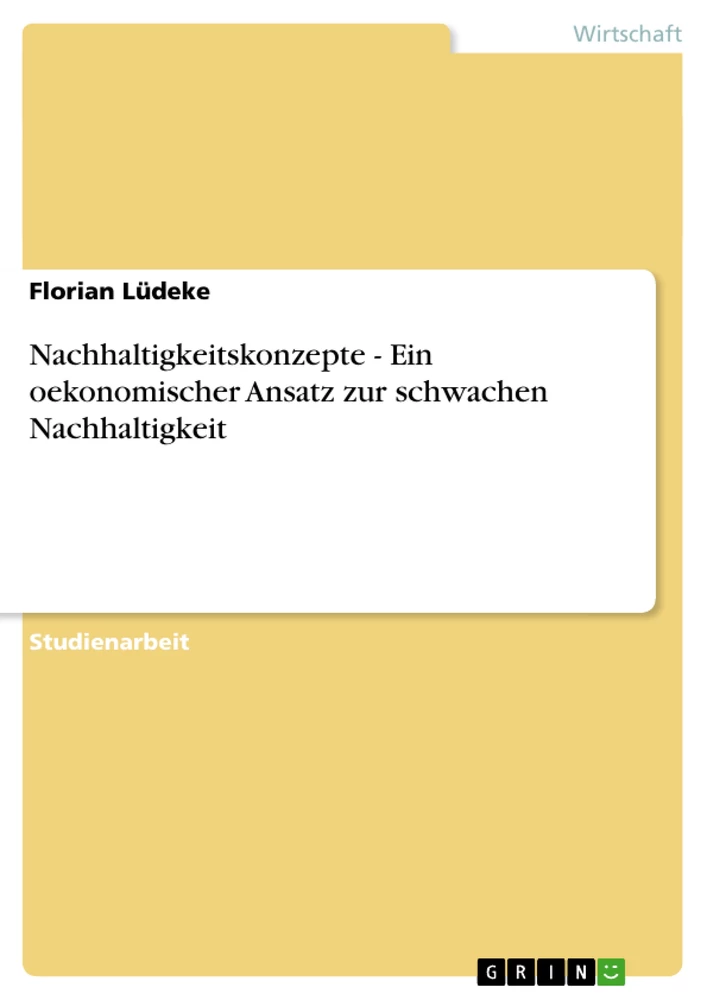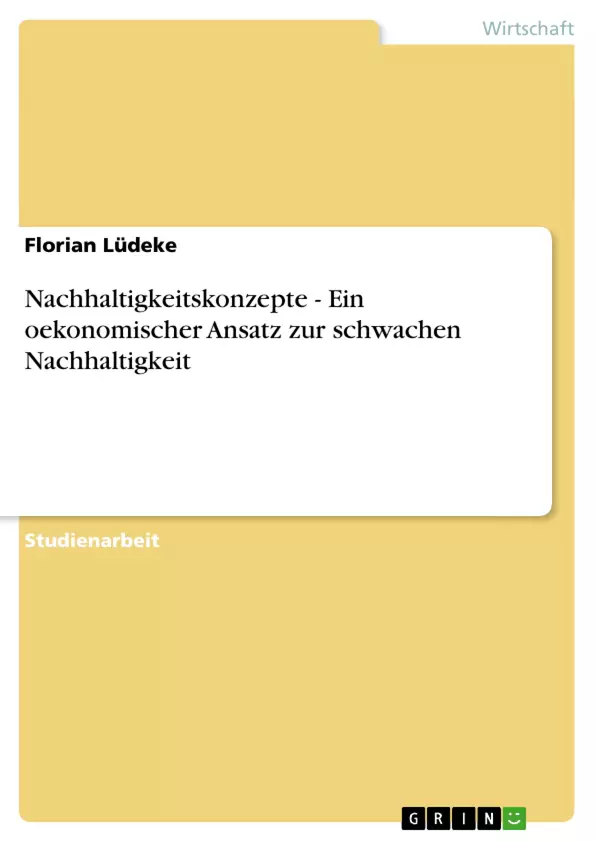Vorgestellt werden ökonomische und ökologische Ansätze das Problem einer langfristig tragbaren Entwicklung des Verhältnisses zwischen Mensch und Umwelt anzugehen (Abschnitt 1). Das Problem, welches sich dahinter verbirgt, lässt sich einleitend damit umreißen, dass der Mensch als abhängiger Bestandteil der irdischen Biosphäre in Wechselwirkung mit und in dieser lebt, grundlegend von dem langfristigen Bestand des Metasystems „Umwelt“ abhängt und mit all seinen Aktivitäten (im Besonderen mit wirtschaftlichen Aktivitäten) auf dieses System einwirkt. Um dieses Verhältnis langfristig tragbar (oder anders ausgedrückt: nachhaltig) zu gestalten, gibt es diverse Ansätze unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen, die – ausgehend vom status quo – in normativer Weise verschiedene Vorstellungen über eine zu erreichende ökonomischökologische Nachhaltigkeit konzeptualisieren.
Besonderes Augenmerk wird auf modellhafte Vorstellungen der ökonomischen Theorie zu einer langfristig tragbaren Entwicklung des Verhältnisses Mensch-Umwelt gelegt; grundlegende Modelleigenschaften werden in Abschnitt 2 und 4 behandelt. Bei den ökonomischen Ansätzen geht es letztlich darum, die Konsummöglichkeiten für die Zukunft aufrecht zu erhalten und die Bedingungen, an welche dies geknüpft ist, zu untersuchen. Dies geschieht in Abschnitt 3 und 4. Der Schwerpunkt dieser Ausarbeitung liegt in der Auseinandersetzung mit dem Problem konstanten Konsums gemäß des SOLOW’schen Ansatzes einer schwachen Nachhaltigkeit unter Einbezug der HARTWICK-Regel. Die Kernaussagen dieses Ansatzes werden insbesondere in Abschnitt 4 behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Ansätze zur Konzeptualisierung des Gedankens der Nachhaltigkeit
- 2 Ein ökonomischer Ansatz – Grundlegende Modellannahmen.
- 3 Nicht erneuerbare Ressourcen als Produktionsfaktor
- 3.1 Die Bedeutung der Ressourcensubstitution........
- 3.1.a Kapital und Ressource als perfekte Substitute.
- 3.1.b Kapital und Ressource als perfekte Komplemente
- 3.1.c Cobb-Douglas-Produktionsfunktion
- 4 Ein Modell konstanter Konsummöglichkeiten
- 4.1 Die HARTWICK-Regel....
- 4.2 Modellbeschreibung..
- 4.3 Konstanter Konsum...
- 4.3.a Herleitung eines konstanten Konsumniveaus
- 4.3.b Kurze Erläuterung der HOTELLING-Regel..
- 4.4 Zusammenfassung....
- 5 Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung präsentiert einen ökonomischen Ansatz zur Konzeptualisierung von „schwacher Nachhaltigkeit“, indem sie die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf die langfristige Tragbarkeit dieser Beziehung und die Erhaltung von Konsummöglichkeiten für zukünftige Generationen. Sie befasst sich mit den Bedingungen für konstante Konsumniveaus und untersucht die Rolle von Ressourcen, Kapital und der Substitution zwischen diesen Faktoren.
- Ökonomische Ansätze zur Nachhaltigkeit
- Konstanter Konsum und intertemporale Ressourcenallokation
- Ressourcensubstitution und Kapitalbildung
- Das Modell der schwachen Nachhaltigkeit nach Solow und Hartwick
- Kritik an ökonomischen Nachhaltigkeitskonzepten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem der nachhaltigen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Mensch und Umwelt dar und erläutert die Notwendigkeit, diverse Ansätze verschiedener Disziplinen zu berücksichtigen. Kapitel 1 liefert eine Einführung in verschiedene Konzepte der Nachhaltigkeit, darunter ökologische und ökonomische Perspektiven. Kapitel 2 legt die grundlegenden Modellannahmen des ökonomischen Ansatzes zur Nachhaltigkeit dar, einschließlich der Annahme einer nicht erneuerbaren Ressource und einer konstanten Bevölkerung. Kapitel 3 untersucht die Bedeutung der Ressourcensubstitution und die Rolle von Kapital im Produktionsprozess. Kapitel 4 behandelt das Modell konstanter Konsummöglichkeiten, einschließlich der Hartwick-Regel, und zeigt die Bedingungen auf, unter denen konstante Konsumniveaus über die Zeit realisierbar sind.
Schlüsselwörter
Diese Ausarbeitung befasst sich mit den zentralen Themen der Nachhaltigkeitsökonomie, insbesondere der schwachen Nachhaltigkeit. Schlüsselbegriffe sind Ressourcen, Kapital, Ressourcensubstitution, Konsum, intertemporale Allokation, Hartwick-Regel, Solow-Modell und ökologische Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "schwacher Nachhaltigkeit"?
Schwache Nachhaltigkeit ist ein ökonomischer Ansatz, der davon ausgeht, dass natürliches Kapital durch produziertes Kapital (Maschinen, Wissen) substituiert werden kann, solange der Gesamtkapitalstock erhalten bleibt.
Was besagt die Hartwick-Regel?
Die Hartwick-Regel besagt, dass ein konstanter Konsum über die Zeit möglich ist, wenn die Renten aus der Ausbeutung nicht erneuerbarer Ressourcen vollständig in reproduzierbares Kapital reinvestiert werden.
Welche Rolle spielen nicht erneuerbare Ressourcen im Produktionsprozess?
Sie dienen als Produktionsfaktor, wobei die Studie untersucht, inwieweit sie durch Kapital substituiert werden können (z.B. mittels Cobb-Douglas-Produktionsfunktion).
Was ist die Hotelling-Regel?
Die Hotelling-Regel beschreibt die optimale intertemporale Ressourcenallokation, bei der der Preis einer Ressource mit dem Zinssatz steigen sollte.
Welche Kritik gibt es an ökonomischen Nachhaltigkeitskonzepten?
Kritiker bemängeln oft die Annahme der unbegrenzten Substituierbarkeit von Natur durch Technik und die Vernachlässigung ökologischer Belastungsgrenzen.
- Arbeit zitieren
- Florian Lüdeke (Autor:in), 2004, Nachhaltigkeitskonzepte - Ein oekonomischer Ansatz zur schwachen Nachhaltigkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33426